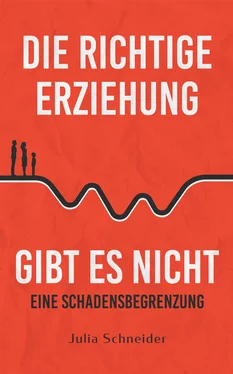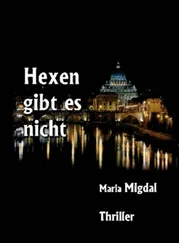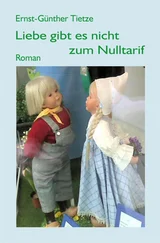Etwa ab dem zweiten Lebensjahr löst sich das Kind nach und nach von den Eltern und entwickelt damit auch einen eigenen Willen. Stößt es dann auf Widerstände oder gelingt ein Vorhaben nicht nach Wunsch, wird Wut, Enttäuschung und eine heftige Trotzreaktion ausgelöst. Diese äußert sich in Geschrei, Geheul, in Zerstörungswut oder Bockigkeit. Das Beruhigen in solchen Phasen ist schwierig, das Kind kann sich nur sehr langsam abkühlen.
In der Entwicklungspsychologie wird diese Phase die „Autonomiephase“ genannt, die für Eltern dann besonders schwierig ist. Sie tritt bei allen Kindern auf, kann jedoch unterschiedlich in der Intensität ausgeprägt sein.
Das hängt wiederum vom Entwicklungsprozess und dem Charakter des Kindes ab. Die Phase ist durch eine wachsende Ich-Identität gekennzeichnet, in der ein Kind denkt, alles hätte sich um seine Wünsche zu drehen. Die Dauer kann dann ganz unterschiedlich ausfallen. Die Trotzphase endet, wenn ein Kind in der Lage ist, seine Emotionen zu verstehen und zu kontrollieren. Einfluss nehmen Eltern in der Autonomiephase durch den gewählten Erziehungsstil, den sie für richtig halten. Gleichzeitig wirken auch die sozial-emotionale und sprachliche Entwicklung auf die Trotzphase ein. Das Kind muss lernen, negative Gefühle zu verdauen und zu beherrschen, eine damit verbundene höhere Frustrationstoleranz zu entwickeln und andere Menschen in ihren Eigenschaften zu akzeptieren. Dabei können ihm die Eltern behilflich sein, nicht nur durch ihre Erziehungsmaßnahmen, sondern auch durch das eigene Verhalten und die Reaktion auf das Kind und die Situation.
Die geistige Entwicklung steht in enger Verbindung mit der Wahrnehmung der Umwelt und spielerischen Beschäftigungen. Eindrücke werden verarbeitet und das Kind lernt alle Denkschritte in spielerischer Form. Es beginnt, räumliche Beziehungen herzustellen und sich damit auseinanderzusetzen, wodurch die räumliche Vorstellung entwickelt wird. Meistens ist das über typische Aktionen mit Bauklötzen oder im Sandkasten der Fall. Beginnt das Kind, aus Bauklötzen Türme zu bauen, lernt es über den Zusammenfall, was nötig ist, damit der Turm stehen bleibt. Die Auffassungsgabe ist dabei sehr hoch und steigert das Interesse auch allgemein, wissen zu wollen, wie etwas funktioniert und gehandhabt wird.
Das Kind möchte mehr und mehr alles selbst machen, darunter alleine mit dem Löffel essen, sich selbst die Haare kämmen oder alleine auf den Topf gehen. Es begreift, dass seine Handlungen eine Wirkung haben. Bald besitzt das Kind eine stabile innere Vorstellung von allen Gegenständen und prägt sich diese durch das Spielen ein. Umwelteindrücke und Alltagsszenen werden übernommen und in das Spiel integriert, z. B. eine Puppe gefüttert oder ein Teddybär auf den Arm genommen. Dabei lernt das Kind, sich das Ergebnis der Handlung auch ohne die Ausführung vorstellen zu können. Es muss daher nicht immer mehr erst ausprobieren, was passieren wird.
Wirklich begreifen, was Ursache und Wirkung sind, kann das Kleinkind allerdings noch nicht. Die starke Ich-Identität sorgt dafür, dass alles, was geschieht, für das Kind auf eigenes Handeln zurückgeführt wird. Sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ist erst möglich, wenn das Kind Gesetzmäßigkeiten zuordnen kann und Fragen zu stellen beginnt. Auch das Gedächtnis entwickelt sich sehr schnell. Das Kind beginnt endlich, simplere Mengen- und Zeitbegriffe zu erfassen, lernt z. B. mühelos Geschichten oder Lieder.
Hier beginnt auch die „magische Phase“, die dann etwa vom dritten bis zum fünften Lebensjahr anhält. In diesem Lebensabschnitt ist für ein Kind und dessen Vorstellung so gut wie alles möglich. Was es denkt oder sich wünscht, was es für schön oder für schrecklich hält, könnte wahr werden. Es hält eigene Vorstellungen für real und befürchtet entsprechend auch, dass das eigene Denken der Auslöser für das ist, was passiert. Genauso werden Ahnungen oder Ängste wirklich, darunter das Monster unter dem Bett.
Die magische Phase ist sehr intensiv und fordert von Eltern einen hohen Grad an Verständnis. Dabei werden dem Geschehen kindliche Erklärungen zugeordnet. Wenn es regnet, weint eine Wolke, weil sie traurig ist. Ein Ball bleibt liegen, weil er sich ausruhen möchte. Der Weihnachtsmann ist eine reale Person und kommt nicht, wenn das Kind böse gehandelt hat. All diese Vorstellungen haben einen großen Einfluss auf die Emotionen. Die Fantasie ist sehr ausgeprägt. In dieser Phase entwickeln Kinder dann auch die Tendenz, zu flunkern oder die Unwahrheit zu erzählen. Das muss nicht immer böswillig sein, sondern kann auch dadurch sein, weil das Kind das, was es fühlt und gesehen zu haben glaubt, für real hält. Häufig erschaffen sich Kinder in dieser Phase auch einen imaginären Freund, der ihnen Halt gibt und mit dem sie sich stundenlang unterhalten können.
Eltern machen sich in dieser Zeit natürlich verstärkt Sorgen, ob das Kind eine zu starke Fantasie entwickelt oder sich angewöhnt, zu lügen. Meistens ist die Angst jedoch unbegründet. Letztendlich möchte das Kind nur ernst genommen werden und fordert die gewünschte Aufmerksamkeit. Das bringt mit sich, dass Eltern ernsthaft auf das Kind eingehen sollten, sowohl beim Geschichtenerzählen als auch bei den alterstypischen Ängsten. Nach und nach gewinnt dann beim Kind das realistische Denken wieder die Oberhand. Auf dem Weg orientiert sich das Kind immer am Verhalten der Erwachsenen und beobachtet, wie auf ungewohnte Situationen reagiert wird. Nur so ist es dann in der Lage, eigene Schlüsse aus dem zu ziehen, was ihm begegnet.
3. Die Entstehung der Gefühle, auf die Eltern Einfluss nehmen können

Schon sehr früh machen Kinder Erfahrungen im Umgang mit ihren Gefühlen. Das beginnt bereits beim Brustgeben, wenn z. B. die emotionale Verfassung der Mutter verschieden ausfällt. Ist sie gelöst und ruhig, ist auch das Kind glücklich und entspannt. Ist die Mutter gestresst und sitzt mit starrem Gesicht da, verkrampft sich das Kind und beginnt zu schreien. So lernt das Kind nach und nach, dass seine Bedürfnisse und seine Gefühlsäußerungen von den Eltern und besonders von der Mutter ernst genommen und befriedigt werden. Alle Erlebnisse sind prägend und drücken sich gleichzeitig in einer über Jahre wiederholten Interaktion zwischen Kind und Eltern aus.
Die deutlichsten Spuren der emotionalen Entwicklung vertiefen sich zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahr. Hier werden das Emotionswissen, der Emotionsausdruck und die Emotionsregulation geprägt. Das Kind erkennt, welche Emotionen was auslösen und entwickelt Strategien, um zu erreichen, was es will. Was zunächst auf Basis der reinen Mimikdeutung und auf der nicht verbalen Ebene geschieht, setzt sich fort, wenn das Kind zu sprechen beginnt und seine Gefühle über die Sprache und das kindliche Repertoire an Gefühlen ausdrückt. Immer wichtiger wird dabei, zu erklären, warum Ängste bestehen oder eine Emotion erfolgt. Sobald das Kind dann versteht, in welcher Situation welche Emotionen bei ihm selbst ausgelöst werden, entwickelt es ein Verständnis für die Gefühle anderer.
Vorher ist es für Eltern wichtig, auf die Gefühle des Kindes einzugehen und diese vor allen Dingen zu respektieren. Fühlt sich ein Kind unverstanden oder verlacht, wird es den Rückzug antreten und immer weniger darauf Wert legen, sich mitzuteilen. Es entwickelt allmählich Gefühle wie Scham, Stolz, Neid oder Schuld. Es vermischt eigene und fremde Gefühle und kann schließlich diese auch unterscheiden.
Eine wichtige Rolle bei Kindern und Eltern ist die emotionale Kompetenz. Eltern können diese bei ihrem Kind günstig fördern, wenn das Kind ernst genommen wird, wenn es lernt, Gefühle bei sich und bei anderen richtig zu deuten, wenn es in der Lage ist, Gefühle zu benennen, und wirksame Strategien entwickelt, um mit den Gefühlen umzugehen. Das geschieht von Anfang an, durch unmittelbare Reaktionen und emotionale Erlebnisse. Typische Gefühle sind Ängste, Wut, Traurigkeit oder Freude, die das Kind für sich verarbeitet, aber auch durch das Verhalten der Eltern lernt. Eine gute emotionale Entwicklung ist dann möglich, wenn ein offener Umgang mit Gefühlen in der Familie gepflegt wird, entsprechend ein positives Familienklima vorherrscht, ein feinfühliges Verhalten bei negativen Gefühlsäußerungen durch das Kind und die dazugehörige offene Kommunikation und Akzeptanz die Grundvoraussetzungen sind. Eine gegenteilige Atmosphäre hemmt dagegen das Lernen in emotionalen Situationen. Das ist auch beim Ignorieren von Gefühlen oder bei Bestrafung der Fall. Schaffen es Eltern, ihre eigenen Gefühle günstig zu beeinflussen und vor dem Kind zu beherrschen, ohne die Alltagsprobleme auf das Kind zu übertragen, wächst der familiäre Zusammenhalt. Sind Eltern dagegen oft gereizt oder gestresst, wirkt sich das als Belastung immer auf das Kind aus.
Читать дальше