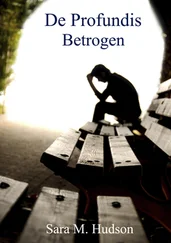Die alte Dame sah Ellen von oben bis unten an. Sie atmete tief ein und begann dann mit ruhiger Stimme: „Gerade weil ich weiß, wie es Ihnen geht, mache ich Ihnen diese Vorschläge, Kindchen. Ich habe doch das Gleiche schon hinter mir. Mir hat damals niemand wirklich geholfen, weder als ich meinen Mann verloren hatte, noch als bei mir selbst diese Krankheit diagnostiziert wurde. Da musste ich ganz alleine durch. Die Hand getätschelt zu bekommen und gesagt zu kriegen, wie schlimm das ja alles ist, hätte ich aber auch schon damals nicht für besonders hilfreich gehalten.
Da Sie weder jemand hier her begleitet, noch bisher besucht hat, gehe ich davon aus, dass Sie, wie ich, keine Familie haben, oder mit der Sache irgendwie selbst fertig werden wollen. Ich weiß, dass das alles nur schwer alleine geht, Kindchen. Das ist eben meine Art, Ihnen Hilfe anzubieten.“
Ellen antwortete nicht. Sie hatte sich kraftlos auf das leere, mit Schutzfolie überzogene Bett fallen lassen, das zwischen ihnen stand und sah Frau Althoff mit großen Augen an. Die Frau hatte ja recht: Sie hatte wirklich niemanden, der ihr jetzt zur Seite stehen würde. Wer war da denn schon? Ihre Kollegen? Oder etwa ihr Chef? Außerhalb der Arbeit hatte sie mittlerweile nur wenige Kontakte und als Einzelkind, dessen Eltern seit deren Ruhestand am Gardasee lebten, auch niemanden, der in ihrer unmittelbaren Nähe lebte und sich um sie kümmern würde.
Ihren Eltern hatte sie von der Krankheit noch gar nichts gesagt. Sie wollte sie nicht beunruhigen. Ihr Vater hatte ohnehin Herzprobleme und konnte Aufregung nicht vertragen. Sie hatte geglaubt, damit durchzukommen, ihnen alles zu verschweigen. Von der OP hätten sie nie etwas erfahren müssen. Sie wäre in ein paar Tagen wieder zu Hause gewesen, hätte ihren Eltern vielleicht erzählt, dass sie für ein paar Tage verreist war und die Sache wäre erledigt gewesen. Aber jetzt…
„Wie dem auch sei“, sagte Frau Althoff bestimmt. „Sie müssen auf andere Gedanken kommen. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Aber nehmen Sie meinen wohlgemeinten Rat an: Es hilft wirklich nichts, zu jammern und in Selbstmitleid zu versinken. Das tut ihrem Gesundheitszustand überhaupt nicht gut. Was sie tun müssen, ist weitermachen. Kämpfen solange es geht! Je schneller Sie ihr Schicksal annehmen, desto besser! Dann bekommen Sie auch die Kraft, zu kämpfen und geben Ihrer verbleibenden Zeit mehr Qualität. Außerdem erwischt es früher oder später eh jeden von uns.“
In Ellens Augen blitzten Zorn und Verzweiflung auf und sie schrie:
„Sie mit Ihren blöden Weisheiten! Wie soll ich denn weitermachen, wenn es nicht mehr lange zum Weitermachen gibt? Ein halbes Jahr, ein Jahr… Das sind doch keine Aussichten! Wie können Sie nur sagen, dass ich das alles lockerer sehen muss?“
Frau Althoff stand auf, legte ihren tragbaren CD-Player auf ihren Nachttisch, nahm die Saftflasche und ein frisches Glas und setzte sich neben Ellen aufs Bett. Die Schutzfolie knisterte. „Das hat nichts mit ‚locker sehen‘ zu tun. Sie wissen nie, wann es vorbei ist, Kindchen. Ob Sie nun gesund sind oder nicht. Es kann immer aus sein, ohne dass man damit rechnet. Ein Unfall, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt…. Der Tod macht vor keinem Halt. Die Wenigsten machen sich darüber rechtzeitig Gedanken und meinen, das reicht noch, wenn man alt ist. Aber wer sagt, dass man so lange Zeit hat? Nicht viele wissen, wann und an was sie sterben werden. Wir wissen es. Naja, nicht genau wann, aber wir können den Zeitraum ziemlich eng eingrenzen.“
Ellen schüttelte verständnislos den Kopf. Mit den seltsamen Ansichten und Lebensweisheiten dieser Frau konnte sie sich absolut nicht anfreunden. Trotzdem ließ sie Frau Althoff gewähren, als sie ihr einen großen Schluck roten Saft einschenkte und ihr hinhielt. Sie drehte sich auch nicht von ihr weg, als sie ihr die Hand auf die Schulter legte und sagte: „Trinken Sie, dann geht es Ihnen gleich wieder besser.“ Misstrauisch nahm Ellen das Glas und roch daran.
„Das ist ja gar kein Saft“, schniefte sie und wischte sich eine Träne von der Wange.
„Naja, aber wenn man es genau nimmt, war es mal Saft. Jetzt nennt man es Port. Zum Wohl“, erwiderte Frau Althoff kichernd, langte zu ihrem Nachttisch hinüber und holte sich ihr eigenes Glas. Sie prostete Ellen zu und trank es dann in einem Zug leer. Ellen lächelte müde, hob aber schließlich doch ihr Glas, prostete Frau Althoff zu und trank.
Einige Zeit später betrat die Nachtschwester Zimmer 211 auf ihrem abendlichen Rundgang. Sie hatte im Berichtbuch gelesen, dass es Probleme in diesem Zimmer gab. Sie erwartete Gezeter und Beschwerden und hatte sich deshalb dieses Zimmer auf ihrer Runde bis zum Schluss aufgehoben. Sie wollte erst alle anderen Patientinnen versorgt wissen, da sie bestimmt heute Abend noch so einige Scherereien mit den Bewohnern dieses Zimmers haben würde. Wo Frau Althoff war, gab es immer Beschwerden. Sie war ja nicht das erste Mal hier und war, sowohl dem Pflegepersonal als auch den Ärzten, wohl bekannt. Meistens ging es um ihren Udo-Jürgens-Tick. Frau Althoff pflegte, ohne Rücksicht auf andere, lauthals einen Udo-Jürgens-Schlager nach dem anderen zu schmettern. Manchmal auch mitten in der Nacht.
Als die Nachtschwester nun das Zimmer betrat, hatte sie aber eher das Gefühl zu stören, denn die beiden Patientinnen saßen einvernehmlich am Tisch, spielten Karten und kicherten vergnügt. Sie blickten nicht einmal von ihrem Blatt auf, als sie sie fragte, ob sie noch etwas zum Schlafen bräuchten und beide verneinten. Schwester Daniela wünschte den beiden Frauen eine gute Nacht und nahm auf dem Weg nach draußen Ellens Tablett mit, das noch immer vom Abendessen dastand. Zurück im Schwesternzimmer warf sie verwirrt einen Blick ins Stationsbuch. „Probleme in Zimmer 211. Patientin Bleckmann wünscht verlegt zu werden, weil sie mit Patientin Althoff nicht klarkommt.“ So stand es eindeutig und unmissverständlich im Buch, hatte aber eben nicht danach ausgesehen.
„Haben Sie denn gar nichts zu Essen bekommen?“ fragte Ellen ihre Mitbewohnerin.
„Ich werde doch morgen operiert, da krieg ich nichts mehr“, war deren Antwort.
„Und dann trinken Sie Alkohol?“ fragte Ellen entsetzt.
„Ja, ja, das geht schon“, beschwichtigte sie diese. „Was soll denn schon passieren? Mehr als sterben kann ich schließlich nicht.“ Missbilligend schüttelte Ellen den Kopf. Schon wieder so eine sarkastische Bemerkung.
„Wie haben Sie ihn eigentlich bemerkt?“ wollte Frau Althoff wissen.
„Bemerkt? Den Krebs?“ fragte Ellen. Frau Althoff nickte und nahm einen großen Schluck von ihrem Glas. Ellen atmete tief ein. Die Erinnerung an diesen Tag vor ungefähr sechs Wochen war schmerzhaft.
„Ich hab’s beim Duschen gemerkt. So eine Beule unter der Achsel, die ich beim Abtrocknen spürte. Ich habe erst so ein bisschen daran herumgedrückt und dann meine Brust abgetastet. Da bemerkte ich einen weiteren Knoten. Erst dachte ich, ich bilde mir das ein, dann habe ich alles auf den Stress in der Arbeit geschoben. Geschwollene Lymphknoten hat schließlich jeder mal. Ich dachte einfach, dass ich da wohl eine Grippe ausbrütete.“
„Sind Sie nicht gleich zum Arzt gegangen?“ fragte Frau Althoff.
„Das war ja das Problem“, sagte Ellen bitter. Ich habe es erst einmal verdrängt und noch ganze vier Wochen gewartet, bis ich endlich zu meiner Frauenärztin gegangen bin.“
„Aha, das hätte ich nicht von Ihnen gedacht“, meinte Josephine und legte ihre Karten auf den Tisch.
„Wie meinen Sie?“ wollte Ellen wissen.
„Ich kenne Sie zwar erst seit ein paar Stunden, aber Sie scheinen mir eher der Mensch, der sofort einen Arzt aufsucht, wenn er merkt dass etwas nicht stimmt. So kann man sich täuschen.“
„So ganz falsch schätzen Sie mich da nicht ein“, gab Ellen zu. „Ich wäre normalerweise wirklich sofort zum Arzt gegangen. Man liest ja auch immer wieder, dass man das ab einem gewissen Alter vorsorglich regelmäßig tun sollte. Aber in der Arbeit war gerade einfach zu viel los. Da konnte ich doch nicht….“ Sie hielt inne und dachte daran, ob es wohl einen Unterschied gemacht hätte, wenn sie sechs Wochen früher hierher gekommen wäre.
Читать дальше