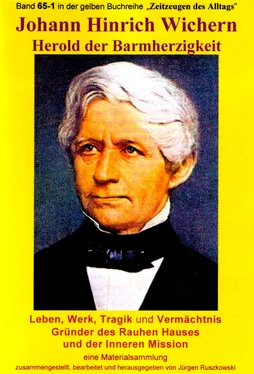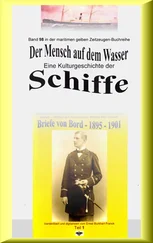Jürgen Ruszkowski - Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit
Здесь есть возможность читать онлайн «Jürgen Ruszkowski - Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1833 25. Februar: Wicherns Rede im Schneideramtshaus.
1833 27. April: Syndikus Dr. Sieveking bietet Wichern das alte Rauhe Haus in Horn mit 6 Morgen Land an.
1833 19. Juni: Erste Sitzung des Verwaltungsrats. Syndikus Dr. Sieveking wird zu dessen Präses erwählt.
1833 12. September: Versammlung in der Börsenhalle mit Gründung des Rauhen Hauses in Horn.
1833 1. November: Einzug Wichern und seiner Mutter in das Rauhe Haus.
1833 8. November: Aufnahme der ersten drei Knaben.
1834 April: Wichern werden zwei Gehilfen zur Seite gestellt.
1834 20 Juli: Einweihung des Schweizerhauses. Das alte Rauhe Haus wird Mädchenhaus (bis 1842).
1835: Bau des ersten Oekonomiegebäudes.
1835 29. Oktober: Wicherns Hochzeitstag. Einweihung des Mutterhauses „Grüne Tanne“.
1836 11. August: Grundsteinlegung zum ersten „Goldenen Boden“ – Besuch des späteren Fürst von Bismarck im Rauhen Hause.
1836 1. August: Das Rauhe Haus besetzt außerhalb das erste Rettungshaus durch Bruder Baumgartner.
1838: Einrichtung einer dritten Knabenfamilie im „Goldenen Boden“.
1838 6. November: Besuch des Prinzen Christian (später König Christian VIII) und der Prinzessin Caroline Amalie von Dänemark im Rauhen Haus.
1839 1. April: Das Rauhe Haus entsendet den ersten Lehrer, Bruder Feldhusen.
1839 14. Juli: Grundsteinlegung zum Betsaal im Rauhe Haus.
1839 7. Oktober: Einweihung des Betsaals.
1840 19. Juni: Das Rauhe Haus entsendet Bruder Schladermund als ersten Kolonistenprediger nach Amerika.
1841 19. August: Elisabeth Frey im Rauhen Hause.
1841 3. Oktober: Einweihung des ersten Hauses „Bienenkorb“.
1841 20. Dezember: Der Verwaltungsrat erwirbt die Schlottaukoppel.
1842 11. Februar: Gründung der Druckerei und Buchbinderei.
1842 5. Mai: Der Hamburger Brand. Das Rauhe Haus nimmt obdachlose Familie auf.
1844 16. März: Bildung eines Kuratoriums für die Brüderanstalt unter Vorsitz Syndikus Dr. Sievekings.
1844 September: Begründung der „Fliegender Blätter“.
1848 März: Wichern geht mit 10 Brüdern nach Oberschlesien zur Linderung der infolge des Hungertyphus entstandenen Waisennot.
1848 21. September: Erster deutscher evangelischer Kirchentag in der Schlosskirche zu Wittenberg.
1848 22. September: Wicherns Rede auf dem Kirchentag über „Innere Mission als Aufgabe der Kirche.“
1848 23. September: Vorschlag zur Gründung des Centralauschusses.
1849 21. April: Wichern gibt seine Denkschrift über die Innere Mission heraus.
1849 13. – 15. September: Kongress der Inneren Mission in Wittenberg. Wichern über: I. Wie ist die Innere Mission als Gemeindesache zu behandeln?“ II. Welches ist die Aufgabe der Inneren Mission für die wandernde Bevölkerung?“
1850 1. Januar: cand. Theodor Rhiem wird Inspektor des Rauhen Hauses und vertritt Wichern während seiner vielen Reisen.
1850 12. – 14. September: 2. Kongress der Inneren Mission in Stuttgart. Wichern über das Thema: „Wie sind die nötigen Arbeiter für den Dienst der Inneren Mission zu gewinnen?“
1851 3. Juni: Wichern erhält den Doktor theol. von der theologischen Fakultät der Universität Halle.
1851 18. – 19. September: 3. Kongress der Inneren Mission in Elberfeld. Wichern über das Thema: „Die Inneren Mission in ihrer nationalen Bedeutung für Deutschland im Hinblick auf die Reformation.“
1852 16. – 17. September: 4. Kongress der Inneren Mission in Bremen. Wichern über das Thema: „Die Behandlung der Verbrecher in den Gefängnissen und der entlassenen Sträflinge.“
1852 Oktober-November: Wicherns Revisionsreise durch Westpreußen, Ostpreußen und Pommern.
1853 Juni: Wicherns Revisionsreise durch Brandenburg, Schlesien und Sachsen
1853 22. – 23. September: 5. Kongress der Inneren Mission in Berlin. Wichern über das Thema: „Die evangelischen Deutschen in der europäischen Diaspora.“
1854 21.Mai: Eröffnung der ersten Herberge zur Heimat in Bonn; Bruder Heinrich Groth wird Hausvater.
1854 25. – 26. September: 6. Kongress der Inneren Mission in Frankfurt/M. Wichern über das Thema: „Bericht des Centralausschusses für die Innere Mission über deren Tätigkeit, deren Umfang und Prinzipien.“
1856 5. Juli: Der Brüderschaft des Rauhen Hauses wird der Aufseherdienst im Moabiter Gefängnis in Berlin übertragen.
1856 11. – 12. September: 7. Kongress der Inneren Mission in Lübeck. Wichern über das Thema: „Der Dienst der Frauen in der evangelischen Kirche.“
1856 31. Oktober: Entsendung von 19 Brüdern nach Moabit.
1857 14. Januar: Ernennung D. Wicherns zum Oberkonsistorialrat und Vortragenden Rat für die Strafanstalten und das Armenwesen im Ministerium des Innern.
1857 24. – 25. September: 8. Kongress der Inneren Mission in Stuttgart. Wichern über das Thema: „Die Inneren Mission als Aufgabe der Kirche innerhalb der Christenheit.“
1858 25. April: Rede D. Wicherns zur Gründung des Johannesstiftes in Berlin.
1858 18. – 19. September: Erster Brüdertag im Rauhen Hause.
1860 13. – 14. September: 10. Kongress der Inneren Mission in Barmen.
1862 25. – 26. September: 11. Kongress der Inneren Mission in Brandenburg/Havel Wichern über das Thema: „Die Verpflichtung der Kirche zum Kampf gegen die heutigen Widersacher des Glaubens in ihrer Bedeutung für die Selbsterbauung der Gemeinde.“
1863 4. – 8. Oktober: Zweiter Brüdertag im Rauhen Hause.
1864 20. Februar: Begründung der Felddiakonie. D. Wichern zieht mit 12 Brüdern auf den Kriegsschauplatz.
1867: Das Dorf Horn hat 1.700 Einwohner.
Das Dorf Hamm hat 3.400 Einwohner.
1867 5. – 6. September: 13. Kongress der Inneren Mission in Kiel. Wichern über das Thema: „Der Beruf der Nichtgeistlichen für die Arbeit im Reiche Gottes und den Bau der Gemeinde.“
1869 10. – 12. August: Dritter Brüdertag im Rauhen Hause.
1869 2. – 3. September: 14. Kongress der Inneren Mission in Stuttgart. Wichern über das Thema: „Die Aufgabe der evangelischen Kirche, die ihr entfremdenden Angehörigen wiederzugewinnen.“
1871 6. Juni: Th. Rhiem feiert sein 25jähriges Jubiläum.
1871 Anfang Juni: erster Schlaganfall Wicherns.
1871 22. Juli: Wichern wünscht nach seiner schweren Erkrankung vom Sohn Johannes eine Erklärung, ob er willig sei, einst sein Nachfolger in der Leitung des Rauhen Hauses zu werden.
1871 12. Oktober: Wichern auf der Oktober-Versammlung der Inneren Mission: „Die Mitarbeit der evangelischen Kirche an den sozialen Aufgaben der Gegenwart.“
1872 15. Mai: Rückkehr D. Wicherns in das Rauhe Haus und Wiederübernahme der Leitung der Anstalt.
1873 1. April: Eintritt seines Sohnes Johannes Wichern als „stellvertretender Vorsteher“ des Rauhen Hauses.
1876 18. – 21. Juli: Erste Konferenz der Vorsteher der deutschen evangelischen Brüderhäuser im Rauhen Hause.
1881 7. April: Wicherns Todestag.

Urgrund der Diakonie
„Denn wo Glaube ist, da wird aus ihm die Liebe geboren,
wie der Strahl der Sonne, wie die Wärme aus dem Feuer“
Rudolf Willborn schrieb 1981 in ‚Der weite Raum’:
Wer aus der Hamburger Innenstadt mit der Untergrundbahn nach Osten fährt, kommt zu einer Station mit dem Namen „Rauhes Haus“. Der diakonisch Kundige rekapituliert bei diesem Namen: „Brunnenstube der Inneren Mission“, „Rettungshaus für verwahrloste Kinder“, 1833, Wichern. Bei aller gebotenen Zurückhaltung könnte man nicht nur das Strohdachhaus in Hamburg-Horn, sondern die gesamte Heimatstadt Wicherns als Brunnenstube, Quellgrund oder eben ‚Untergrund’ der modernen Diakonie vorstellen. Hanseatisches Selbstbewusstsein und kommerzielle Nüchternheit, weltoffener Unternehmergeist und Sinn für das Machbare verbanden sich in dieser exklusiven Stadtrepublik mit der norddeutschen Variante der Erweckungsfrömmigkeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem beachtlichen Aufbruch christlicher Initiative auf sozialem Gebiet. Er ist gekennzeichnet durch die Namen Johann W. Rautenberg, Amalie Sieveking, Elise Averdieck, Hinrich M. Sengelmann und – J. H. Wichern, den „Vater der Inneren Mission“. Sie alle waren in Denken und Tun unverkennbar bestimmt von dem, was Bischof Wölber als die eigene hamburgische Spielart der Spiritualität beschrieben hat: „Die noblen Hanseaten haben den Geist des Christentums aus anderen Wurzeln als denen der religiösen Erwärmung entfacht. Es war der Hamburger Bürger Johann Hinrich Wichern, ewiger Kandidat der Theologie, der 1848 durch eine zündende Stegreifrede auf dem Wittenberger Kirchentag mit einem Schlage dem christlichen Sozial- und Liebesdienst in moderner Weise zum Durchbruch verhalf. Seine Parole lautet: ‚Die Liebe gehört mir wie der Glaube.’ Dies begriff der Hamburger Bürgersinn.“ Aber Naumanns Charakterisierung erinnert nicht nur an hanseatischen Gemeinsinn, Stiftungen, Legate und Mäzenatentum, sondern auch an jenen ‚Untergrund’, den der junge Wichern meinte, als er in seinen Aufzeichnungen über „Hamburgs wahres und geheimes Volksleben“ seine Beobachtungen von der schreienden Armut in den Arbeiterwohnvierteln der Hansestadt, z. B. dem sogenannten „Gängeviertel“ und der Matrosenvorstadt St. Pauli festhielt. Der Hinweis auf den weltstädtischen Bürgersinn der Hansestädter beleuchtet nur die eine Hälfte des Untergrundes, aus dem das Wirken dieser Pioniere der Diakonie hervorging. Die andere Hälfte der Wahrheit war das Elend der von der bürgerlichen Gesellschaft im Stich gelassenen Proletarier und der verwahrlosten Proletarierkinder in den schnell wachsenden Arbeitervorstädten. Als Oberlehrer der von Kirche und Staat gleichermaßen beargwöhnten und sogar polizeilich kontrollierten Rautenberg’schen Sonntagsschule gewann der 25jährige Wichern aus erster Hand Einblick in die Abgründe einer Elendswelt, wie sie außer in dem großen Seehafen Hamburg in Deutschland so wohl kaum zu finden war – damals ein Mikrokosmos der industriellen Zukunft Deutschlands. Viele Hamburger Bürger erfuhren erst durch die Reden Wicherns vor Hunderten von eingeladenen Zuhörern im großen Tanzsaal des Schneideramtshauses am 25. Februar 1833 und während der Gründungsversammlung des Rauhen Hauses in der Hamburger Börsenhalle am 12. September 1833 etwas von dieser unheimlichen Nachtseite ihrer stolzen und reichen Stadt. Was Wichern gesehen hatte, war die schmutzige Realität dessen, was in den Geschichtslehrbüchern „die soziale Frage“ des 19. Jahrhunderts genannt wird. Es waren Bilder, wie sie uns heute als unbewältigte Gegenwart in Berichten aus Asien, Afrika und Südamerika entgegentreten. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Hunger, Krankheit und frühe Invalidität, Alkoholismus. Prostitution Minderjähriger, Verwahrlosung und sittliche Verrohung, Auflösung von Ehe und Familie waren die äußeren Kennzeichen der hoffnungslosen, völlig ungesicherten Existenz ständig wachsender Massen von Tagelöhnern, Handwerken und Arbeitern. Wichern wusste aus eigener Kindheitserfahrung, dass mit dem sozialen Elend das seelische Elend einherging. Erst Bewusstsein des Ausgestoßenseins aus der bürgerlichen Gesellschaft macht den Armen zum Proletarier. Wichern war sich auch bewusst, dass die soziale und seelische Not ein Massenproblem war, dem sich die Kirche mit neuen Arbeitsmethoden zu stellen hatte. Den katastrophalen Folgen der industriellen Revolution in den Städten und der Strukturveränderung auf dem Lande war mit individueller karitativer Einzelfallhilfe allein nicht beizukommen. Zur helfenden, erbarmenden, rettenden Liebe musste die gestaltende, vorsorgende Liebe hinzukommen. Das Rauhe Haus als Rettungsanstalt der heimatlosen Kinder und als erste Ausbildungsstätte für Diakone war nur ein kleiner Teil dessen, was die geistliche und leibliche Not des Volkes erforderte. Trotzdem wurde das Rauhe Haus das „einflussreichste soziale Unternehmen im protestantischen Deutschland“ und ein bleibendes Symbol für die Weltverantwortung des christlichen Glaubens.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.