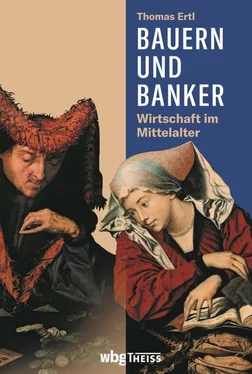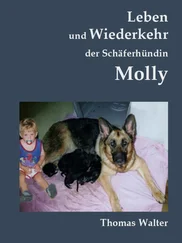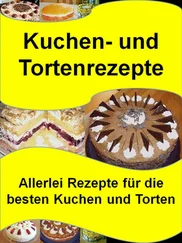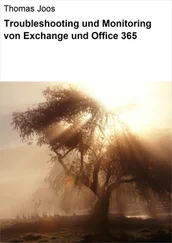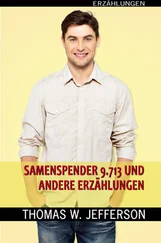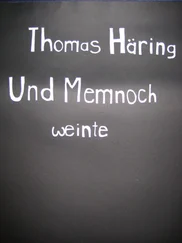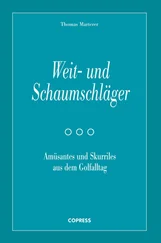Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts haben der Beschäftigung mit der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters neuen Auftrieb verliehen. Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler überprüfen die alten Antworten auf klassische Fragen oder bereichern das Fach mit neuen Fragestellungen. Die großen Themen unserer Zeit, wie zunehmende Ungleichheit, wachsende Migration und ein beschleunigter Klimawandel, haben bei dieser Neuausrichtung deutliche Spuren hinterlassen. Zudem hat die Wirtschaftsgeschichte Anregungen der Kulturgeschichte aufgegriffen und bettet die ökonomischen Verhältnisse stärker als früher in die Lebenswelt der Menschen ein. Die Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters hat sich auf diese Weise inhaltlich und methodisch diversifiziert. Interkulturelle Vergleiche, die Auswirkungen von Migration, das Verhältnis von Normen zur täglichen Praxis sowie klimahistorische Studien gehören heute ebenso zu ihren Themen wie das regional divergierende Wirtschaftswachstum mit seinen Schattenseiten von Umweltzerstörung und Verarmung. Die Abholzung der europäischen Mischwälder begann im Mittelalter, und auch einer der ersten Ökozide ereignete sich am Ende dieser Epoche, als die Spanier die indigene Bevölkerung und Vegetation der Kanarischen Inseln ausrotteten, um die Inseln in eine koloniale Plantagenwirtschaft zu verwandeln. Die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte ist damit eine Disziplin mit großer Gegenwartsrelevanz. Ihr Studium kann die offenen Fragen des 21. Jahrhunderts nicht beantworten, doch es kann die Breite und Tiefe unseres Nachdenkens über sozioökonomische Verhältnisse (und wie sie sein sollten) erweitern.

Geschätztes globales Bruttoinlandsprodukt vom Jahr 1 bis 2008. Aus der Perspektive des Wirtschaftswachstums bildet die Vormoderne eine einheitliche Epoche, die mit der Industriellen Revolution zu Ende ging. Die Konzentration auf das Wirtschaftswachstum allein verdeckt jedoch die wirtschaftliche Entwicklung vor 1800 und die strukturelle und institutionelle Vorgeschichte der Industriellen Revolution. Deren Ursprünge sind seit vielen Jahren ein kontrovers diskutiertes Thema.
Wie sich die mittelalterliche Wirtschaftsgeschichte in den letzten knapp einhundert Jahren gewandelt hat, soll ein Vergleich zwischen dem 1933 erschienenen Klassiker von Henri Pirenne zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter und der vorliegenden Arbeit veranschaulichen. In der folgenden Tabelle werden Thesen und Schwerpunktsetzungen der beiden Studien gegenübergestellt. Dabei zeigen sich sowohl Kontinuitäten als auch Unterschiede. Dieser Befund ändert nichts daran, dass Henri Pirenne 1933 ein Meisterwerk geschrieben hat, das heute noch lesenswert ist.
Die Wandlung der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte in den letzten einhundert Jahren
| Thesen und Themen |
Pirenne 1933 |
Ertl 2021 |
| frühes Mittelalter |
autarke Grundherrschaften ohne Handel, starker Bruch mit der Antike |
Grundherrschaften mit Marktanbindung, Adaption spätrömischer Traditionen |
| Handel im Mittelmeer nach der islamischen Expansion im 7./8. Jh. |
die abendländische Schifffahrt ist »ganz und gar tot« |
Handel geht reduziert weiter und nimmt bald wieder Fahrt auf. |
| Europa |
Blick nur auf Westeuropa, Betonung der Kerngebiete |
interkulturelle und globale Aspekte, Betonung der Divergenzen |
| Schwerpunktsetzung |
Konzentration auf Fernhandel und Luxusgüter |
Versuch einer Balance der Wirtschaftssektoren |
| Innovationskraft der Wirtschaft |
kapitalistischer Fernkaufmann |
Innovationspotenzial und Kommerzialisierung in allen Sektoren |
| Zünfte |
wettbewerbs- und innovationsfeindlich, protektionistisch |
gleichermaßen hemmend und fördernd für wirtschaftliche Innovationen |
| Institutionen als Rahmenbedingungen |
keine explizite Rolle |
eine Erklärungshilfe |
| Spätmittelalter |
soziale Unruhen, Kapitalismus und Merkantilismus |
unterschiedliche Erklärungen für die wirtschaftliche Neuordnung, Demografie und Klima wichtig |
| Erkenntnisinteresse |
der bürgerliche Kaufmann als wagemutiger Unternehmer |
die Folgen für den Menschen (Lebensstandard, Konsum, Ungleichheit, Klimawandel) |
| Narrativ |
kohärente Aufstiegserzählung |
Wirtschaftsgeschichte als Teil einer Gesellschaftsgeschichte sowie als Forschungsgeschichte |
Henri Pirennes Buch ist ein Klassiker der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich einige Interpretationen verändert, neue Themen sind hinzugekommen und die kulturgeschichtliche Einbettung der Wirtschaft hat sich verstärkt. Obwohl der Umfang der Spezialforschung und der edierten Quellen massiv zugenommen hat, ist unser heutiges Gesamtbild der mittelalterlichen Wirtschaft weiterhin von Arbeiten wie jener von Pirenne geprägt.
Der Blick zurück dient unter anderem der Deutung und Bewertung von Gegenwart und Zukunft. Die interessengeleitete Verflechtung des Mittelalters mit der Gegenwart zeigt sich unter anderem in der Vielfalt der vorhandenen Mittelalterbilder. Dies gilt auch für die Wirtschaftsgeschichte als Teil der historischen Wissenschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung des Mittelalters spielte im ökonomischen Denken des 20. Jahrhunderts häufig eine ambivalente Rolle, eingebettet in einen allgemein verbreiteten Beurteilungskatalog der Epoche. Dabei werden in der Regel zwei Bewertungskriterien miteinander kombiniert, was zu vier vorherrschenden Deutungen des Mittelalters im Vergleich zur Moderne führt:
| Verhältnis |
Zitierte Autoren |
| ähnlich und positiv |
Friedrich August von Hayek |
| ähnlich und negativ |
Frühneuzeitforschung, Bas van Bavel |
| anders und positiv |
Jacques Le Goff, Karl Polanyi, Thomas Piketty |
| anders und negativ |
Werner Sombart |
Beurteilungsmatrix des Mittelalters in der Moderne. Die Tabelle zeigt die vorherrschenden Sichtweisen auf das Mittelalter und ordnet sie einigen Autoren zu, die auf den nächsten Seiten zitiert werden. Es handelt sich um eine subjektive Auswahl.
Bei der negativen Interpretation der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters dominiert das Bild von Rückständigkeit und Stagnation. Ähnlichkeit oder Andersartigkeit spielen dabei meist eine untergeordnete Rolle und hängen hauptsächlich vom veranschlagten Grad der Rückständigkeit ab. Eine besondere Betonung der Rückständigkeit erzeugt meist das Bild der mittelalterlichen Andersartigkeit, wie Werner Sombart es in seinen Studien zur Entstehung des Kapitalismus gezeichnet hat. Der frühneuzeitlichen Wirtschaftsgeschichte, die sich mit dem Aufstieg des Fiscal-military State (womit ursprünglich Großbritannien gemeint war: Dessen erfolgreiches Finanzsystem gestattete es, besser ausgerüstet und länger Krieg zu führen als die konkurrierenden Kontinentalmächte.) und der Great Divergence (d. h. der ökonomischen Ungleichheit: Sie ermöglichte es Europa, sich wirtschaftlich schneller und nachhaltiger zu entwickeln als andere Teile der Welt.) beschäftigt, dient das europäische Mittelalter häufig als negative Folie und als Epoche, in der die modernen Entwicklungen möglicherweise ihre Wurzeln, allerdings noch keine festen Konturen angenommen haben. Häufig stehen solche Interpretationen im Zusammenhang mit malthusianischen Ansätzen und gehen davon aus, dass die vormoderne Bevölkerung stets schneller wuchs als die wirtschaftliche Entwicklung.
Читать дальше