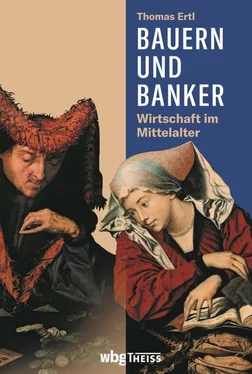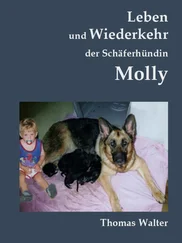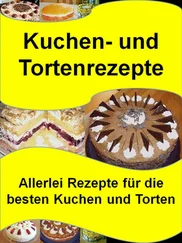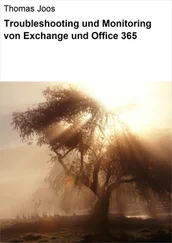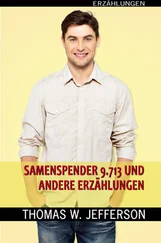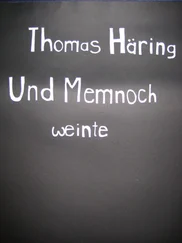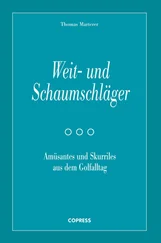In Wirklichkeit agierte der Homo oeconomicus (»Wirtschaftsmensch«) im Mittelalter zwar innerhalb anderer Rahmenbedingungen, verhielt sich dabei jedoch nicht gänzlich anders als der Homo oeconomicus der Gegenwart. Niemals handelten oder handeln Menschen freilich allein nach ökonomischen Kriterien. Vielmehr waren es immer auch kulturelle und moralische Vorstellungen, die ihr Handeln bestimmten. Selbst die Bauernaufstände und die Zunftrebellionen des Mittelalters lassen sich nicht nur ökonomisch erklären. Die meisten Aufständischen strebten nicht einfach nach materieller Besserstellung, sondern nach Verhältnissen, in denen sie die ihnen (in ihren Augen) angemessene und gerechte Wertschätzung und Entlohnung erhielten. Um die enge Wechselwirkung zwischen Moral und Wirtschaft zu ergründen, wurde das Konzept der »moralischen Ökonomie« (moral economy) in die Diskussion eingeführt. Damit soll unterstrichen werden, dass auch Gewohnheiten und Sitten das wirtschaftliche Verhalten prägen und Profit keineswegs die einzige Handlungsmaxime darstellt. Für die Betrachtung der Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters ist diese Perspektive zweifellos hilfreich, da die ressourcenarme mittelalterliche Wirtschaft von vielen formalen und informellen Geboten gelenkt wurde.
Kritik an institutionellen oder politischen Beschränkungen des Handels wurde bereits im Mittelalter geübt. Die Venezianer machten sich beispielsweise in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts für die »Freiheit des Meeres« (libertas maris) stark. Was sie damit meinten, war indes nicht eine gleichberechtigte Teilnahme aller Interessierten am Mittelmeerhandel, sondern eine Gleichstellung mit der Handelsrivalin Genua, nachdem Genua sich eine Vorrangstellung im Schwarzmeerhandel gesichert hatte. Die Venezianer hatten damit ein Prinzip formuliert, das Hugo Grotius 1609 in seiner Schrift Mare Liberum (»Das freie Meer«) ausführlich beschrieb. Bemerkenswerterweise wurde das Prinzip des Freihandels bei Grotius und in späterer Zeit immer von jener Seite eingefordert, die sich Vorteile davon versprach.
Eine Beschwerde der Leipziger Universität 1470 gegen das Verbot des freien Fleischhandels belegt ebenfalls die mittelalterliche Kritik an institutionellen Zwängen. Die Universität beklagte sich darüber, dass stadtfremde Fleischer ihre Ware nicht mehr in die Stadt bringen durften und dass die städtischen Fleischer nun alleine den Markt versorgten und dieses Monopol dazu benutzten, um minderes Fleisch zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Es wäre wohl besser – so die Universität – wenn die ganze Stadt von einem Freimarkt profitieren würde, als dass einige privilegierte Handwerker sich zum Schaden der großen Mehrheit übermäßig bereicherten. Im Codex diplomaticus Saxoniae (II/11, Nr. 152 [1470]) findet sich die Beschwerde der Universität über das Verbot des freien Fleischhandels in Leipzig:
»Der Freimarkt bringt keinen Schaden und das ist unzweifelhaft, denn je mehr auf den Markt gebracht wird, desto preisgünstiger ist es, und die fremden Fleischer legen ihr Geld wieder bei der Stadt an. Wenn auch die städtischen Fleischer klagen, dass sie ihres Nutzens beraubt wurden durch die freien Märkte, meint hingegen die Universität, dass diese städtischen Fleischer sich bisher nicht geärgert hätten, selbst nicht wegen der Zahl (der Märkte), und es ist besser, Sechstausend werden wohl versorgt, als dass sechs, acht oder zehn, die nun das Handwerk mit Bewilligung des Rats ausüben, sich stark bereicherten bei gleichzeitigem Nachteil aller anderen.«
Noch prinzipieller hatte der Autor der bereits erwähnten Reformatio Sigismundi geurteilt: Die Zünfte sollten aufgehoben werden, da sie mit ihren Preisabsprachen und Klüngeleien nur die eigenen Interessen zum Schaden der Allgemeinheit vertreten würden.
Kritische Stimmen dieser Art belegen ein Unbehagen mit der institutionellen und politischen Regulierung der Wirtschaft. Noch deutlicher wird das Streben nach wirtschaftlichem Gewinn in moralisch-theologischen Texten oder in Urkunden thematisiert, die Regelüberschreitungen dokumentieren. Für viele kirchliche Autoren stand ohnehin fest, dass sich Kaufleute immer nur selbst auf betrügerische Weise bereichern wollten. Bereits Gregor von Tours (538–594) berichtet in seinen Historien von einem Weinhändler, der Wein mit Wasser mischte, ihn verkaufte und dies so oft wiederholte, bis er eine große Summe erworben hatte. Auf ähnliche Weise beschuldigte der Franziskanerprediger Berthold von Regensburg 650 Jahre später die Wirte seiner Zeit, den von ihnen ausgeschenkten Wein mit Wasser bzw. guten Wein mit »faulen Wein« (fulen win) zu mischen und damit für den eigenen Profit die Gesundheit der Kunden aufs Spiel zu setzen.
Die kirchliche Kritik am Kaufmann und seinem wucherischen Treiben nahm seit dem hohen Mittelalter zu und begleitete damit die Entfaltung der »kommerziellen Revolution«. Zweifellos war das Urteil der Kleriker kein Abbild der Wirklichkeit. Dass jedoch in der Realität die Marktakteure nach persönlichem Gewinn strebten und dabei die etablierten Spielregeln verletzten, vermitteln unzählige urkundliche Texte, in denen Verstöße gegen Moralvorstellungen oder Rechtsordnung beschrieben werden. Die beklagten Tatbestände waren dabei so bunt wie das Wirtschaftsleben selbst: Qualität oder Quantität der Waren entsprachen nicht den Angaben, Liefertermine wurden nicht eingehalten, Waren wurden gehortet und später zu überhöhten Preisen verkauft, Schulden wurden nicht beglichen. Die literarischen Erzählungen des Mittelalters liefern ebenfalls moralisierende Geschichten über wucherische Geizhälse und entlarvte Betrüger.
Im Mittelalter existierte beides nebeneinander: eine vielschichtige politische Regulierung wirtschaftlicher Aktivitäten und ein individuelles Gewinnstreben. Das sich zeitlich und regional beständig wandelnde Mischungsverhältnis von autoritativen Eingriffen und privater oder genossenschaftlicher Initiative verleiht dem Mittelalter sein spezifisches wirtschaftsgeschichtliches Profil und machte es zugleich zur Grundlage der weiteren Entwicklung. Feudalistische und kapitalistische Elemente waren in diesem System ineinander verwoben, falls man diese Begriffe überhaupt verwenden möchte. Möglicherweise war das unterschiedliche Mischungsverhältnis von Steuerung und Laissez-faire eine Ursache für das ungleiche Wirtschaftswachstum in Europas Regionen. Allerdings gibt in der Forschung widersprüchliche Meinungen zu der Frage, ob eine intensive Regulierung der Wirtschaft durch starke Institutionen wachstumsfördernd oder -hemmend gewesen sei. Derzeit überwiegt die Meinung, dass das Wirtschaftswachstum in Nordwesteuropa im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit zumindest teilweise auf schwache Institutionen und viel Freiraum für Unternehmer zurückzuführen sei. Die wirtschaftlichen Divergenzen innerhalb des Mittelalters sind nicht nur wegen der Sonderentwicklung im Nordwesten enorm und machen es nötig, die vielen regionalen Entwicklungspfade nicht aus den Augen zu verlieren.
Zahlreiche im Mittelalter entstandene Phänomene und Strukturen überdauerten die Epochengrenze. Weder Arbeitstechniken noch Lebensstandards oder soziale Schichtungen änderten sich grundsätzlich zwischen 1000 und 1800. Aus globaler Perspektive war das Wirtschaftswachstum aller Gesellschaften dieser Erde über viele Jahrtausende schwach ausgeprägt, bis es im 19. Jahrhundert plötzlich und dramatisch anzusteigen begann. Bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg blieben auch die Steuereinnahmen der europäischen Staaten im Vergleich zum 20. Jahrhundert gering und erreichten nie mehr als zehn Prozent des nationalen Einkommens. Dies war eine höhere Steuerquote als im Mittelalter, aber dennoch konnten die Regierungen damit nicht viel mehr als Militär und Administration finanzieren. Die Einführung progressiver Steuern, die Anhebung der Staatsquote auf 30 bis 50 Prozent und der Aufbau des Sozialstaates erfolgten allesamt erst im Laufe des 20. Jahrhunderts. Aus wirtschaftsgeschichtlicher Perspektive ist es deshalb wichtig, die Kontinuitäten zwischen Mittelalter und Frühneuzeit, die erst in der Industriellen Revolution zu Ende gingen, nicht zu vergessen. Bis dahin bildete die Landwirtschaft – übrigens in allen Ländern der Erde – den zentralen Wirtschaftssektor, in dem die meisten Menschen tätig waren.
Читать дальше