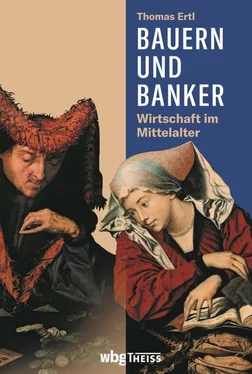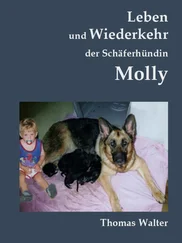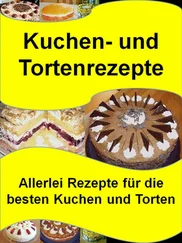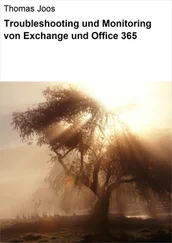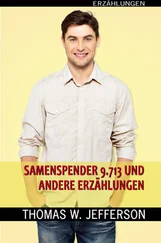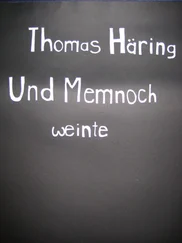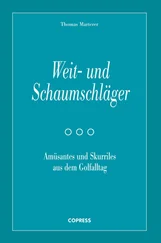Im Gegensatz dazu gilt die starke Regulierung der Wirtschaft durch die Obrigkeit als ein wesentliches Merkmal des mittelalterlichen Feudalismus. Im Rahmen von Lehenswesen und Grundherrschaft sei die mittelalterliche Wirtschaft von politisch-militärischen Autoritäten (Fürsten und Grundherren) gelenkt geworden, was wiederum eine wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft verhindert habe. Nicht Angebot und Nachfrage, sondern Autorität und Abhängigkeit hätten den Austausch von Waren und Dienstleistungen im Mittelalter bestimmt. Prägendes Merkmal der feudalen Wirtschaftsform sei insbesondere die Ausbeutung der Bauern durch die Grundherren gewesen. Auch dieses Bild ist ein abstraktes Modell, das der Realität nicht gerecht wird, denn die mittelalterliche Wirtschaft war stets geprägt von einem Spannungsverhältnis zwischen obrigkeitlicher Regulierung und individuellen Freiheiten bzw. zwischen Ausbeutung und Ausgleich. Viele Bauern konnten tatsächlich nicht völlig frei über ihr Leben entscheiden, doch die Grundherren konnten ebenso wenig neue Abgaben und Frondienste einfach nach Gutdünken einführen.
Dieses Spannungsverhältnis wurde bereits von den Zeitgenossen wahrgenommen. Allerdings betrachteten sie die Wirtschaft häufig als ein Mittel zur Steigerung des Gemeinwohls (bonum commune). In dieser Sichtweise spielte privates Gewinnstreben keine Rolle und alle materiellen Güter sollten auf angemessene Weise unter den Mitgliedern der Gemeinschaft verteilt werden. Der anonyme Autor der Reformatio Sigismundi formulierte dieses Prinzip im Jahr 1439 auf folgende Weise:
»Das Handwerk wurde dazu erdacht, dass jedermann sein tägliches Brot damit gewinnen kann. Wenn niemand den anderen bei seinem Handwerk stört, dann leidet die Welt keine Notdurft und jeder findet sein Auskommen.«
Aussagen wie diese prägen die moderne Vorstellung einer mittelalterlichen Wirtschaft, die sich nicht dem Gewinnstreben, sondern dem sogenannten »Nahrungsprinzip« verpflichtet fühlte. Der Wirtschaftshistoriker Werner Sombart erklärte dieses Prinzip 1902 zum Kern einer angeblich mittelalterlichen »Wirtschaftsgesinnung«, nach welcher sich die Menschen ein standesgemäßes Leben sichern wollten, darüber hinaus aber kein persönliches Gewinnstreben an den Tag gelegt hätten. Konsequenterweise hätten Handwerker und Kaufleute nur so viel produziert und verkauft, wie zum Auskommen der eigenen Familie nötig gewesen sei. Für die Vermehrung des Profits mittels höherem Arbeitsaufwand oder Investitionen habe man sich dagegen nicht interessiert. Jacques Le Goff sah dies 1987 ähnlich und sprach von »einer Wirtschaftsform, [...] die keine Hast, kein Streben nach Präzision, keine Sorge um Produktivität kennt«. Von einer ähnlichen selbstgenügsamen Gesinnung hatte bereits Alexis de Tocqueville (1805–1859) gesprochen: Im Ancien Régime habe die große Mehrheit der Bevölkerung fast ohne Bedürfnisse und ohne existenzielle Not gelebt, während die Gegenwart zwar viele Annehmlichkeiten, doch auch viel Armut hervorgebracht habe.
In der Tat war die mittelalterliche Wirtschaft an allen Ecken und Enden durch eine Politik protektionistischer Beschränkung limitiert. In jeder Stadt bestanden Monopole beim Handel und im Gewerbe. Die Zünfte reglementierten das städtische Gewerbe seit dem 13. Jahrhundert mit detaillierten Statuten. Mit der Hilfe von Zöllen, Mauten und Geleitrechten versuchten Landesherren und Städte, den Handel im eigenen Territorium zu steuern und finanziell abzuschöpfen. Einflussreiche Handelszentren wie Nürnberg oder Venedig sicherten sich mittels Zollfreiheiten und Handelsprivilegien einen Zugang zu Märkten, die anderen Akteuren verschlossenen blieben. Stapel- und Niederlagsrechte dienten dazu, die wirtschaftliche Stellung einer Stadt im regionalen und internationalen Handelsverkehr zu bewahren oder zu stärken. In der Regel waren es Handelsstädte, die das Stapelrecht erhielten und dadurch von ihren Landesherren gefördert wurden. Entsprechend der jeweiligen Ausgestaltung des Privilegs mussten Kaufleute ihre Waren in der betreffenden Stadt von einem Transportmittel auf ein anderes umladen, für eine bestimmte Zeit (häufig für drei Stapeltage) zum Verkauf anbieten oder aber zur Gänze an einheimische Kaufleute verkaufen. Wichtige Stapelplätze im Reiche waren Köln und Wien. Im hansischen Stapelrecht verpflichteten sich die Hansekaufleute, ihre Waren in den Niederlanden ausschließlich in Brügge zu kaufen und zu verkaufen.
Diese städtische Wirtschaftspolitik wurde von der historischen Forschung unterschiedlich bewertet. Positive Interpretationen betonen die am Gemeinwohl orientierte Wirtschaftspolitik, die als praktische Sozialpolitik jedem Bürger sein Auskommen sichern wollte. Kritische Sichtweisen betrachten die städtischen Eingriffe in die Wirtschaft eher als einen Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismus, mit dessen Hilfe die in der Stadtregierung vertretenen Eliten ihre Herrschaft durchsetzen und die eigenen ökonomischen Interessen fördern wollten.
Trotz der Betonung des Nahrungsprinzips und trotz der zahlreichen protektionistischen Maßnahmen war das Streben nach ökonomischem Gewinn im Mittelalter allgemein verbreitet – selbst unter Kirchenleuten. Der berühmte Abt Suger von Saint-Denis schrieb um 1140 eine Abhandlung über die Verwaltung seiner Kirche (De administratione) und beschäftigte sich dabei im ersten Teil mit der »Vermehrung der Einkünfte«. Sorgsam notierte der Abt darin Höhe und Art der Einkünfte seines Klosters und fügte in vielen Fällen stolz hinzu, welche Steigerung unter seiner Amtsführung gelungen war:
»Während wir einst aus dem Dorf Tremblay entweder kaum oder niemals auch nur 90 Scheffel Getreide haben konnten, haben wir die Angelegenheit dahin gebracht, dass wir jetzt 190 Scheffel von unserem dortigen Meier bekommen.«
Um diese Einnahmesteigerungen durchzusetzen, waren Suger viele Mittel recht: Er kramte im Klosterarchiv nach alten Urkunden, reiste durch die Klostergüter und machte sich ein Bild von den Verhältnissen vor Ort, forderte angeblich entfremdetes Klostergut zurück, rief den Bauern die vergessenen Verpflichtungen in Erinnerung und gründete neue Dörfer und Höfe. Ob die Bauern mit diesem Vorgehen immer einverstanden waren, darf bezweifelt werden. Doch die Darstellung Sugers liefert wohl ein verzerrtes Bild, denn willkürlichen Abgabenerhöhungen stellten sich Bauern zu allen Zeiten mit Vehemenz entgegen. Suger präsentiert sich als strahlender Held und kehrt die mühsamen Aushandlungsprozesse vor Ort einfach unter den Teppich.
Wir können annehmen, dass die eifrigen Bemühungen Sugers keinen Sonderfall darstellen. Das Streben nach mehr Einnahmen und Vermögen war unter Klerikern ebenso verbreitet wie unter weltlichen Grundherren oder Kaufleuten. Mit großer Anschaulichkeit hat der Prediger Bernardino von Siena (1380–1444) Habgier und Gewinnsucht der Kaufleute gegeißelt. Die Schlimmsten waren in seinen Augen die Reichen, die Vermögen anhäuften, ohne jemals genug zu bekommen, zugleich aber immer neue Ausreden zu ihrer Verteidigung erfanden. In einer Predigt heißt es:
»Der Reiche verteidigt seine Gier, indem er angibt, dass er zwar jetzt genug besitzt, dass er aber im Alter kein Einkommen habe und so könne er den Armen nichts geben. Zuerst, so behauptet der Reiche, müsse er an sich denken und erst dann an seine Mitmenschen. Aber sage mir, was macht der Alte, wenn er einst 100 Jahre alt sein wird und 10 000 Gulden besitzt? Die braucht er gar nicht und sein Sparen ist nichts als sündhafter Geiz.«
Texte dieser Art sind kein Zeugnis dafür, dass Habgier und Egoismus im Mittelalter besonders stark ausgeprägt waren, sie deuten jedoch darauf hin, dass die Menschen vor den Jahren um 1500 nicht weniger auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren als die Menschen in späteren Zeiten.
Das Bild einer genügsamen und wettbewerbsfernen Gesellschaft, die sich mit Bescheidenheit in die überlieferten Verhältnisse fügte, ist ein Wunschbild von Autoren, die das Mittelalter zum Gegenbild der kapitalistischen Moderne machen. Dies kann auf zweifache Weise geschehen: Werner Sombart stellte die Andersartigkeit der mittelalterlichen Welt als ein Defizit dar, weil dadurch die wirtschaftliche Entwicklung gebremst worden sei. Jacques Le Goff hingegen empfand das Fehlen von Gewinnstreben als positiv, weil die mittelalterliche Welt dadurch nicht von den Übeln der Moderne geplagt worden sei.
Читать дальше