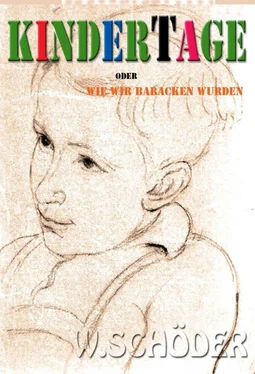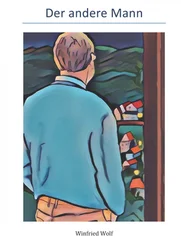Winfried Schöder - Kindertage
Здесь есть возможность читать онлайн «Winfried Schöder - Kindertage» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kindertage
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kindertage: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kindertage»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Über den Umweg in einen alten, verlassenen Bauernhof werden sie in ein Barackenlager einquartiert.
Er schildert die abenteuerlichen Erlebnisse im Lager und in der Schule.
Es endet nach sieben Jahren mit dem Auszug aus dem Lager und der Hochzeit seiner ältesten Schwester.
Kindertage — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kindertage», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Buch
Die lange Flucht aus Breslau/Schlesien endet für die
Familie des kleinen Wolfgang in der Oberpfalz.
Nach zwei Notunterkünften landet die Familie in einem
Barackenlager.
Dort verbringt sie die nächsten sieben Jahre.
Der Jüngste der Familie erzählt seine Erlebnisse und
Abenteuer aus dieser Zeit.
Autor
Winfried Schöder, geboren in Breslau/Schlesien
Winfried Schöder
Kindertage
Erinnerungen
Impressum
Kindertage
Winfried Schöder
Copyright:© 2013 Winfried Schöder
Umschlaggestaltung: Winfried.Schöder
Portrait: Georg Schöder
Published by: Epubli GmbH Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-6381-7
Ich möchte unseren Eltern danken, die uns
in dieser schweren Zeit eine schöne
Kindheit ermöglicht haben.
Ankunft
Sommer 1945
Zuerst war es nur anders als sonst. Dass wir endgültig am Ende unserer mühseligen und gefährlichen Reise ange-kommen waren, stellte sich erst nach und nach heraus.
Bis jetzt hatten wir jede Nacht in einer Scheune oder einem Stall geschlafen. Wir waren in Straßengräben, mit oder ohne Wasser, in Deckung gegangen, wenn wir Schüsse oder ein Motorengeräusch hörten. Wir hatten gehungert, gefroren und geschwitzt.
Wir, das waren meine Eltern und ich, plus fünf weitere Kinder, sieben, neun, elf, zwölf und vierzehn Jahre alt. Ich war mit fünf Jahren der Jüngste, mein Bruder der Älteste. Die anderen vier waren Mädchen. Wir waren wie Buchstützen für unsere Schwestern.
Auf der Flucht mussten unsere Eltern jeden Tag für unseren Lebensunterhalt betteln gehen, oder fechten, wie man es auch nannte. Je nach Erfolg ging es uns besser oder schlechter, oder wir waren gesund oder krank.
Ich war oft krank.
Als es mir mal besonders schlecht ging und ich über Müdigkeit und Kopfschmerzen klagte, tröstete mich Mama: „Wenn wieder Frieden ist, kaufen wir dir einen neuen Kopf.“
Jetzt mussten wir nicht mehr jeden Tag endlose Kilometer laufen, jeder mit einer Tasche oder einem kleinen, aber auf Dauer immer schwerer werdenden Rucksack auf dem Rücken, in denen unser ganzes Hab und Gut enthalten war. Immer wieder blieb ich stehen und wollte nicht mehr weiter gehen.
Mit aufmunternden Sprechgesängen, wie:
Klotz am Bein, Klavier vorm Bauch,
wie lang ist die Chaussee,
Rechts ’ne Pappel, links ‘ne Pappel,
In der Mitte ’n Pferdeappel!
wurden wir von unseren Eltern zum Weitergehen animiert und von den wunden Füßen, dem quälenden Hunger und der andauernden Müdigkeit abgelenkt.
Statt Pappel rechts und links kann man dann ein anderes Wort nehmen und so weiter. In der Mitte hat sich meis-tens etwas mehr oder weniger gereimt. Je weniger es sich reimte, desto lustiger war es. Diese Gesänge machten die endlosen Wege in glühender Hitze, auf aufgeweichtem Asphalt oder staubigen Wegen etwas erträglicher.
Mein Vater musste jetzt nicht mehr in jeden Bauernhof gehen, um nur allzu oft mit versteinerter Miene und leeren Händen wieder heraus zu kommen.
Nun waren wir in einer Kleinstadt in Bayern angelangt und betteln konnte man hier nicht mehr, denn die Leute hatten selber nicht viel. Irgendwie wurde hier schon Vie-les organisiert und wir wurden mit dem Notwendigsten versorgt. Unsere große Wanderung, unsere Flucht war nun zu Ende.
Wir waren da!
Wo waren wir?
Wir wurden zusammen mit vielen anderen Flüchtlingen in einer Gaststätte einquartiert, die keine Gäste mehr hatte.
Der Schlafbereich für unsere Familie war eine enge Nische mit drei Fenstern, in der früher überwiegend fröh-liche Menschen beim nachmittäglichen Kaffeeklatsch saßen, vergnügt plauderten oder sich verliebt in die Augen sahen.
Am ersten Abend teilte unsere Familie die Schlafplätze ein. Ich als Jüngster durfte mir mein „Bett“ selbst aussuchen. Wir schliefen von oben nach unten oder von unten nach oben, das konnte man sehen wie man wollte. Auf Fensterbrettern, die gerade breit genug waren, dass man nicht gleich wieder herunterfiel, auf den harten Holzbänken und auf dem Boden. Ich wollte auf einer Bank schlafen. Matratzen gab es keine, auch kein Stroh. Es erschien uns trotzdem sehr komfortabel, nach der wochenlangen, entbehrungsreichen Flucht von Ort zu Ort, ohne ein festes Ziel und ohne zu wissen, wo und ob man für die nächste Nacht ein Dach über dem Kopf finden würde.
Was dieses Wohlbefinden schon bald sehr trübte, waren die vielen kleinen Mitbewohner, die sich in dieser überfüllten, zweckentfremdeten Gaststätte sehr wohl fühlten. Für Wanzen, Flöhe und Läuse waren solche Zustände ein wahres Schlaraffenland.
Wer noch keine dieser Plagegeister hatte, und das waren sehr wenige, der bekam sie hier über Nacht geliefert. Die hygienischen Einrichtungen waren für höchstens dreißig Gäste gedacht, die nur ab und zu die Toiletten und Waschgelegenheiten benutzten. Es befanden sich aber wesentlich mehr Menschen, auf Dauer, Tag und Nacht, in diesem Lokal. Sie waren aus allen Teilen Ostdeutsch-lands wild zusammengewürfelt. Dazu noch diese fast unsichtbaren, lästigen Mitbewohner. Es juckte überall. Auf dem Kopf waren es die Läuse, am sonstigen Körper Flöhe und in der Nacht bissen uns die Wanzen.
Jeder kratzte sich. Sonst konnte man nichts dagegen tun.
Eines Tages erschienen einige Leute mit großen Spritzen, wahrscheinlich vom Gesundheitsamt, und besprühten je-den Einzelnen von oben bis unten mit weißem Pulver. Auch Kleidung und Decken, alles wurde damit bestäubt. Dieses Wundermittel gegen Schädlinge aller Art hieß DDT. Die meisten der ungebetenen Plagegeister wurde man auf diese Weise vorübergehend los. Diese radikale Prozedur wurde noch mehrmals wiederholt. Vielleicht sind auch Menschen davon krank geworden. Erkran-kungen oder Todesfälle bei Menschen wegen einer DDT-Vergiftung hätte man vermutlich gar nicht bemerkt. Damals starben viele Menschen an den verschiedensten Mangelerkrankungen.
Wir haben es überlebt!
Todesfälle wegen eines zu hohen Cholesterinspiegels oder wegen Übergewicht gab es jedenfalls nicht.
Genau wie Butter.
Von den Dingen, die außerhalb unserer Herberge geschehen sind und sich nicht ums Essen drehten, blieb nicht viel in meinem Gedächtnis haften.
Das herausragendste Ereignis, an das ich mich sehr gut erinnere, war die Ankunft der amerikanischen Soldaten.
Mit ihnen kam Leben in den verschlafenen Ort in der Oberpfalz.
Kolonnen von Panzern, Jeeps und Mannschaftswagen rollten durch die Hauptstraße. Die Militärfahrzeuge er-zeugten einen fast unerträglichen Lärm. Die Motoren dröhnten und die Ketten der Panzer kratzten, quietschten und knirschten über das holperige alte Kopfsteinpflaster. Die stinkenden, qualmenden Abgase vollendeten diese beeindruckende Szenerie. Es war sehr aufregend für mich, gleichzeitig wunderbar und Furcht einflößend. Die Kinder, Einheimische wie Flüchtlinge, schrieen und bettelten in ihren oberpfälzischen, schlesischen, ost-preußischen und allen sonstigen Dialekten: “giff mi Schoklett“. Diese drei Worte hatten sich als die wir-kungsvollsten herausgestellt. Besonders, wenn man sich die Zeit nahm und noch ein „Pließ“ davor oder dahinter setzte. Manche der amerikanischen Soldaten, die zu Hause wahrscheinlich selber Kinder hatten, taten ihnen dann gern den Gefallen. Auf jede Süßigkeit, Schokolade oder Kaugummi, die aus den Fahrzeugen flog, stürzten sich mindestens ein Dutzend hungrige, ausgemergelte Kinder. Wer schneller oder stärker war, hatte die besten Chancen, etwas zu schnappen.
Ich habe fast nie was erwischt.
Außer blaue Flecke!
Meine ersten Fremdsprachenkenntnisse stammen aus dieser Zeit. Bei den Kämpfen um Schokolade und Kau-gummi lernte ich von meinen bayrischen Konkurrenten die ausdruckstarken, mit schmerzhaften Stößen bekräf-tigten Worte: „Du depperter Depp, du depperter“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kindertage»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kindertage» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kindertage» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.