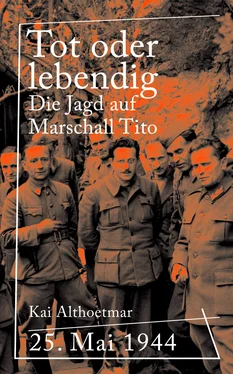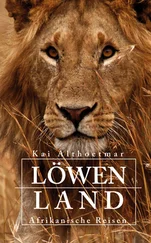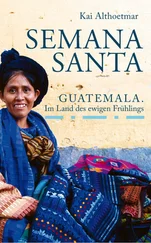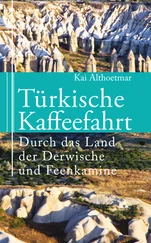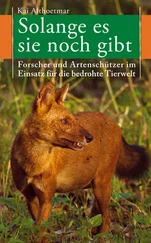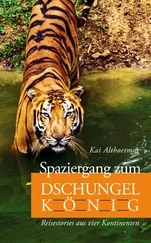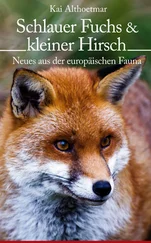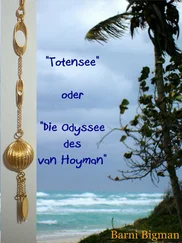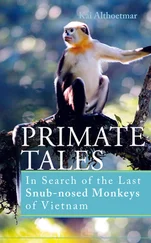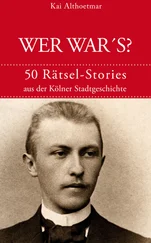In der Nacht vom 26. auf den 27. März 1941 putschten serbische Fliegeroffiziere, angestachelt von Agenten des britischen Auslandsgeheimdienstes, gegen die mehr neutrale als pro-deutsche Regierung Dragiša Cvetkoviæ in Belgrad. Dušan Simoviæ war auch deren Verständigungsbereitschaft gegenüber Kroatien ein Dorn im Auge. Schon länger intrigierte er dagegen. Als eigentlicher Motor des Putsches im serbischen Offizierskorps gilt jedoch der General Boris Mirkovic. Er war es, der am 27. März 1941 den Staatsstreich durchführte, den Prinzregenten und das Kabinett Cvetkoviæ absetzte und den minderjährigen König Peter (Petar) II. einsetzte.
8. In Drvar
In meinem Notizbuch halte ich meinen ersten Eindruck über Drvar fest: „Potthäßliche Stadt“. In der flirrenden Juli-Mittagshitze schleppen wir uns schwerbeladen zum Restaurant „Madeira“ hoch, als ginge es zum Gipfel der Vulkaninsel. Auf dem Weg verwerfe ich die Idee, unser Zelt an diesem schulfreien Samstag doch einfach hinter dem Schulgebäude aufzuschlagen. Der „Madeira“-Wirt zeigt uns die Zimmer, radebrecht gezwungen auf Englisch. Der nächste defätistische Notizbucheintrag wird lauten: „Hotel wie aus ‘Psycho’. Zimmer vermutlich zuletzt vor Krieg vermietet.“ Auch der Wirt trägt, als er nach meiner Kladde verlangt, etwas ein, eine Zahl. Wir sind uns aber schnell einig, daß 30 und nicht 40 Euro für zwei Nächte in seiner ostigen Rumpelkammer unterm Dachfirst eine Top-Offerte sind, die nur der Leidensfähigkeit meiner beiden jungen Begleiter auf dieser Balkan-Parforcetour zu verdanken ist und gewiß so schnell nicht wiederkehren wird.
Am Abend sind wir die einzigen, die in der Gaststube essen. Drei Einheimische kehren im Laufe der Stunden ein, ein jeder beläßt es bei einem Getränk. Die zahllosen Fliegen sind immer da. Am nächsten Morgen baut der Wirt auf dem Parkplatz einen ehrfurchtgebietenden elektrischen Grill auf, in dem sich ein saftiger Hammel dreht. Fett tropft, zischt und spritzt. Das kastrierte Schaf ist für die Hochzeitsgesellschaft in der Stadt ausersehen. Vom Balkon beobachten wir zwei Polizisten, die die Ausfallstraße nach Bosnisch Grahovo kontrollieren. Meist stehen sie nur im Schatten herum oder löffeln Suppe. Winken sie Autos heraus, sind es die mit „HR“-Kennzeichen. Hrvatska, der alte Erzfeind. Drvar ist - demographisch - Domäne bosnischer Serben. Zur kroatischen Grenze sind es nur zwölf Kilometer.
Drvar, 475 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, ist heute eine Kleinstadt der Föderation Bosnien und Herzegowina, der Entität der muslimischen Bosniaken und der hiesigen Kroaten. Die Grenze zur anderen Entität des Staates Bosnien-Herzegowina, der Republik Srpska, verläuft zehn Kilometer nördlich. Die meisten der etwa 7.000 Einwohner Drvars sind Serben, keine zehn Prozent sind Kroaten, gerade elf Bewohner sind Bosniaken. So war es vor dem Bosnienkrieg, so ist es heute. Nur hatte Drvar 1991 noch 17.500 Einwohner.
Nachdem im April 1992 der Krieg ausgebrochen war, kontrollierten bosnische Serben die Stadt. Im August 1995 nahmen kroatische Einheiten Drvar ein. Tausende Serben flohen oder wurden von den Kroaten vertrieben. Kroaten waren in Drvar plötzlich in der Mehrheit, das Städtchen wurde zur Geisterstadt. Die Stadt und der Kanton wurden mit dem Dayton-Abkommen November 1995 der Föderation Bosnien und Herzegowina zugeschlagen. In der Folge siedelten sich etwa 10.000 bosnische Kroaten in Drvar an. Die ethnischen Konflikte aber gingen weiter. Als im Oktober 1996 350 Serben in ihre Häuser zurückkehren wollten, vereitelten das die kroatischen Einwohner. Ein halbes Jahr später zerstörten die Kroaten in der Stadt vormals von Serben bewohnte Häuser. Die vertriebenen Serben gaben aber nicht auf. Der nächste Rückkehrversuch folgte 1998 - begleitet von Plünderungen und Gewalt. Zwei Menschen starben. Die NATO-Schutztruppe SFOR sorgte für Ruhe, viele Serben konnten nun wieder zurückkehren. Der Ort lebt wie gehabt von Land- und Forstwirtschaft - und den schmalen Renten der Alten. Arbeit haben nur wenige. Beträgt die Arbeitslosenrate in ganz Bosnien-Herzegowina 40 Prozent, sind es in Drvar 80 Prozent. Das Krankenhaus, einst überregional von Bedeutung, hat genauso dichtgemacht wie die Zellulosefabrik. Der Anschluß der Schmalspurbahn nach Prijedor, Jajce und zur kroatischen Grenze nach Kaldrma wurde in Etappen bereits bis 1978 stillgelegt.
Die Abendsonne taucht die Wolkentürme in Rosé, am Morgen dräuen die Wolken schwarz. Birkenblätter rascheln, ein Hahn kräht, auf der Stromleitung singt und pfeift eine Mehlschwalbe, hinterm Gasthaus grasen Ziegen eine Weide ab. So klein die Häuser am Stadtrand mit ihren roten Ziegeldächern sind, haben sie fast alle Obst- und Gemüsegärten. In manchen Gärten summt es aus Bienenkästen. Drvar schmiegt sich ins Tal der Unac, gesäumt von welligem Hügelland, Häuser wie von Riesen hineingewürfelt, dann die dicht bewaldeten Berge. Der kirchturmhohe Schornstein der verlassenen Zellulosefabrik und der Zehn-Meter-Turm im verwaisten Freibad bestimmen das Panorama.
In der Innenstadt fallen die vielen zerstörten oder beschädigten Gebäude auf. Verkohlte Balken, Gewehreinschüsse an den Außenwänden. Die Ulica Titova rumpeln allerhand Rostlauben aus den 1980er Jahren herunter, Jugo-Fiat, Skoda, VW Käfer, Audi 100, Ford Fiesta und Ford Escort. Auf dem Markt ist zu besichtigen, was Chinas Plastikindustrie zu fertigen imstande ist. Manche Läden haben auf, in den wenigsten sind Kunden. Wettbüros kobern um die, die sich für Fußballexperten halten. Am Eingang der Post warnt ein Aufkleber, man solle nicht mit Pistole eintreten. Von den baufälligen Balkonen starren Anwohner am Sonntagmittag auf die Straße, als wäre die Landung einer Kompanie Fallschirmjäger oder eine Tito-Parade angekündigt.
In der Ulica 25. Mai, einer Nebenstraße der Titova, haben sich Parteibüros und eines für „Mikrokrediti“ angesiedelt. Eine Straße weiter erinnert die Ulica 27. Jula in Jugo-Nostalgie an den „Tag der antifaschistischen Erhebung in den sozialistischen Republiken Kroatien und Bosnien-Herzegowina“, den ersten kommunistischen Aufstand gegen Ustascha und Achsenmächte in Groß-Kroatien 1941. Der 27. Juli war auch der Tag der österreichisch-ungarischen Kriegserklärung an Serbien 1914 nach der Ermordung von Thronfolger Franz Ferdinand und Frau Sophie. Aber der ist nicht gemeint, auch wenn alles mit allem zusammenhängt.
9. Tito - tot oder lebendig
Schon mehrmals wäre Tito den Deutschen bei ihren Offensiven und allerlei geplanten Kommandoaktionen beinahe in die Hände oder gar zum Opfer gefallen. Den Partisanen war es aber bisher immer gelungen, durch ihren eigenen Nachrichtendienst von den Plänen der Deutschen zu erfahren und sich rechtzeitig davonzumachen. Das sollte den Besatzern dieses Mal nicht wieder passieren. „Die deutsche militärische Führung im Südosten beschloß daher, anstelle großräumiger Umfassungsaktionen oder isolierter Sabotageunternehmen durch eine Kombination von Umfassungsangriff und gleichzeitig erfolgendem Fallschirmjägereinsatz den Obersten Stab auszuschalten“, schreibt der Militärhistoriker Karl-Dieter Wolff in seiner Studie „Das Unternehmen ‘Rösselsprung’“. 39Titos Hauptquartier sollte ausgehoben werden.
Jeder der Fallschirmspringer hat zuvor ein Foto von Tito gezeigt bekommen. Fahndungsplakate lobten schon längere Zeit „100.000 Reichsmark in Gold“ für den aus, der Tito den Deutschen ausliefert, tot oder lebendig. Dead or alive sollte Tito gefangen werden. Das Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) vermerkt: „Für den Fall, daß es gelingen sollte, der Person Titos habhaft zu werden, hatte der Führer schon früher angeordnet, dies geheim zu halten. Auf diese Weise sollte verhindert werden, daß die Engländer sich dann wieder Mihailoviæ zuwandten.“ 40
Der Angriff mußte überraschend erfolgen. Zuerst sollte das Fallschirmjägerbataillon „unter starkem Einsatz der eigenen Luftwaffe und Inkaufnahme jeden Risikos abgesetzt werden“. Die „rücksichtslose Entblößung anderer Gebiete“ wurde in Kauf genommen. Der weitere Auftrag liest sich im OKW-Tagebuch so: „Anschließend sollten starke, schnell bewegliche Kampfgruppen (mit Teilen möglichst auch in Volltarnung) auf den größeren Durchgangsstraßen konzentrisch in das Bandenzentrum vorgetrieben werden, um diese Straßen freizukämpfen, straßengebundene schwere Waffen und Trosse der Banden und erreichbare Lager zu vernichten und die abgesprungene bzw. in Volltarnung eingesetzte eigene Truppe zu entsetzen.“ 41Zugleich sollten sie die in der Umgebung von Drvar liegenden Tito-Verbände in Abwehrkämpfe verwickeln und so daran hindern, Tito zur Hilfe zu kommen.
Читать дальше