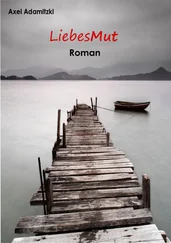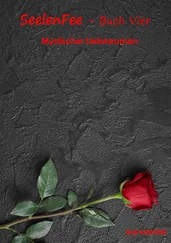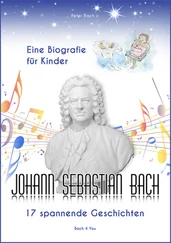»Mel, reich mir deine andere Hand«, schreie ich sie an. Ich will nicht glauben, was da passiert.
Merkwürdig in sich ruhend blickt meine Freundin mich an, und sie schüttelt nur den Kopf.
Ich verstehe sie nicht. »Mel, Mel, was passiert hier?«, rufe ich entsetzt.
»Pass auf mein Kind auf, versprich mir das, Silv. Pass auf mein Kind auf.«
»Ja natürlich, aber …«
»Versprich es mir!«
»Ich verspreche es, Mel! Aber … du musst … für dein Baby …«
»Leb wohl, Silv.«
»Nein, Mel. Nein!« Fassungslos blicke ich meine Freundin an, die völlig besonnen scheint, mich sogar anlächelt.
Und dann geschieht es: Melissa rutscht … Meine Hände greifen ins Leere.
»Nein, Mel, nein!«, schreie ich erneut … verzagt und hilflos.
Doch es gibt kein Zurück. Melissa fällt, anfänglich gelassen davonschleichend. Aus scheinbar wunschlosen Augen sieht sie mich an und lächelt noch immer.
Eine letzte Frage gibt es dann doch noch: »Warum ich, Mel? Warum ich?«
»Weil nur du es kannst.«
Und endlich schließt sie die Augen, und ihr Körper verliert sich sogleich in der Tiefe der Schlucht.
Und ich schreie … und schreie …
Sie erwachte, hochgeschreckt vom eigenen Schrei, der sich aus der Tiefe ihrer Seele gelöst hatte und sie jetzt angstvoll und entsetzt, festgekrallt irgendwo an der Wand in der dunkelsten Ecke ihres Schlafzimmers, anstarrte. Wieder einmal. Es war grauenvoll.
Sie erhob sich und schwang die Füße aus dem Bett, die sogleich Halt suchend auf dem Boden aufkamen. Und endlich spürte sie es wieder: das wirkliche Leben. Unablässig strömte es vom Boden durch die Fußsohlen in sie hinein, verteilte sich wie ein warmer Hauch in den Beinen, stieg höher, in den Bauch, in die Brust und erreichte bald schon ihre Gedanken – und ließ sie ruhig werden.
Die surreale Welt dieses schauderhaften Traumes lag hinter ihr. Wieder einmal. Für den Moment.
Seit vielen Jahren, seit ihrer Kindheit, seit sie gesehen hatte, wie erschrocken ihre Mutter auf ihre Träume reagiert hatte, hatte sie keinen solchen Traum mehr durchlebt – zumindest konnte und wollte sie sich nicht daran erinnern. Sie hasste es, dass ihre Mutter vor ihr, vor dem, was sie nach solchen Träumen gesagt und erzählt hat, zurückschreckte. Ihr Sehnen galt der Liebe der Mutter.
Deshalb drängte sie als Kind schon all ihre Träume in ein »finsteres Loch«, wie sie es sich heimlich einredete. Etwas, das ihr anfänglich entsetzlich schwerfiel.
Sicherlich waren Träume auch eine Art Wirklichkeit … eine Art zweite Wirklichkeit. Für Silvana waren sie aber schon immer mehr. Fluch und Segen zugleich. Leider. Sie suchte sich das nicht aus … es war in ihr. Andere Menschen können, ohne zu wissen, warum, schnell rennen oder erlernen in zwei Wochen das Klavierspielen. Oder sie sind in der Lage, herrliche Torten zu kreieren, ohne je ein Rezept gelesen zu haben.
Silvana träumte. Nicht wie andere. Neben ihren eigenen Träumen gab es da Bilder oder gar Visionen von Aufgaben in ihrer näheren Zukunft. Verschlüsselt natürlich. Aber Träume waren ja beinahe immer verschlüsselt. Auch träumte sie von der Vergangenheit anderer Menschen, ohne je dabei gewesen zu sein. Diese Träume waren dann undeutlicher. Realität und Illusion vermischten sich. Und immer waren es Botschaften, Hilferufe oder eben Dinge, die sie zu meistern hatte.
Nicht jede Botschaft verstand sie, und nicht zu jeder bekam sie einen Zugang. Vieles von dem Genannten ruhte noch gänzlich unberührt in ihr, wollte erst noch geweckt werden.
Diesen heutigen Traum aber, in seinem ganzen Ausmaß leider nicht zu verdrängen, glaubte sie, zu verstehen. Vielleicht nicht gänzlich. »Weil nur du es kannst« , verstand sie nicht, sollte sie auch noch lange nicht verstehen.
Der Traum war eine Aufgabe und ein Fluch zugleich. Seit letztem Freitag, dem Tag der tragischen Entbindung, verfolgte er sie.
Und er ließ sie erstarren. Immer wieder. Bei Tag und bei Nacht kam er über sie, wann immer er es wollte, ob in der Ruhe des Tiefschlafs oder profan im Auto an einer roten Ampel – oder gar mitten in einem Gespräch. Und der Traum ließ sie bis heute nicht los.
Silvana stand auf, sie musste los. Mel, Melissa, ihre beste Freundin lebte – wahrhaftig – nicht mehr.
Was für ein Unglück!
2 – Langsam, als wehrte er sich …
… gegen die herannahende Endgültigkeit, senkte sich der Eichensarg, Handbreite um Handbreite, in die für ihn auserwählte Grube.
Die weißen und roten Rosen, die den schwarz lackierten Deckel bedeckten, atmeten ein letztes Mal die spätherbstliche Frische, ließen einen letzten Blick auf ihre Schönheit zu. Auf die roten Rosen hatte er ausdrücklich bestanden, gegen die weißen hatte er sich nicht gewehrt.
Ohne es zu verstehen, vernahm Raymond-Lazare Landgraf zu Sipplingsberg den unwiderruflichen Abschied von seiner Frau … Melissa.
Versteinert und blass, um Jahre gealtert, stand der Einunddreißigjährige, umringt von Familie und Dorfbewohnern, von weitläufigen Bekannten und seinen Angestellten an der Familiengruft derer zu Sipplingsberg und schüttelte innerlich den Kopf. Mit siebenundzwanzig stirbt man doch noch nicht, schrie es in ihm. Mit siebenundzwanzig … noch nicht!
Dennoch, seine Liebe war tot, verstorben, als sie … Seine Gedanken rutschten ab.
Melissa bestand auf einer Hausgeburt, freute sich unsagbar darauf, steckte ihn mit ihrer überschwänglichen Vorfreude auf ihr erstes Kind, eine Tochter, jeden Tag aufs Neue an.
Nichts, so schien es bis zum Schluss, sprach gegen eine Geburt im Landhaus.
»Sie sind gesund, Ihre Tochter ist gesund, und Ihr Gatte … um den kümmert sich im Zweifelsfall eine Schwester«, schoben der Arzt und die Hebamme die Ängste und Zweifel immer wieder mit nüchterner Zuversicht und einem Lächeln zur Seite.
Die Komplikationen seien nicht vorhersehbar gewesen. Und als sie dann eintraten … sei es zu spät gewesen … »Auch im Krankenhaus hätten die Ärzte nicht mehr tun können«, versuchte Dr. Berthold anschließend, Raymonds Verzweiflung zu lindern.
Doch die Worte erreichten ihn nicht, drangen nicht bis zu seinem Schmerz vor, verloren sich irgendwo in einem Schleier der Fassungslosigkeit.
Er war bei der Geburt dabei, hielt seiner Frau die Hand, »presste mit« und war voller Zuversicht … bis Melissa drohte das Bewusstsein zu verlieren.
Noch bevor er begriff, was passierte, packte eine Schwester ihn vorsichtig bestimmend am Arm, geleitete ihn hinaus und blieb dann bei ihm; sicherlich auch, um zu verhindern, dass er kopflos und verwirrt das Schlafzimmer erneut betrat.
»Alles wird gut. Wir sind auch auf solche Schwierigkeiten vorbereitet. Jede Hausgeburt ist ein bisschen anders. Aber glauben Sie mir, alles geht seinen Weg«, sagte die Krankenschwester immer wieder und ließ ihn dabei nicht aus den Augen.
Doch nichts wurde gut.
Das Letzte, was er von Melissa vernahm, war ein durchdringender Aufschrei … der einem Hilferuf gleich durch das Gutshaus dröhnte … und ihre flehenden Worte: »Meine Tochter, rettet meine Tochter! Rettet mein Kind!«
»Eine Fruchtwasserembolie«, versuchte der Arzt Stunden später zu erklären. »Das war nicht vorhersehbar. Manchmal ist sie rechtzeitig genug erkennbar. Aber bei Ihrer Frau …« Er schüttelte bedauernd den Kopf. »Alles schien völlig normal.« Nachdenklich atmete er durch und fuhr dann dezent fort: »Es wird Sie nicht trösten, dennoch sollten Sie wissen, dass oft für beide, für Mutter und Kind, keine Chance besteht. Aber mitunter, wie hier, gibt es eine kleine Hoffnung … für … wenigstens einen. Und dann muss augenblicklich entschieden und auch gehandelt werden. Und Ihre Frau … sie hat entschieden. Sie wollte, dass in erster Linie … Ihre Tochter lebt. Und sie lebt, und sie ist kerngesund.«
Читать дальше