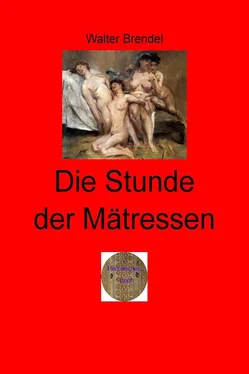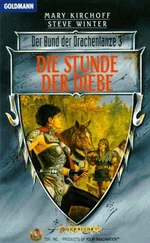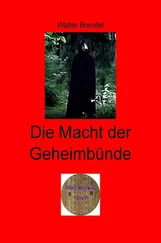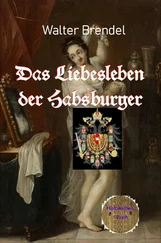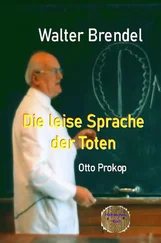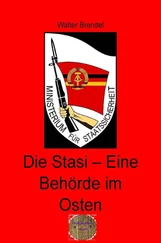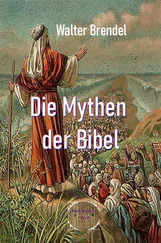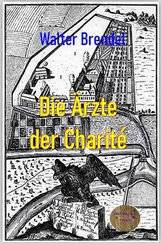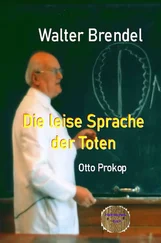Walter Brendel
Die Stunde der Mätressen
Die berühmtesten Mätressen aus sieben Jahrhunderten
Die Stunde der Mätressen
Walter Brendel
Die berühmtesten Mätressen aus sieben Jahrhunderten
Impressum
Texte: © Copyright by Walter Brendel
Umschlag: © Copyright by Walter Brendel
Verlag: Das historische Buch, 2022
Mail: walterbrendel@mail.de
Druck: epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhalt
Einleitung
Im 12. Jahrhundert
Rosamund Clifford
Im 14. Jahrhundert
Alice Perrers
Im 15. Jahrhundert
Agnès Sorel
Giulia Farnese
Im 16. Jahrhundert
Mary Boleyn
Barbara Blomberg
Diana von Poitiers
Marie Touchet
Roxelane
Im 17. Jahrhundert
Im Bett des Sonnenkönigs
Im Bett des starken August von Sachsen und Polen
Weitere Mätressen im 18. Jahrhundert
Mätressen Ludwig XV.
Im 19. Jahrhundert
Zoé Talon
Emma Hamilton
Katharina Schratt
Jekaterina Michailowna Dolgorukowa
Alice Keppel
Lola Montez
Maria Walewska
Eleonore Denuelle
Pauline Henckel von Donnersmarck
Fazit
Als "Pornokratie" bezeichnen Historiker die Macht jener Frauen, die als heimliche Geliebte von Fürsten, Päpsten oder Königen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die politischen Entscheidungen dieser Herrscher hatten. Zwar gehört das Konkubinentum in das Zeitalter der Monarchien, in denen Könige ihre Ehe nach geopolitischen Gesichtspunkten schließen mussten und sich mit einer heimlichen Liebe über diese Zwangsheirat hinwegtrösteten, aber immerhin ist das Phänomen im Fall von Camilla Parker-Bowles bis heute gegenwärtig: Erst am 9. April 2005 haben der britische Thronfolger Prinz Charles und Camilla Parker-Bowles eine 30-jährige Liaison beendet. Damit gelang der Geliebten von Prinz Charles, wovon schon im 14. Jahrhundert die Mätressen des Sonnenkönigs träumten: Nach dem Tod der Fürstengattin ganz offiziell deren Platz einzunehmen. Eine berühmte Mätresse, der das im 17. Jahrhundert gelang, war Madame de Maintenon. Sie war die dritte offizielle Mätresse des Sonnenkönigs Ludwig XIV. und schaffte, was ihren Vorgängerinnen verwehrt blieb: Während die abgelegten Geliebten ihr Alter in Verbannung oder im Kloster verbrachten, heiratete Ludwig die Maintenon nach dem Tod seiner Gattin, wenn auch in aller Heimlichkeit. Bis dahin hatte sich die verarmte Adelige beim König als Erzieherin seiner zahlreichen unehelichen Kinder verdient gemacht. Denn der Sonnenkönig nahm es mit der Treue nicht so genau. Oder betrachten wir Julia Farnese, die heimliche Ehefrau des Renaissance-Papstes Alexander VI. Hier zeigen sich auch gesellschaftliche Hintergründe. Dass der Vatikan während der Renaissance als "Hauptstadt der Huren" von den Kurtisanen Steuern einnahm, mag noch ein wissenswerter Hinweis über die zeitgenössische Bigotterie sein. Aber der Schicksalsbericht über die ukrainische Sklavin Roxelana wird mit einer allzu spektakulären Aneinanderreihung schlüpfriger Anekdoten angereichert. Roxelana wurde Mitte des 16. Jahrhunderts in den Harem des Herrschers Süleiman verschleppt, um dem Sultan sexuell zu Diensten sein. Und anders als die Sklavinnen, denen von Eunuchen sogar die Gurken klein geschnitten wurden, damit sie sich nicht ohne den Sultan befriedigen konnten, würden die männlichen Abkommen aus diesen Affären sogar über ein Anrecht auf die Thronfolge verfügen.
Als „Mätresse“ bezeichnete man bis etwa ins 19. Jahrhundert eine öffentlich als solche bekannte Geliebte eines Fürsten, hochrangigen Adligen oder bedeutenden Amtsträgers. In gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen Ehen vorrangig unter politischen und materiellen Aspekten geschlossen wurden, hatten Männer häufig eine Konkubine („Beischläferin“), die sie nicht zu verbergen versuchten – was ohnehin unmöglich gewesen wäre –, sondern halb legitimierten. Meistens hatten sie zu dieser eine engere affektive und geistige Beziehung als zu ihrer Ehefrau. In der höfischen Gesellschaft war der Status der Mätresse anerkannt. Einige Mätressen entfalteten bedeutenden politischen Einfluss, indem sie den Fürsten in seinen Entscheidungen bestimmten oder in seinem Namen Anweisungen gaben. Der Fürst sorgte für den standesgemäßen Unterhalt der Mätresse. Um ihnen Zugang bei Hof zu erlauben, wurden viele Mätressen geadelt.
Umgangssprachlich wurde der Begriff auch als Synonym für „Geliebte“ benutzt, ist in dieser Bedeutung heute aber veraltet. Als Favoritin wurde die bevorzugte Mätresse des Fürsten bezeichnet.
Die Mätressen europäischer Fürsten waren ursprünglich Geliebte ohne den späteren, halboffiziellen Status, traten selten oder gar nicht öffentlich auf und hatten sich auf eine rein private Rolle zu beschränken.
Als im Hochmittelalter in Frankreich und später auch im übrigen Europa die Höfe in Residenzstädten sesshaft wurden, änderte sich das Hofleben und nahm darin die Bedeutung der Frauen zu. Im Zusammenhang damit wandelte sich das Rollenbild der bloßen Geliebten des Fürsten zu dem der Mätresse, die in aller Regel dem Kreis der adligen Hofdamen und Ehrenjungfern entstammte. Unter Franz I. etablierte die Mätresse sich als inoffizielle Institution. Zwar war es für die Kirche offiziell ein Stein des Anstoßes, dass dergestalt öffentlich gegen das Verbot des Ehebruchs verstoßen wurde, die Kirche tolerierte jedoch die Situation, da der hohe Klerus – der meist dem Adel entstammte – am Hof verkehrte und sich teilweise selbst Mätressen hielt.
Es gab so etwas wie mildernde Umstände für Fürst und Mätresse. Landesherren und auch hohe Adlige mussten Frauen heiraten, die sie nicht freiwillig gewählt hatten. Da die so zustande kommenden Zwangsehen gegen die zentrale kirchliche Forderung nach Freiwilligkeit einer Eheschließung verstießen, neigten Theologen dazu, bei Fürsten und anderen hochstehenden Männern eine Ausnahme vom Gebot der Monogamie zu machen und ihnen Mätressen zuzugestehen.
Die Mätresse wurde im Laufe des 16., 17. und 18. Jahrhunderts an den Höfen immer mehr zu einer Alltäglichkeit und erhielt einen Status mit ungeschriebenen Rechten und Pflichten. Die Problematik der mit dem Fürsten häufig gezeugten Kinder wurde pragmatisch geregelt: War die Mätresse verheiratet, galten sie als Kinder des Ehemannes (der mit allerlei Vorteilen entschädigt wurde); war sie ledig oder verwitwet, wurden sie legitimiert. In beiden Fällen wurden die Töchter in der Regel später mit Hochadligen verheiratet und die Söhne, die für die Thronfolge als Legitimierte ausschieden, mit hohen Posten in der Armee oder der Kirche versorgt. Man kann davon ausgehen, dass viele Fürstinnen die Mätressen tolerierten, solange sie von ihnen mit dem gebotenen Respekt behandelt wurden, zumal auch sie selbst zwangsweise verheiratet worden waren und meistens keine tiefere Beziehung zu ihrem Gemahl hatten. Allerdings war es den Fürstinnen schon wegen der zu befürchtenden Schwangerschaften und Geburten so gut wie unmöglich, auch ihrerseits Geliebte zu haben.
Die Verhältnisse um Katharina die Große sind eher untypisch, da das Vorhandensein der ersten Geliebten hier geheim gehalten wurde, sich dabei allerdings offenbar einer gewissen Duldung durch den wohl nicht ganz zurechnungsfähigen Ehemann und die Zarin erfreute, die Katharinas Schwiegermutter war. Größere Offenheit in Bezug auf die späteren Geliebten zog hier erst ein, nachdem Katharina selbst Zarin geworden war.
Seinen Höhepunkt erreichte das Mätressenwesen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert. Madame de Maintenon und Madame de Pompadour besaßen nennenswerten Einfluss auf die Politik Frankreichs und förderten in eigener Initiative Künstler und Intellektuelle.
Auch an anderen Höfen im Europa jener Zeit blühte das Mätressenwesen. In Sachsen z. B. war Gräfin Cosel die offizielle Geliebte des Kurfürsten August des Starken. Nach dem Ende des Zeitalters der absoluten Herrscher war die klassische Epoche der Mätressen vorüber. Lola Montez beeinflusste allerdings noch den Bayernkönig Ludwig I.
Читать дальше