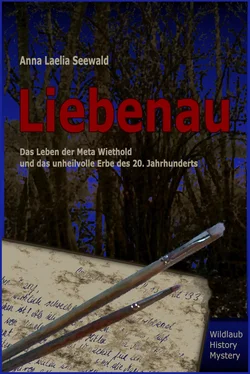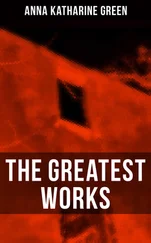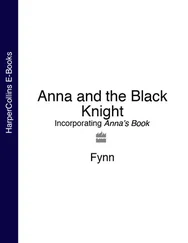Die unterwürfigen jungen Mädchen, die man in den Kreisen seines Onkels zum Tanztee lud, hatten ihn nie gereizt. Er hatte es zu der Zeit vorgezogen, sich von Sibylla in die Freuden der körperlichen Liebe einführen zu lassen und Sibylla war es auch gewesen, die damals die Idee mit dem Gläserrücken gehabt hatte.
Er war fünfzehn gewesen, sie zwei Jahre älter. Es war das Jahr gewesen, in dem Albert Einstein mit der speziellen Relativitätstheorie Furore gemacht hatte, das Superjahr der Wissenschaft. Der Kaiser war damals noch in Amt und Würden gewesen, der Krieg hatte noch in weiter Ferne gelegen. Deutschland war die führende Nation in Europa gewesen. Zumindest hatten sie sich in ihrem Chauvinismus und in ihrer jugendlichen Naivität eingeredet, dass sie das Land der Erfinder und Entdecker waren, vor dem die europäischen Nachbarn sich wohl oder übel beugen mussten.
Er war ein gelangweilter, pubertierender Bengel gewesen, der den Schmerz darüber, dass seine Eltern so jäh aus dem Leben gerissen worden waren, tief in sich vergraben hatte. „Lass uns Kontakt mit ihnen aufnehmen!“ hatte Sibylla ihn gelockt. „Na, mit ihren Seelen! Du glaubst doch wohl nicht, dass man nach dem Tod zu Staub zerfällt und damit dann alles vorbei ist!“ hatte sie hinzugefügt und für ihn hatte es damals so ausgesehen, als würde sie ihn in ein weiteres Geheimnis der Erwachsenenwelt einweihen, das man ihm, dem braven Jungen, der so früh zum Waisen geworden war, bislang vorenthalten hatte. Und hatte die Wissenschaft nicht gerade aufgezeigt, wie viel sie sowieso alle noch gar nicht wussten?
Sibylla, die damals ja selbst noch ein Mädchen in der Adoleszenz gewesen war, hatte den Eindruck erweckt, genau zu wissen, was zu tun war, um die Geister der Toten zu beschwören. Aber natürlich war trotzdem nicht viel dabei herausgekommen.
Er hatte später gelesen, dass es unwillkürliche Muskelkontraktionen waren, die beim Gläserrücken das Glas bewegten. Und natürlich wusste er, dass Wahrsagerinnen ihre Kunden mit allerlei Hokuspokus und faulem Zauber umgarnten.
Trotzdem beunruhigte es ihn ein wenig, dass Sibylla sich in letzter Zeit immer mehr in krude theosophische Ideen verstieg. Sie redete ständig davon, dass es Wurzelrassen gab und die Menschheit dem Licht entgegen strebte. Sie befasste sich mit Wiedergeburt und den Bürden eines vorherigen Lebens, die es aufzuarbeiten galt. Sie selbst sei unter anderem eine vorderasiatische Tempel-Prostituierte gewesen und später eine französische Adlige, die noch vor der Hochzeit an Schwindsucht gestorben war, während ihr Verlobter bei den Schlachtzügen Wilhelm des Eroberers den Tod gefunden hatte. „Stell dir vor, Konni! Nicht einmal die Hochzeitsnacht war mir vergönnt!“ hatte sie gesagt. Vermutlich lag es daran, dass sie die körperliche Liebe in ihrem jetzigen Leben in vollen Zügen genoss. Sicherlich galt es außerdem, die Sünden der vorderasiatischen Prostituierten aufzuarbeiten.
Konrad lachte in sich hinein und hoffte, dass Sibylla es nicht bemerkte. Doch die war viel zu sehr damit beschäftigt, sich auf seinem Sofa in verschiedene Posen zu werfen, die Rokoko-Darstellungen Madame de Pompadours entlehnt zu sein schienen.
Sibylla hatte sich immer schon darauf verstanden, alles Mögliche, was sich in ihrem Leben ereignete, phantasievoll auszuschmücken. Sie hatte ihm erzählt, dass sie in die Rollen, die sie auf der Bühne spielte, immer einen Teil ihres Ichs aus einem vorangegangenen Leben legte. Konrad nahm an, dass ihr Interesse an der Theosophie daher rührte und im Grunde sehr oberflächlich war.
Er selbst hegte gewisse Vorbehalte der Theosophie gegenüber. Er glaubte nicht daran, dass Menschenrassen sich höher entwickelten, wie Charles Darwin es für Lebewesen im Allgemeinen beschrieben hatte. Darwin hatte darüber hinaus von einer Anpassung an die Umwelt gesprochen. Die Lichtmystik, von der Sibylla redete, musste in diesem Zusammenhang verworfen werden, so wichtig die Sonne gewiss auch für alles Leben auf der Erde war.
Er hatte Sibylla noch nie vor einer ihrer zahlreichen Dummheiten bewahren können und wenn er ehrlich war, war er sich auch nicht sicher, ob er es wirklich wollte. Es war eine Sisyphosarbeit – fruchtlos und frustrierend. Vergeudete Energie, darüber war er sich im Klaren.
Konrad seufzte. Es ärgerte ihn, dass es kaum etwas zu geben schien, das Sibylla wirklich berührte. Über Vorbehalte seinerseits und vorsichtige Versuche, sie auf Distanz zu halten, ging sie einfach so hinweg. Seine Gefühle ignorierte sie. Sie war sich zu sicher, dass sie bekommen würde, was sie wollte, wenn sie nur hartnäckig genug blieb und Missstimmungen zwischen ihnen konnten sie kaum erschüttern. Doch Konrad hatte keine Lust, ständig nach ihrer Pfeife zu tanzen. Irgendwann war immer der Punkt erreicht, wo sie ihm schlicht unerträglich wurde.
Sie hatte sich auf den Bauch gedreht und lag schräg über dem Sofa, die Beine abgewinkelt und den Kopf in die Hände gestützt. Sie musste ihn schon eine ganze Weile aus ihren sorgfältig geschminkten großen Augen angeschaut haben. Jetzt, wo sie seine Aufmerksamkeit, auf die sie so geduldig gewartet hatte, wieder hatte, verzog sie ihren Mund zu einer Flunsch und flötete: „Lass es uns noch einmal versuchen, ja, Konni? Du bist einsam, das sehe ich doch!“
Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Konrad wollte allein sein. Er wollte die Rezension eines Theaterstückes, an der er gerade arbeitete, zu Ende schreiben und sich dann bei einem Glas Rotwein einigen Textentwürfen für eine neue Avantgarde-Kunstzeitschrift widmen.
„Steh auf, Sibylla!“ sagte er barsch. „Zieh dich an und geh!“ Er starrte sie kalt an, um ihr zu verdeutlichen, dass er es wirklich ernst meinte. Sie hatte sich wieder auf ihr Gesäß gedreht und saß nun mit übereinandergeschlagenen Beinen auf dem Sofa. „Bitte!“ setzte Konrad hinzu. Er registrierte ein kurzes Flackern in ihren Augen. Dann erhob sie sich und zog sich wortlos ihre Straßenkleidung über.
„Deine kleine Künstlerin hat dir den Kopf verdreht, Konni! Das weiß ich und deshalb bin ich dir nicht böse! Aber du wirst noch an mich denken, das verspreche ich dir!“ ließ sie ihn wissen, als sie die Haustür öffnete. Er nickte stumm. „Natürlich, Sibylla. Dich vergesse ich nie!“ murmelte er dann matt. Da war sie allerdings schon weit genug die Straße hinabgegangen, als dass sie ihn noch hätte hören können. Trotzdem musste sie bemerkt haben, dass er ihr nachgesehen hatte, denn sie drehte sich noch einmal um und winkte ihm kurz zu. Ihr Lächeln war so herzlich, dass zufällig vorbeikommende Passanten denken mussten, sie hätten einen wunderbaren Nachmittag miteinander verbracht.
Oranienburg bei Berlin, Dezember 1920, eine Szene aus der Nähe betrachtet
Siegfried Caldewey nahm den Saphir aus dem Schmuckkästchen, das der Mann in dem dunklen Wollmantel vor ihm auf die Ladentheke gestellt hatte. Der Edelstein war wahrlich ein Prachtstück – ungewöhnlich groß, von einem klaren, leuchtenden Blau und mit einer Kunstfertigkeit geschliffen, wie sie heutzutage nur noch selten anzutreffen war. Da musste ein alter Meister am Werk gewesen sein, das sah Caldewey sofort. In seiner ganzen Laufbahn als Juwelier war ihm noch nie etwas Derartiges untergekommen.
Und Caldewey musste es wissen. Zwar war sein Laden unscheinbar und seine Kundschaft interessierte sich vorrangig für Verlobungs- und Eheringe und davon abgesehen fiel allenfalls mal die Reparatur eines Silberhalskettchens an, doch der Oranienburger Juwelier hatte sich mit Geschäften, die Diskretion erforderten, in einschlägigen Kreisen, zu denen auch ein paar Größen der Berliner Unterwelt gehörten, einen gewissen Ruf erworben.
Die beiden elegant gekleideten Herren schienen ihn genau deshalb ausgesucht zu haben. „Bitte, legen Sie doch erst einmal ab!“ lud er sie herzlich ein. „Bertha wird Ihnen einen Kaffee machen. Oder soll es lieber Tee sein? Bei der Kälte draußen ...“ Es hatte angefangen zu schneien, wie er durch die Schaufenster seines Ladens sehen konnte, aber von den zarten, weißen Flocken, die durch den dämmerigen Dezemberhimmel tanzten, würde wohl nicht mehr als ein bisschen Schneematsch liegen bleiben.
Читать дальше