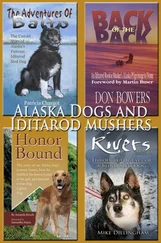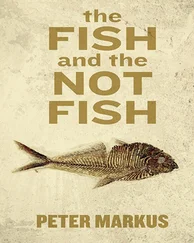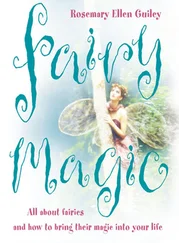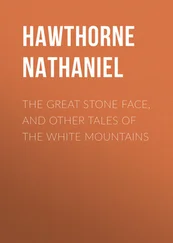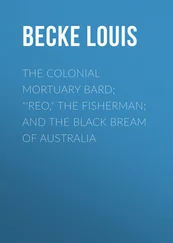Hier, in Spanien, war alles anders: An der Rambla, der Strandpromenade, standen Palmen, hinter einer niedrigen Mauer war der Strand voller braun gebrannter Menschen, bunten Handtüchern und Sonnenschirmen. Und dahinter: Das Meer - so blau, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. In den kleinen Straßen des Ortes war Sonne und mediterrane Stimmung, fremde Gerüche und neue Geräusche, bunte Farben, Lachen, Leichtigkeit.
Damals gab es da ein paar Hippies. Von denen hatte ich wohl schon mal was gehört, aber bei uns im Bergischen Land noch nie welche gesehen. Sie verkauften am Strand selbstgemachten Schmuck und machten Musik, in der kleinen Stadt liefen die Kerle in ausgefransten Jeans-Shorts und die Frauen in weiten, indisch anmutenden Kleidern herum, trugen bunte Kopftücher und breitkrempige Lederhüte. Abends, wenn wir auf dem Rückweg vom Abendessen am Strand entlang zurück zum Hotel gingen, sahen wir sie wieder: Sie saßen rund um ein Lagerfeuer, hatten Westen und Jacken mit langen Fransen an den Ärmeln an, lachten, sangen, trommelten auf Bongos, spielten Gitarre, und tranken Wein aus Flaschen.
Ich war baff: Das hier war aber mal wirklich was ganz Anderes als das piefige, provinzielle Wuppertal, wie völlig anders und frei das war. Dass es so was überhaupt gab!
Was mich aber noch viel mehr faszinierte war das blecherne Knattern aus dem Hinterhof einer Villa am Strand, in den man vom Balkon unseres Hotelzimmers hinuntersehen konnte: Jeden Morgen trat dort ein junger Spanier seine rot-silberne Bultaco Matador (ein spanisches Gelände-Motorrad) mit zwei-drei Tritten an. Dann setzte er seine verspiegelte Sonnenbrille auf, und knallte den ersten Gang rein. Ein paar schnelle Drehs am Gasgriff ließen den 250er Zweitaktmotor aufbellen, und mit aufsteigendem Vorderrad fuhr er los. Blieb in der Einfahrt kurz stehen, noch mal ein paar Gasstöße – RAM! RAM! RAM! - und bog dann auf die Rambla ein. Und raste, nur in T-Shirt, Jeans und ohne Helm, mit den im Fahrtwind wehenden, damals üblichen langen Haaren, davon.
Ich war hin und weg: Wow – und so was gab es auch? Nicht nur die ollen Kerle mit ihren schwarzen 500er BMWs, in dicken, schwarzen, steifen Lederkombis und mit ihren weißen Halbschalenhelmen, die ab und zu bei meiner Tante an die Tankstelle kamen?
Ja: So was gab es tatsächlich auch!
Später im Jahr, kurz vor Weihnachten, hatte „Easy Rider“ gerade den Weg in das Kino neben unserem Gymnasium gefunden. Gehört hatten wir von dem Film schon mal: Die Jungs aus den höheren Klassen hatten davon erzählt, während sie in den großen Pausen, in einer nur schwer einsehbaren Ecke des Schulhofs, heimlich rauchten - die Kippe in der hohlen Hand versteckt, und den Rauch hastig nach unten ausblasend; in der Hoffnung, dass kein Pauker was davon mitbekam. Sie erzählten von der Fahrt der beiden Protagonisten Wyatt und Billy durch Amerika, ihrem Zusammentreffen mit Hippies und Mädchen, mit Spießern in den Provinzdörfern und den Rednecks in den Südstaaten. Von einem LSD-Trip auf einem Friedhof in New Orleans, und der Musik von den Byrds, Steppenwolf, The Band, Roger McQuinn und Jimi Hendrix, zu den Bildern von Weite und Freiheit. Uns Sextanern standen Augen und Münder auf, während wir uns um sie herumdrückten; und auch so sein wollten.
Tagelang stand ich jetzt jeden Morgen vor Schulbeginn im Wuppertaler Winterschmuddelwetter vor den Schaukästen des Kinos, und bestaunte die Fotos aus dem Film. Solche Motorräder hatte ich noch nie gesehen: Die beiden Chopper, mit ewig langen Gabeln, dicken, chromglänzenden Harley-Motoren und Rückenlehne: Das „Captain Amerika“-Bike, mit dem im Stars and Stripes-Muster lackiertem Tank und verchromtem Rahmen, und das psychedelisch in rot und gelb lackierte „Billy-Bike“. Darauf zwei Typen mit Sonnenbrillen, in Lederjacken und ohne Helm, die mich an die Hippies in Spanien erinnerten. Nebeneinander fahrend, aufrecht und irgendwie Gelassenheit ausstrahlend, vor der Kulisse der weiten, sonne-durchglühten amerikanischen Landschaften.
Nicht zu fassen, was es alles gibt, dachte ich damals. Und:Das - genau DAS wollte ich auch!
Hinein durften wir nicht, der Film war erst ab sechzehn. Aber obwohl ich noch nie auf einem Motorrad gesessen hatte – nur mal auf dem Rücksitz von Vaters Lambretta-Roller, aber das galt nicht, das war ja nun wirklich was anderes - begann sich das Biker-Virus langsam in mir einzunisten.
Ich fing an von Abenteuern und Freiheit auf zwei Rädern zu träumen, sah mich wie Dennis Hopper in der Fransenlederjacke und einem Westernhut auf dem Kopf durch die Pyrenäen ins sonnige Spanien meines Sommerurlaubs fahren; vorbei an den großen, schwarzen Stieren der Osborne-Reklame, die ich bei der Fahrt nach Sitges aus dem Auto meiner Eltern gesehen hatte. Dummerweise träumte ich in der Schule davon weiter, was der Verbesserung meiner Fünfen in Mathe und in Deutsch nicht sonderlich dienlich war.
Aber, ganz so schlecht waren meine Noten in den folgenden Jahren dann doch nicht. Denn 1972, zum fünfzehnten Geburtstag, bekam ich zur Anerkennung für die doch noch gerade so eben gelungene Versetzung von Erbtante Emmi ein Mofa: Eine Mars 25. Und damit bekam das noch in mir ruhende Virus reichlich Futter: Jede freie Minute war ich jetzt damit unterwegs. Schraubte daran herum, um es schneller zu bekommen – und vor allem lauter.
Dann kam mit 16, vom ersten selbstverdienten und gesparten Geld, eine Fuffziger, ein Kleinkraftrad - fast schon ein Motorrad: Eine sonnengelbe Puch M 50 Jet, mit sagenhaften 6,3 PS! Die Drei hinter dem Komma war damals wichtig, in der Clique: Die anderen, mit ihren Herkules, Kreidler und Zündapps, hatten nämlich nur 6,25...
Und dann, gleich nach dem Bund, mit Anfang Zwanzig und wieder etwas Geld in der Tasche, kam endlich das erste richtige Motorrad: Eine Suzu…..
„Mensch!“, sagt Helga mit Nachdruck - sie schaut mir beim Schreiben hin und wieder über die Schulter. Als ich mich zu ihr umdrehe sehe ich, wie sie verständnislos den Kopf schüttelt.
„Du fängst schon wieder an zu schwafeln! Will doch keiner wissen, das alte Zeugs! Du sollst von unserer Reise erzählen!“.
Ja, schon gut - sie hat wie so oft wieder mal völlig Recht! Wer will das auch schon lesen, alte Männer und ihre verklärten Erinnerungen an die Jugend. Jedenfalls: Die Infektion wurde chronisch; und bis heute hab ich kein Gegenmittel gefunden.
Und Helga? Weiß auch keins. So ein Glück!
Wo war ich? Ach ja: Wir sind Moppedfahrer. Biker, oder wie auch immer ihr zwei Menschen nennen wollt, denen die Freiheit, die Landstraßen dieser Welt auf einem Motorrad zu erkunden, sehr sehr viel bedeutet. Bei uns sieht Motorradfahren folgendermaßen aus: Wir lassen die Armbanduhr zu Hause, überlegen kurz, in welche Richtung es denn heut gehen soll, lassen die Motoren an und fahren los - ohne Zeitdruck, ohne irgendwo Ankommen zu müssen. Und dann: Sehen, riechen, schmecken, fühlen. Die Elemente hautnah erleben. Eindrücke von den sich verändernden Landschaften aufsaugen, Menschen treffen. Und dabei immer wieder Neues und Anderes kennenlernen.
Egal wie abgedroschen und vielleicht kitschig es sich für manchen anhört: Ich hab dabei eigentlich fast jedes Mal den alten Song von Willie Nelson im Ohr: „On the road again, goin' places that I've never been. Seein' things that I may never see again...“, singt er. Wieder auf der Straße sein, zu Orten fahren wo man noch nicht war. Dinge sehen, die man vielleicht nie mehr sieht. Und: Dass er es gar nicht abwarten kann wieder auf der Straße zu sein.
Ja - genau so geht‘s mir auch: „And I can't wait to get on the road again!“
Dieses sich immer wieder aufs neue einstellende, wunderbare Gefühl von Freiheit erleben, das in unserer heutige Zeit voller Hektik und Veränderung, Rationalität und Verpflichtung so selten geworden ist: Nichts zu erwarten, nur eine ungefähre Richtung einschlagen - und es, das Leben, einfach geschehen lassen. Und sich dabei vielleicht so ein bisschen wie Wyatt und Billy auf ihren Choppern fühlen, die Rollen von Peter Fonda und Dennis Hopper in „Easy Rider“.
Читать дальше