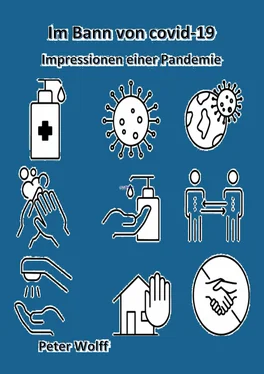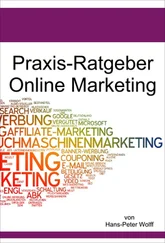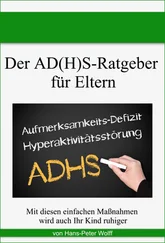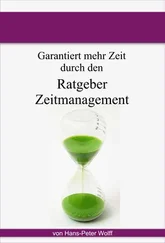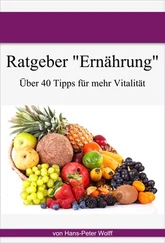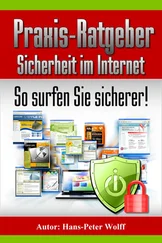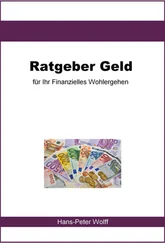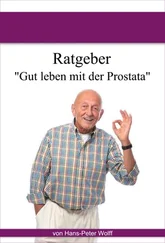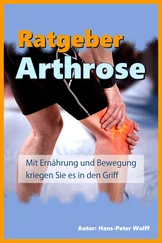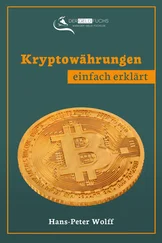"Die Gastronomie ist bisher nicht als ein Hotspot erkannt worden", erklärt dazu der Kölner Virologe Rolf Kaiser im Oktober 2020.
Ob der drastische Schritt wirklich großen Einfluss auf die Infektionszahlen haben werde, sei zumindest zweifelhaft. Er könne sogar einen gegenteiligen Effekt haben, wenn sich das gesellige Leben wieder vollständig in den privaten Bereich verlagert.
Die Betroffenen fühlen sich völlig zurecht schikaniert.
Obgleich man in vielen Restaurants, Kinos, Konzertsälen oder Theatern Hygiene- und Abstandsmaßnahmen vortrefflich umgesetzt hat und bislang auch nicht bekannt wurde, dass sich hier Infektionen ausbreiten, werden Orte, die der Kultur, der Freizeit dienen, geschlossen, Geschäfte aller Art, von Baumärkten bis hin zu Modegeschäften oder Möbelhäusern hingegen bleiben zunächst geöffnet. Immerhin ist es ja kurz vor Weihnachten.
Schon jetzt stünden rund ein Drittel der Betriebe vor dem Aus, warnt der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Eine weitere Zwangspause werde unzählige Existenzen zerstören (64).
Auch in anderen Bereichen, so wird man das Gefühl nicht los, wären eventuell mildere Maßnahmen denkbar. Statt die Schließung eines Fitnessstudios anzuordnen, könnte man die Zahl gleichzeitig Trainierender begrenzen, regelmäßig alle Sportgeräte desinfizieren und einen Mindestabstand zwischen eben diesen einhalten.
Selbst die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) spricht sich – gleichfalls im Oktober- in einem Positionspapier deutlich gegen "reflexhafte" Schließungen ausgesprochen. Sobald sich Verordnungen als "widersprüchlich, unlogisch und damit für den Einzelnen als nicht nachvollziehbar" darstellten, entstehe ein Akzeptanz- und Glaubwürdigkeitsproblem.
"Wir könnten diejenigen verlieren, die wir dringend als Verbündete im Kampf gegen das Virus brauchen", heißt es in dem Papier, zu dessen Unterzeichnern auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck gehört (65).
Auch für die Potsdamer Soziologin und Risikoforscherin Pia-Johanna Schweizer sind die wichtigsten Faktoren im Kampf um die Akzeptanz: Transparenz und Nachvollziehbarkeit. In den Bundesländern werde zum Teil ein und dieselbe Faktenlage unterschiedlich ausgelegt. „Das verwirrt die Leute und führt zu Verdruss.“ Sie plädiert etwa für einen einheitlichen Umgang mit Risikogebieten.
Negativ auf die Akzeptanz wirkt sich auch aus, wenn Menschen das Gefühl haben, es werde mit zweierlei Maß gemessen. Ein Laienschauspieler beteuert, dass er kein Verständnis dafür hat, dass Fußballspielen im Verein erlaubt ist, aber das Theaterspielen nicht. „Solche Dinge sind unlogisch. Da wäre eine Vereinheitlichung dringend notwendig“, meint Schweizer (66).
Dem Gefühl, dass anlässlich der Corona-Beschränkungen bisweilen mit zweierlei Maß gemessen wird, kann man sich manchmal wirklich kaum entziehen.
Der zweite Lockdown im November fällt zunächst deutlich milder aus als der erste im März.
Zwar müssen wir wieder auf kulturelle Veranstaltungen, auf Pizza und Kölsch (es sei denn, man holt beides am unscheinbaren, aber vorzüglichen Stehimbiss „Pinocchio“ auf der Siegburger Straße in Köln-Poll, wärmstens zu empfehlen...) verzichten, aber die Geschäfte dürfen weiterhin ihre Kunden bedienen, Schulen und Kitas bleiben geöffnet.
Bei den Gaststätten hingegen bleibt man hart. Auch gut ausgetüftelte und stimmige Hygienekonzepte stimmen die Entscheider nicht gnädig und nutzen den vielen Gastronomen, die sich um eben diese bemüht haben, nichts. Weil gastronomische Betriebe, so die Argumentation, in besonderer Weise soziale Kontakte fördern.
Im überfüllten Bus, „Maske an Maske“, zur Arbeit fahren dürfen wir, aber abends mit der Frau oder dem Mann des Herzens „maskiert“ ein Lokal betreten und dann ganz in der Ecke sitzen und die Maske nur bei Tisch abnehmen – keine Chance.
Das muss man nicht verstehen, oder?!
Selbst aus der Politik gibt es Zweifel an dem "Lockdown" für die Gastronomie.
Die FDP hält die Schließungen gar für verfassungswidrig.
"Das halte ich für unnötig und deshalb auch für verfassungswidrig", erklärt FDP-Chef Christian Lindner. Sein Parteikollege Wolfgang Kubicki spricht im Deutschlandfunk von "Alarmismus". Die Beschlüsse würden einer gerichtlichen Überprüfung wahrscheinlich nicht Stand halten (67).
Es hat den Anschein, dass es vor allem politische Prioritäten sind, aufgrund derer man zunächst das Wirtschaftsleben nicht unterbrechen (und auch Schulen und Kitas im November 2020 nicht wieder schließen) will. So müssen die Menschen die Opfer im Privat- und Freizeitbereich bringen, eben dort, wo es am wenigsten Lobbymacht gibt. Es darf nicht sein, dass die Ökonomie definiert, wer Opfer bringen muss, dass vornehmlich jene Branchen schließen müssen, deren Umsätze überschaubar sind.
Grundrechte gehören nicht in Quarantäne. Darum muss jede Maßnahme, die wegen der Pandemie Grundrechte einschränkt oder ihre Geltung aussetzt, kritisch beäugt, jede Einschränkung für sich begründet werden.
Auch sollten alle Maßnahmen zunächst einmal zeitlich befristet werden. Jede weitere Verlängerung bedarf einer neuen Begründung. In kurzen Zeitabständen gilt es demokratisch zu prüfen, ob die ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung des angestrebten Ziels noch das geeignetste und mildeste Mittel sind, ob sie noch angemessen sind. Dazu gehört auch die transparente und sorgfältige Abwägung der mit der Grundrechtseinschränkung verbundenen Risiken für Körper und Seele, auf die ich in einem späteren Kapitel noch eingehe.
Denn die Freiheitsrechte sind zu wichtig, um sie einer Pandemie unterzuordnen. Im Kampf gegen das Virus jedoch werden sie außer Kraft gesetzt. Wenn dies schon als alternativlos bezeichnet wird, müssen diese Eingriffe bestmöglich begründet und wirklich unvermeidlich sein. Und genau darum muss jeder einzelne Freiheitseingriff verhältnismäßig, dazu transparent, bleiben. Das ist im Rahmen der beiden so genannten Lockdowns in Deutschland anno 2020 sicher nicht immer der Fall.
Eine nicht nachvollziehbare, eine willkürlich scheinende Mischung von Maßnahmen zerstört das bislang noch relativ starke Vertrauen einer Mehrheit in die politisch Verantwortlichen und ist ganz nebenbei Wasser auf die Mühlen jener, die in Lockdown und Konsorten ein großes Experiment zur Unterjochung ganzer Völker für eine kleine globale Oligarchie sehen
Die derzeitige Pandemie verlangt uns als Gesellschaft einiges ab.
Es gibt Kontaktverbote, Grundrechte werden eingeschränkt, Regeln aufgestellt und durchgesetzt.
Argwöhnisch beäugen Nachbarn, wer wann mit wem warum vor die Tür geht. Und vielleicht mal hustet.
Wildfremde Menschen werfen demjenigen böse Blicke zu, der sich an der frischen Luft körperlich ertüchtigt.
Bei all den Regeln kann der Überblick verlorengehen, können Nachbarn, Passanten auf der Straße oder auch Behörden durchaus das Maß der Verhältnismäßigkeit verlieren.
Weil auch sie mit der Situation bisweilen überfordert sind.
Vielleicht verhält es sich einfach so, dass das Virus mit Gerechtigkeit nicht zu bekämpfen ist.
Niemand kann vorhersagen, ob die Gesetze und Regelungen in Deutschland die Corona-Krise effektiv und ausreichend bekämpfen.
Weil niemand vorhersagen kann, wie sich die Infiziertenzahlen entwickeln werden. werden.
Wenn auch die sinkenden Inzidenzzahlen bis Mitte Februar 2021 dem zweiten Lockdown wirksam aussehen lassen.
Doch wie soll es – auch angesichts der neuen Mutationen – danach weitergehen? K
Keiner weiß genau, was verhältnismäßig ist.
Dies liegt auch daran, dass man immer noch zu wenig über das Corona-Virus und die neuen Varianten weiß.
Manche finden die Gesetze und Regeln pas end, andere nicht. Einige sind mehr, andere weniger betroffen von den Verhaltensmaßregeln.
Читать дальше