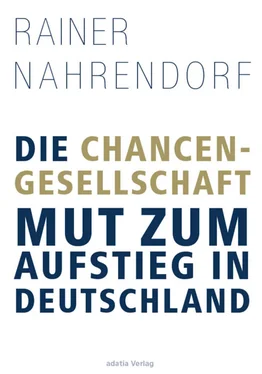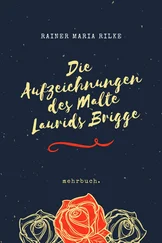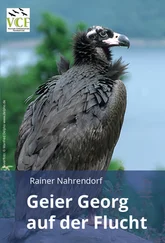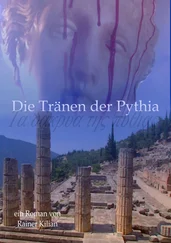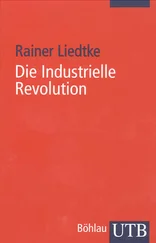Ein sozialer Aufsteiger ist Henkel nicht. Er ist in einer großbürgerlichen, gut situierten Hamburger Kaufmannsfamilie aufgewachsen, die zunächst in einer Villa in einem besten Hamburger Stadtteile und dann in einer herrschaftlichen Wohnung lebt. Er ist ein Bildungs- und Karriere-Aufsteiger. Er ist ein besonders cleverer Unternehmer seines Lebens, immer auf der Suche nach Chancen voranzukommen, sei es bei der Aufnahme in die Akademie, bei der Bewerbung bei IBM, beim Job im IBM-Pavillon in New York, in Indien und in Ceylon. Er hat eine Nase für Chancen, findet sie und nutzt sie entschlossen, mit einem starken Selbstvertrauen und einem Schuss Kühnheit. Von Typologien, wie sie Persönlichkeitsforscher bilden, hält Henkel nichts. Er erkennt sich aber in gleich drei Persönlichkeitstypen wieder: in dem Wettkampf-Typ, der besser als andere sein will; im ergebnisorientierten Typ, den gute Leistungen zu noch besseren motivieren, und in dem wachstumsorientierten Typ, der aus Fehlern und Rückschlägen lernt. Fehler habe er immer wieder gemacht, bekennt Henkel und zu verlieren, habe er nie gelernt. „Ich entdecke die Fehler anderer Leute“, sagt er, „weil ich mich darin selbst wieder erkenne. Das bezieht sich auf fast alles: auf Eitelkeit, Gefallsucht und Pingeligkeit“.
Auch sein nächstes Karriereziel hat der IBM-Nachwuchsmanager schon bestimmt. Er will Leiter einer IBM-Geschäftsstelle in Deutschland, am liebsten in seiner Vaterstadt Hamburg werden. Im Spaß sagt er gegenüber Freunden, er wolle einmal IBM-Generaldirektor von Deutschland werden. Noch erscheint das wie ein Traum.
Mancher seiner Vorgesetzten hat bereits seine schützende Hand über Henkel gehalten, sein großer Mentor wird Kaspar Cassani. Der Schweizer ist in diesen Jahren Vizepräsident der IBM-Europa in Paris. Henkel und Cassani kennen sich aus einer Zusammenarbeit in einer Taskforce. Auch hat Henkel Cassani bei einer Präsentation von COPICS in München beeindruckt. „Er schien geradezu einen Narren an mir gefressen zu haben“, schreibt Henkel in seinen Erinnerungen.
Eine entscheidende Weichenstellung kündigt sich an. Cassani beginnt den zehn Jahre jüngeren Henkel zu fördern, holt ihn zu sich nach Paris und betraut ihn damit, sein Sorgenkind, die Telefonanlage IBM 3750, die ein Flop zu werden droht, zu einem Erfolg zu führen. Henkel gelingt dies. Er rechtfertigt das Vertrauen, das Cassani in ihn gesetzt hat und wird zum Director of Operations befördert. In seinen Erinnerungen zeichnet Henkel von Cassani das Bild einer großen, bescheidenen Persönlichkeit, eines vorbildlichen, ehrgeizigen, zuweilen allerdings auch etwas rechthaberischen und zu selten lobenden Managers. Für Henkel wird Cassani beides: sein Vorbild und sein Vorgänger als Chef der IBM- Europa.
Neben Griechenland und dem Nahen Osten gehört auch Afrika zu dem neuen Verantwortungsbereich des Directors of Operations in Paris. 1978 klettert Henkel in der IBM-Hierarchie nach oben, wird Director of Operations für eine Reihe mitteleuropäischer Länder. Henkel reüssiert mit dem Konglomerat aus über 80 Ländern, für das er zuständig ist. Es ist vom Umsatz und Ertrag bedeutender als Deutschland. Er ist zu dieser Zeit bereits Vicepresident IBM-Europe. Cassani, mittlerweile Europa- Chef der IBM, gerät unter Druck. Die Konzernmutter akzeptiert nicht, dass in Deutschland weniger verdient wird als in anderen Ländern, erwartet, dass die Ergebnisse besser werden. Sie will Aktionen sehen. Cassanis Aktion liegt darin, der Zentrale Henkel als Troubleshooter für die IBM-Deutschland zu empfehlen. Henkel startet in Stuttgart als stellvertretender Vorsitzender, nach kurzer Einarbeitungszeit wird er Chef. IBM gewinnt unter Henkels Führung die an Nixdorf verlorenen Marktanteile zurück, klettert auf Platz fünf der in Deutschland meist geschätzten Unternehmen und auf Platz drei der am besten gemanagten Unternehmen. Nur im Wettbewerb mit SAP bleibt IBM zweiter Sieger. Bei den immer preiswerter werdenden PC spürt IBM den schärfer gewordenen Wettbewerb. Einen langfristig folgenschweren Fehler macht Henkel, als er an dem IBM-Betriebssystem OS2 festhält und Bill Gates abblitzen lässt, der ihn bei einem Besuch in Stuttgart bewegen will, Windows zu übernehmen.
Friedrich Wilhelm Sparberg, der aus dem in dem Konzern wenig geachteten Finanzbereich zum Chef der IBM-Deutschland aufgestiegen ist, wird 1985 von der US-Zentrale in Armonk ersetzt. Die deutschen Umsatz- und Ertragszahlen sind hinter den weltweiten IBM-Ergebnissen zurückgeblieben. Diese schlechteren Ergebnisse spiegeln allerdings zum großen Teil nur die deutschen Standortnachteile wider. Henkel meint in der Rückschau, es sei etwas unfair gewesen, Sparberg dafür verantwortlich zu machen. Er wolle auch nicht von sich behaupten, er sei besser gewesen als die Manager in der zweiten Reihe hinter Sparberg. Aber er habe einen guten Ruf in der Zentrale gehabt. Man habe ihm zugetraut, wieder Schwung in die IBM-Deutschland zu bringen.
Henkel macht die deutschen Standortnachteile, die hohen Lohn- und Lohnzusatzkosten, die hohen Steuern, die Mitbestimmung, die starren Flächentarifverträge, die 35-Stunden-Woche zu seinem Top-Thema. Henkels öffentliche Kritik über nicht mehr akzeptable Steuerlasten hat Erfolg. Stoltenberg, damals Finanzminister, sorgt dafür, dass durch ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA, die IBM und andere Firmen, auch deutsche Firmen mit Niederlassungen in den USA, von hohen, doppelt zu zahlenden Steuern befreit werden. In einer nervenzehrenden Auseinandersetzung mit der IG Metall erreicht er, dass IBM aufgrund einer Ausnahmegenehmigung den Vier-Megabit-Chip in Baden-Württemberg an sieben Tagen in der Woche produzieren darf. Die deutschen Standortnachteile kann Henkel jedoch nicht beseitigen. Er muss ein IBM-Werk umstrukturieren, drei andere aus Kostengründen schließen.
Die IBM-Zentrale räumt Henkel als Deutschlandchef große Freiheiten ein. Ohne Rückversicherung tritt er aus dem Arbeitgeberverband aus, verlegt den juristischen Sitz der deutschen IBM wieder nach Berlin, strukturiert das Werk in Hannover um. Die IBM-Europa steht hinter ihm, die Mitarbeiter sind wieder motiviert und die Wiedervereinigung sorgt für eine Sonderkonjunktur. Das ist ein Glücksfall für ihn. Die blendenden Ergebnisse werden Henkel gutgeschrieben. Mit hanseatischem Understatement hält er in seinen Erinnerungen fest: „Unter den gegebenen Voraussetzungen fiel der Erfolg allerdings so leicht, dass selbst Mickymaus als Chef der IBM Deutschland ihn hätte erzielen können“.
Das Deutschland-Geschäft boomt, aber der IBM-Konzern insgesamt gerät in eine Krise. Die Aktionäre machen dafür den damaligen IBM- Chef John Akers verantwortlich. Henkel befürchtet, mit Akers einen wichtigen Verbündeten zu verlieren.
Er erhält das Angebot, Vorstandschef eines weltweit renommierten deutschen Großunternehmens zu werden. Der Vertrag enthält jedoch eine Klausel, eine Art Maulkorberlass, die Henkel nachdenklich stimmt. Seine Ankündigung, möglicherweise die IBM zu verlassen, alarmiert die Zentrale. IBM-Boss Akers verspricht, Henkel bald zum Chef der IBM Europa zu ernennen. Henkel entschließt sich, bei IBM zu bleiben und dem deutschen Unternehmen abzusagen.
Lou Gerstner, Akers Nachfolger an der IBM-Spitze, löst das Versprechen ein, Henkel zum Chef der IBM Europa zu befördern. Henkel trägt nun die Verantwortung für neunzigtausend Mitarbeiter. Gerstner dramatisiert nach Henkels Einschätzung die Krise der IBM durch eine riesige Abschreibung, aber er zerschlägt die IBM nicht, wie es viele Analysten erwarten, sondern führt eine neue, zentralisierte Organisationsstruktur ein, die der Globalisierung besser entspricht. Henkel muss diese vertikale, hierarchische Verantwortungsstruktur, die die Länderchefs entmachtet, in Europa durchsetzen. Anders als Gerstner es in seinem Memoiren darstellt, habe er diese neue Struktur nicht boykottiert, sondern nur einige Auswüchse nicht mitgemacht. Dies habe ihm Gerstner jedoch als Obstruktion ausgelegt, wehrt sich Henkel gegen die Boykottvorwürfe.
Читать дальше