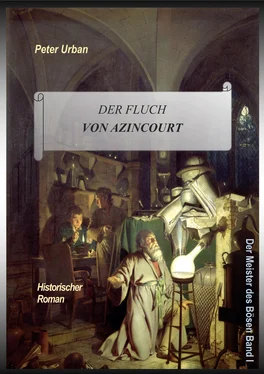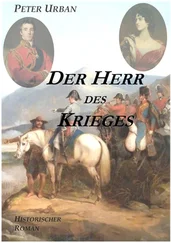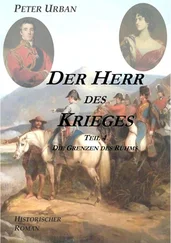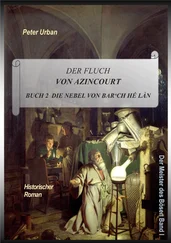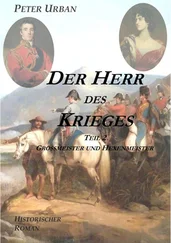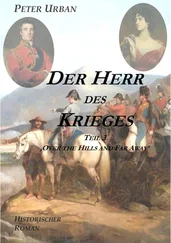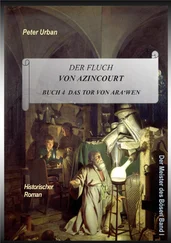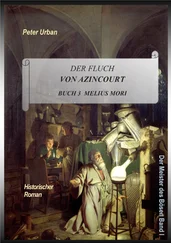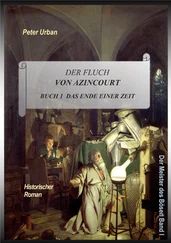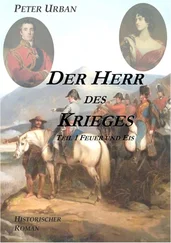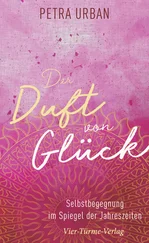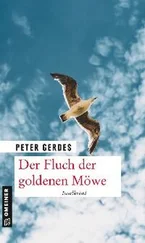Jean de Craon presste die dünnen, blassen Lippen fest zusammen, um nicht vor Zorn und Hass laut aufzuschreien. Amaury. Er verfluchte die Nacht, in der er das Balg gezeugt hatte. Schlechtes Blut. Undankbare Brut.
Richemont hatte den linken Arm um den widerlichen Sohn gelegt, mit dem er gestraft war und der es gewagt hatte ihn vor aller Welt den Teufel von Champtocé zu schimpfen. Die Rechte des Bruders von Yann de Montforzh ruhte auf der Schulter des farbenprächtig herausgeputzten, langhaarigen und mit Goldschmuck behängten Barbaren. Vermutlich einer aus Cornouailles, von der Atlantikküste. Dort verehrten sie heimlich immer noch die alten, verbotenen Götter. Sie beteten zu Bäume oder stehende Steine, heiligten Quellen und zündeten Feuer an, um reiche Ernte zu erwirtschaften. Amaury hatte sich feine Freunde gefunden. Für das heidnische Barbarenpack ließ er seine Familie im Stich. Er würde es schon bald bereuen.
Das Kind in den Armen des bitteren, alten Mannes nahm die Flüche und Gefühlsausbrüche seines Großvaters überhaupt nicht war. Es kannte Amaury de Craon lediglich aus wagen Erzählungen der Leute auf Champtocé. Die wenigen Geschichten über den Bruch mit dem Vater, murmelten sie hinter vorgehaltener Hand, wenn der Herr nicht auf der Festung war oder sich in seinen Gewölben mit seiner Forschungsarbeit beschäftigte.
Gilles’ Augen hingen nicht an Amaury de Craon, dem Objekt des Hasses und des Zorns seines Großvaters, sondern an einem Mann, den er noch nie zuvor im Leben gesehen hatte: Der Knabe beobachtete Aorélian de Douarnenez.
Gilles war ein aufgewecktes Kind. Er war für sein Alter ungewöhnlich groß und kräftig. Niemandem im Feldlager vor Rouen war aufgefallen, dass er erst elf Jahre alt war. In seinem prächtig verzierten Waffenrock und seinem Mantel aus dunkelgrünem Samt, einen Dolch im Gürtel und schwarze Reitstiefel aus feinstem Hirschleder an den Füßen schien er vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Viele der Knappen, die ihre Herren begleiteten, um das erste Mal den Krieg aus der Nähe kennen zu lernen waren in diesem Alter.
Gilles de Laval war ein Waisenkind. Sein Vater, der Baron Guy Laval-Blaison, de Craons Schwiegersohn, war vor ein paar Jahren auf der Jagd von einem Eber angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er elend an Wundbrand krepierte. Die Mutter, Marie de Craon, Jeans älteste Tochter, hatte die Geburt ihres zweiten Kindes nicht überlebt. Seit dieser Tragödie lebte Gilles bei seinem Großvater. Er hatte seine Eltern so wenig gekannt, dass der Verlust ihm nie bewusst geworden war. Und obwohl er von väterlicher Seite her einer der reichsten Erben Frankreichs und einer der bedeutendsten Baronien des bretonischen Herzogtums war, war seine ganze Welt doch Jean de Craon. Er liebte den Großvater abgöttisch. Die wagen Erinnerungen an die harte, strafende Hand des Vaters waren an dem Tag verblasst, an dem de Craon ihn aus der Festung von Machécoul nach Champtocé an die Ufer der Loire geholt hatte. Er hatte nie wieder an seine Zeit bei den Eltern zurückgedacht. Und mit dem Vermögen, das Jean ihm vermachen wollte, würde er eines Tages der reichste Mann von ganz Europa sein.
Während de Craon weiterhin seinen ältesten Sohn an der Seite des Bretonen Richemont fixierte und dabei leise Flüche murmelte, kniff Gilles die Augen zusammen. Er wollte besser erkennen können, was seine Aufmerksamkeit bereits im ersten Moment auf den jungen, unbekannten Mann mit der farbenprächtigen Kleidung, dem wunderschönen, schwarzen Kriegspferd und den langen, offenen Haaren gelenkt hatte. Als er Richemont umarmte, war der weite Ärmel an seiner Rechten nach oben gerutscht und die Sonne hatte sich in einer seltsamen, silbernen Armspange gebrochen.
Gilles hatte nicht geglaubt, dass ein solches Objekt wirklich existierte. Er hatte einmal in einer der vielen sonderbaren Handschriften des Großvaters darüber gelesen und angenommen es wäre nur eine Legende. Doch die beiden Totenköpfe und der quadratisch geschliffene Blutstein waren unverkennbar. Natürlich konnte er aus der Ferne die Sigillen selbst nicht entziffern. Der Unbekannte trug ein uraltes und mächtiges, magisches Amulett am rechten Handgelenk, so mächtig und selten, dass sich selbst in der reichen Sammlung von Jean de Craon kein Ähnliches fand.
In der Handschrift war genau erklärt worden, wie man mit Hilfe eines Sigillenreifs, im Verlauf einer Beschwörung, einen aufgebrachten Geist oder sogar einen Dämon beherrschte, der sich gegen den Beschwörer auflehnen wollte. Der Knabe legte seine Hand über die Hand des Großvaters. „Seht Ihr den mit dem leuchtendgrünen Waffenrock und den schwarzen Haaren“, unterbrach er die Gefühlsausbrüche des alten Mannes. Deutlich konnte er spüren, wie de Craon in seinem Zorn stoßweise atmete.
„Ein dreckiger Barbar, Gilles. Ein gefährlicher Häretiker. Einer der sich noch in seinem Schweinestall zur Nachtruhe legt und seine ungewaschenen Mägde unter den Sonnwendfeuern mit einem Hirschgeweih auf dem Kopf schwängert, um seinen heidnischen Götzen zu gefallen“, de Craon zog verächtlich die Augenbrauen hoch.
Champtocé lag am linken Ufer der Loire, unweit der Bischofsstadt Nantes. Kaum einen Tagesritt von seinem Stammsitz entfernt eröffnete ein undurchdringliches und von Wölfen verseuchtes Waldland den Weg hinein in das kleine Herzogtum Cornouailles. In den achtundfünfzig langen Jahren seines Lebens war er noch niemals über diese unsichtbare Grenze geritten und er würde es gewiss auch niemals tun.
Cornouailles gehörte den alten Göttern. Man munkelte hinter vorgehaltener Hand, dass es am Hof zu Concarneau noch immer weißgewandete, tätowierte Götzendiener gab, die bei allen Unternehmungen und politischen Entscheidungen das letzte Wort hatten. Der Herzog Ambrosius Arzhur Emrys war ein gefährlicher Ketzer. Er war mit einer teuflischen Hexe aus dem barbarischsten Landstrich der englischen Insel verheiratet, Wales. Es hieß, in den Adern der Hexe floss das Blut des legendären Pendragon Eudaf Hen, Urahn von König Arthur.
Man munkelte, die Hexe aus Wales könne Blitz und Donner beschwören und mit einem einzigen Blick töten. Ambrosius Arzhur Emrys selbst, der Barbarenfürst, der sich rühmte ein direkter Nachfahr von König Conan Meriadec zu sein, besiegte seine Feinde scheinbar, indem er Armeen schrecklicher, schwarzer Spektren auf sie hetzte. Alles Ammenmärchen!
Niemand beherrschte die Elemente und die heidnischen Götzendiener waren auch nur aus Fleisch und Blut. Im verfluchten Zauberwald von Paimpont, den man auch Brécheliant nannte und der auf der anderen Seite seiner Ländereien, in der Nähe von Laval und Craon lag, standen ständig Hunderte bis an die Zähne bewaffneter, dunkelhäutiger und tätowierter Langhaariger. Es waren Kriegsknechte des Herzogs von Cornouailles, die die Götzendiener beschützten, die im Wald lebten, weil sie selbst offenbar nicht fähig waren mit ihren sogenannten mächtigen Zaubern anderen den Zutritt in ihr finsteres Reich zu verweigern.
„Seht doch, was der Mann an seinem Arm trägt, Großvater“, wiegelte Gilles der Geschimpfe des Alten ab, „darüber haben wir zusammen einmal in der großen Handschrift gelesen, die Ihr aus Tours mitgebracht habt. Da stand, es würde mit Hilfe der magischen Schriftzeichen die es trägt, Geister und Dämonen bannen oder auch beherrschen.“
De Craon kniff seine Augen zusammen und betrachtete die Armspange des Erben von Cornouailles genauer. Der Blutstein leuchtete und funkelte in der Morgensonne. Er lag eingebettet in einem gleichschenkligen, spitz zulaufenden Kreuz, einem sogenannten Al-Tar-Kitar, dem Zeichen, das die israelitischen Hexer anstelle eines Pentagramms verwendeten. Sie nannten es den Urlaut und sein Schutz übertraf ihrer Meinung nach bei Weitem den Schutz, den das gewöhnliche Pentagramm gewähren konnte. Und die Sigillen auf dem Reif waren keine einfachen lateinischen Schriftzeichen. Soviel konnte de Craon erkennen.
Читать дальше