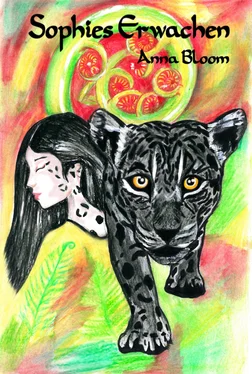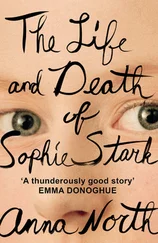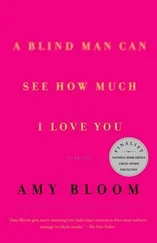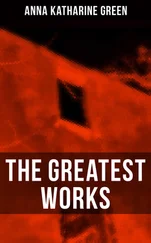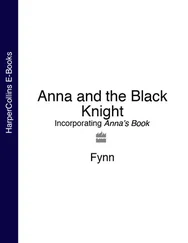1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 „Na, alles wieder ok?“, fragte sie mich besorgt.
„Geht schon wieder.“ Wir gingen gemeinsam wieder nach vorne. Amish stoppte die Motoren und kam zu uns.
„Wir sind jetzt in dem Gebiet, in dem sich die Wale zur Paarung aufhalten. Hier habt Ihr Ferngläser. Wenn ihr einen Wal seht, sagt Bescheid und wir fahren nah ran.“
Mit unseren Ferngläsern bewaffnet beobachteten wir das Meer. Ich sah weit und breit nur aufbäumende Wellen und fragte mich, ob ich einen Wal überhaupt erkennen würde, wenn sein Rücken dort zwischen den Wellen hervorlugte. Wie erwartet sah ich eine Viertelstunde nichts außer Wasser und ließ dann ermüdet mein Fernglas an der Küste entlangwandern. Einige Kilometer von Blenheim entfernt sah ich eine Stelle, die aussah als würde sie zum Festland gehören, aber es musste sich um eine Insel handeln. Am Fuße der Insel war alles goldgelb, weiter höher wuchs eine smaragdgrüne Vegetation den Berg hoch. Über der Vegetationsgrenze thronte ein schwarzer Kranz. Er sah wie der Krater eines Vulkans aus.
„Was ist das denn für eine Insel in der Nähe von Blenheim?“, fragte ich Stephanie, die neben mir pflichtbewusst die See nach Walen absuchte.
„Du sollst doch nach Walen Ausschau halten und nicht nach Inseln“, antwortete sie, ohne ihr Fernglas von den Augen nehmen.
„Meinst Du die mit dem Vulkanberg?“, fragte mich Amish, der zu meiner Linken auf dem Sitz kniete. So wie es aussah, hatte er genauso wenig Lust, stundenlang nach Walen zu suchen wie ich und freute sich über die Ablenkung.
„Ja genau.“
„Als ich Kind war, war ich ein paar Mal dort. Ich habe den Berg bestiegen und bin zum Kratersee hinunter gewandert. Das war wirklich schön. Der See ist satt grün, weil sich darin eine besondere Algenart angesiedelt und so stark vermehrt hat, dass das Sonnenlicht nicht durchdringen kann. Das Tollste war allerdings eine Stelle am Hang. Sie war so heiß, dass man darauf in einer Pfanne Spiegeleier braten konnte. Die Hitze kam direkt aus der Erde. An mehreren Stellen im Krater entwich heißer Wasserdampf aus der Erde. Da kochte das Wasser förmlich. Wie es dort jetzt aussieht, weiß ich nicht. Seit etwa zwanzig Jahren gehört die Insel ein paar Familien, die sie gemeinsam gekauft und sich angesiedelt haben. Ziemlich verrückt, dort im Krater Häuser zu bauen. Das hätte ich nicht riskiert.“
„Die Häuser stehen im Krater? Warum nicht am Meer?“, wunderte ich mich und kräuselte dabei die Stirn.
„Ich weiß es nicht. Niemand weiß es, weil die Leute sich mit uns Blenheimern nicht unterhalten.“
„Das ist sehr seltsam.“
„Das denken die Leute in Blenheim auch. Aber es ist ihre Entscheidung. Wenn sie aus der Gesellschaft ausbrechen und für sich sein wollen, dann ist das ok. Genau aus diesem Grund wanderten viele Menschen nach Neuseeland aus. Das macht unser Land aus. Wenn sie mit der Gefahr des Vulkans leben können, dann ist es ihre Entscheidung.“
„Sie haben Recht“, sagte ich zustimmend.
„Vielleicht müssen sie nicht heizen, wenn die Wärme direkt aus der Erde kommt. Den Vorteil hat der Vulkan sicherlich“, fügte ich lächelnd hinzu.
„Strom haben sie auch nicht. Zumindest sind sie nicht an die Stromversorgung der Stadt angeschlossen“, schaltete sich Stephanie in unsere Unterhaltung ein.
„Sie leben rückständig und ihre Kinder mobben alle anderen in der Schule. Das ist nicht richtig“, fügte Jessica hinzu.
„Kommt alle her. Ich habe einen Wal gesehen“, schrie Paula und hüpfte auf und ab vor Freude. Mein Puls schoss auch in die Höhe, bei dem Gedanken, dass direkt unter uns die Kolosse hin und her schwammen.
Amish ließ sich von Paula den Wal zeigen und schaltete den Motor ein, um die Verfolgung aufzunehmen. Er sah konzentriert und freudig erregt aus. Ich hatte sofort die Bilder von Kapitän Ahab und Moby Dick im Kopf: Amish, der sein ganzes Leben der Verfolgung von Walen widmete. Der Unterschied war, dass die Wale zum Schluss nicht getötet wurden. Die einzige Waffe, die wir dabei hatten, waren unsere Fotoapparate. Nichtsdestotrotz störten wir die Wale in ihrem Lebensraum. Amish schaltete den Motor aus. Der Rücken des Wales lag etwa zehn Meter vor uns. Er schaukelte im Wasser und spie plötzlich Wasser aus. Wir erschraken ein wenig bei dem Geräusch, das der Wal dabei machte. Amish lachte vergnügt. Je länger ich dem Wal zuschaute, desto mehr änderte ich meine Meinung über Walsafaris. Es war herrlich, dieses majestätische Tier aus der Nähe und in freier Wildbahn zu sehen. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Tier einmalig und schützenswert war. Die Vorstellung, es zu töten, erschien mir noch viel abscheulicher als zuvor. Ich hoffte, dass alle Touristen, die Amish mitnahm, das Gleiche empfanden wie ich. Als der Wal sich entschloss uns genügend bezirzt zu haben, tauchte er ab und zeigte uns dabei seine Schwanzflosse. Wir riefen „Oh“ und „Ah“ und fotografierten wie wild. Amish beobachtete uns zufrieden dabei. Ich glaube, er schaute gar nicht den Walen zu, sondern uns, und unseren glücklichen Gesichtern. Wahrscheinlich tat er das jedes Mal, wenn er hinausfuhr. Wir beobachteten noch zwei weitere Wale, bevor Amish uns wieder ans Festland fuhr.
Am nächsten Morgen wurde ich ausnahmsweise vom Wecker geweckt. Es war keine Musik von nebenan zu hören. Entweder verzichtete Stephanie auf ihre tägliche Zeremonie, weil ich gestern stinkig gewesen war oder sie schlief noch tief und fest. Wie dem auch war, ich fühlte mich wie neugeboren. Die Wale hatten wohl eine beruhigende Wirkung auf mich gehabt und als ich den Blick in meinem neu dekorierten Zimmer schweifen ließ, begann ich mich langsam wohl darin zu fühlen. Stephanie und ich hatten am Abend zuvor auf dem Nachhauseweg zwei Drucke für meine leeren Wände gekauft, die wir dann gemeinsam aufgehängt hatten. Barbara kam anschließend mit drei Pflanzen nach Hause, die wir harmonisch im Raum verteilten. Es war langsam so schön in meinem Zimmer, dass ich fast zu meiner gewohnten Faulheit zurückgekehrt wäre. Als ich Stephanie in ihrem Zimmer herumpoltern hörte, stand ich dann doch auf.
Nach einer schnellen Dusche und einem ausgiebigen Frühstück fuhren Stephanie und ich mit Barbara und Volker zum Weinberg. Das Weingut lag an einem Berghang hinter unserem Viertel. Es war noch angenehm kühl und schattig dort. Die Sonne blickte gerade erst hinter den hohen Bergen hervor. Mit ihren schwachen silbrigen Strahlen konnte sie noch nichts gegen die dünnen Nebelschwaden ausrichten, die knapp über der Erde hingen und die Weinpflanzen schützend umrankten.
Stephanie, Volker und ich stiegen aus dem Auto. Ich fror ein bisschen in meinen Shorts und bekam gleich eine Gänsehaut. Volker legte seinen Arm auf meine Schulter und führte mich zur ersten Weinstockreihe. Er nahm eine Rebe in die Hand und sagte stolz. „Sophie, das ist nach Stephanie unser zweites Baby.“
„Sei bitte nicht so melodramatisch“, stöhnte Stephanie und verdrehte peinlich berührt die Augen. Ich musste schmunzeln.
„Dieser Wein ist immerhin unsere Existenzgrundlage. Gäbe es ihn nicht, wären wir alle nicht hier. Zeig doch ein bisschen Respekt und Interesse. Irgendwann wirst Du das Gut übernehmen“, konterte Volker in einem mehr als väterlichen Ton.
„Das ist noch nicht entschieden. Und die Entscheidung über meine berufliche Zukunft werde ich selbst fällen“, fauchte Stephanie zurück. Ihre Resolutheit überraschte mich. So hätte ich mit meinem Vater nicht gesprochen. Andererseits hätte mich mein Vater nie in einen Beruf gezwungen. Diese Diskussion schienen die beiden schon mehrmals geführt zu haben, so schnell wie sie auf dieses Thema kamen und so verhärtet wie die Fronten waren. Beide schauten nun ernst und verletzt in verschiedene Richtungen und schwiegen. Sie glichen sich in diesem Augenblick sehr. Stephanie tat mir leid, weil sie unter diesem Druck stand. Aber andererseits konnte ich Volker auch verstehen. Stephanie war sein einziges Kind und das Weingut sein Ein und Alles, das er nicht in fremde Hände geben wollte. Um das peinliche Schweigen zu beenden, fiel mir nur eine blöde Frage ein.
Читать дальше