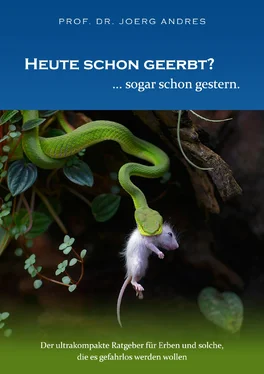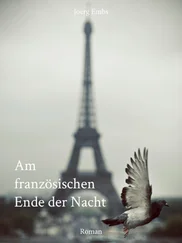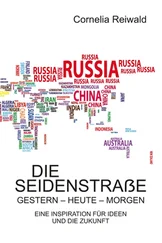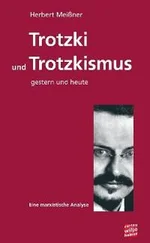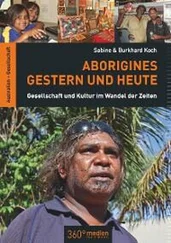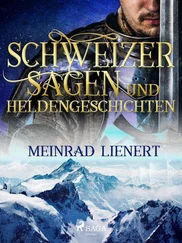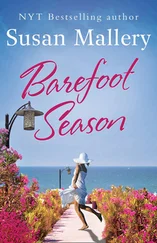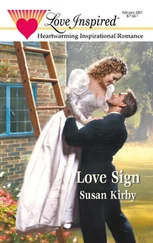Und vor allem: Was ist alles zu tun?
Und was zuerst?
Und was passiert, wenn ich nichts tue?
Sind dann die Probleme gelöst? Oder fangen sie erst an?
Fragen über Fragen.
Kapitel 2: Erste Schritte ins Erbendasein
Um hier mit einem grundlegenden Missverständnis von vornherein aufzuräumen:
Die Bezeichnung „Erbe“ hat zunächst einmal nur indizielle Bedeutung.
Die Tatsache, dass Sie im Testament, in einem Erbvertrag oder in einer ersten Benachrichtigung des Nachlassgerichts so bezeichnet wurden, heißt nicht in jedem Fall, dass Sie auch zwangsläufig „Erbe“ geworden sind. Gleiches gilt für die Bezeichnungen „Alleinerbe“ (= Erbe des gesamten Vermögens des Erblassers) oder „Vermächtnisnehmer“ (= jemand, der z.B. auf Grund eines Testaments Anspruch auf die Herausgabe eines Gegenstands gegen den Erben hat).
Gar nicht selten kommt es vor, dass in einem Testament gewählte Bezeichnungen wie „Erbe“ oder „Vermächtnisnehmer“ in unzutreffender Art und Weise verwendet werden.
Beispiel:
Der verwitwete Erblasser Egon (E) hat in seinem Testament geschrieben:
„Meine Erben sollen mein Sohn Söhnke (S) und meine Haushälterin Hermine (H) werden. Söhnke soll mein Haus und meinen Wagen sowie mein sonstiges Vermögen mit zwei Ausnahmen erhalten. Hermine soll für ihre treuen Dienste den großen Fernseher und die Perlenkette (Wert: € 10.000,00) meiner verstorbenen Frau bekommen.“
Während es sich bei S zweifellos um einen Erben handelt, wird H lediglich Vermächtnisnehmerin. Ihr Recht richtet sich also nicht direkt gegen den Nachlass, sondern gegen den Erben S, der den Vermächtnisanspruch der H erfüllen muss.
Umgekehrt können Sie aber auch Erbe werden, wenn Sie vom Erblasser in dessen letztem Willen gar nicht so bezeichnet wurden. Oft stellt sich erst nach geraumer Zeit und genauer Prüfung heraus, wer tatsächlich Erbe geworden ist, wenn z.B. die Umstände unter denen das Testament errichtet wurde, erstmals näher bekannt werden.
Andererseits ist es möglich, dass nachträglich ein jüngeres – maßgebendes – Testament (oder ein Erbvertrag) auftaucht und die zuvor getroffenen Feststellungen über eine Erbenstellung zugunsten anderer wieder zunichte gemacht werden. Das kann auch noch viele Jahre später passieren.
Demnach sollten Sie zunächst einmal die vom Nachlassgericht gewählte Bezeichnung als „Erbe“ als gegeben unterstellen, aber in Erwägung ziehen, dass sich hieran durchaus noch etwas ändern kann, wie noch zu zeigen sein wird.
Zuallererst sollten Sie also versuchen, sich einen möglichst umfassenden Überblick über Ihre eigene rechtliche Position in Bezug auf den Nachlass und über die Zusammensetzung des Nachlasses zu verschaffen.
Die eigene rechtliche Position
Die Nachricht des Nachlassgerichts hat bei Ihnen die Vorstellung geweckt, dass Sie bereits „Erbe“ geworden sind. Und das, obwohl Sie u.U. bislang noch nicht einmal etwas von dem Erbfall wussten.
Kann das sein?
Um es gleich vorweg zu sagen: Ja, das ist möglich und vom Gesetzgeber grundsätzlich auch so vorgesehen. So soll verhindert werden, dass der Nachlass – ggf. auch nur für eine kurze Zeit – „herrenlos“ wird, also niemandem zugeordnet werden kann.
Das deutsche Erbrecht sieht eine sog. Gesamtrechtsnachfolge (§ 1922 BGB) vor, d.h. bereits mit dem Todeszeitpunkt des Verstorbenen (= „Erblasser“) tritt dessen Erbe – ggf. auch mehrere Personen in sogenannter (Mit-) Erbengemeinschaft – in die rechtlichen Fußstapfen des Erblassers („Fußstapfentheorie“).
Selbst wenn Sie also erst vier Wochen nach dem Tod von Onkel Theo von der Erbschaft erfahren, kann es sein, dass Sie nominell bereits mit dessen Tod zu seinem Erben geworden sind.
Viel wichtiger ist aber: Was bedeutet das nun für Sie?
Der Eintritt in die Rechte des Erblassers
Wie die Fußstapfentheorie schon erkennen lässt, tritt der Erbe grundsätzlich in die Rechte des Erblassers ein.
Nicht zwangsläufig folgt der Erbe dem Erblasser aber in alle von diesem früher hinterlassenen rechtlichen „Fußstapfen“, also in alle Rechtspositionen.
Ausnahmen gibt es z.B. bei unvererblichen Vermögensrechten. Das sind solche, die mit dem Tod des Erblassers erloschen sind. Hierzu zählen z.B. das Nießbrauchsrecht (§ 1061 Satz 1 BGB) oder die Mitgliedschaft in einem Verein, wenn nicht die Satzung im Einzelfall etwas anderes bestimmt. Unvererblich sind auch Unterhaltsansprüche für die Zukunft (vgl. § 1615 Abs. 1 und § 1586 BGB).
Ebenso findet keine Rechtsnachfolge statt beim Eintrittsrecht des Ehegatten oder Lebenspartners in das Mietverhältnis (vgl. § 563 BGB), wenn der Ehegatte/Lebenspartner nicht Erbe des Verstorbenen wird.
Gleiches gilt bzgl. der Rechtsnachfolge in Gesellschaftsanteile an einer Personengesellschaft (GbR, OHG, KG). Auch hier folgt der Erbe nicht zwangsläufig dem Erblasser in dessen Rechtsposition nach.
Das kann jedoch gesellschaftsvertraglich so – oder anders – geregelt worden sein.
Außerdem kann es gravierende Abweichungen durch die Benennung von Bezugsberechtigten in Lebensversicherungsverträgen und Bankverträgen zugunsten Dritter (z.B. Sparbuch für den Enkel) geben.
Der Eintritt in die Pflichten des Erblassers
Auf der anderen Seite erfasst die „Fußstapfentheorie“ aber auch die negativen Seiten des Nachlasses.
Eine der gravierendsten Pflichten des Erben, die aus der Annahme der Erbschaft folgt und mittelbar durch den Erbschein dokumentiert wird, ist die Erbenhaftung.
Hierzu sagt § 1967 BGB (Erbenhaftung, Nachlassverbindlichkeiten), dass der Erbe für die Nachlassverbindlichkeiten haftet. Zu den Nachlassverbindlichkeiten zählen in erster Linie Schulden des Erblassers, aber auch Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen.
Diese Regelung birgt große Risiken für Sie als Erben.
Sie besagt, dass der Erbe für alle Verbindlichkeiten einzustehen hat, die in der Person des Erblassers entstanden sind. Insbesondere ist es ohne Belang, ob der Erbe diese Verbindlichkeiten bei Antritt der Erbschaft im Einzelnen kennt oder auch nur kennen kann, ob er sich danach erkundigt hat oder es schon am Versuch fehlte, zu erkennen, wofür er möglicher Weise einstehen muss.
Hiervon wird grundsätzlich auch keine Ausnahme gemacht. Es ist also nicht möglich, einzelne Verbindlichkeiten im Sinne eines „Cherry-Picking“ zu akzeptieren, andere aber nicht.
Die Zusammensetzung des Nachlasses
Eine sinnvolle und zutreffende Entscheidung über den Antritt des Erbes ist jedoch nur dann möglich, wenn alle entscheidungsrelevanten Tatsachen dem Erben auch bekannt sind. Welche das sind, kann nicht generell für alle Erbfälle vorhergesagt werden. Selbst ein vermeintlich positiver Nachlassbestandteil wie ein Sparkonto mit erheblichem Guthaben kann noch bemerkenswerte Risiken beinhalten.
Beispiel:
Erblasser Egon (E) war bereits einige Jahre vor seinem Tod Hartz-IV-Empfänger geworden. Nach seinem Ableben war Tochter Thea (T) überrascht, als das Sozialamt an sie herantrat und mehr als € 10.000,00 von ihr verlangte, die E zu Lebzeiten vom Sozialamt erhalten hatte. Das von T ererbte Sparguthaben von rund € 20.000,00 hatte man bei E noch als Schonvermögen qualifiziert und ihm damals belassen. Nachdem T das Guthaben geerbt hatte, sollte sie mehr als die Hälfte davon für erhaltene Sozialhilfeleistungen des E zahlen. Ihre Klage hiergegen blieb ohne Erfolg. Ihr wurde lediglich attestiert, dass ihre Ersatzpflicht als Erbin auf den Wert des Nachlasses begrenzt sei.
Da im Regelfall der Erblasser seinen zukünftigen Erben nicht umfassend über alle im Nachlass befindlichen Chancen und Risiken informiert haben wird, müssen Sie sich als Erbe selbst den erforderlichen Überblick verschaffen. Das ist oft nahezu unmöglich, weil dem Erben solange er keinen Erbschein besitzt im Regelfall gar kein Zugang zu den zuletzt vom Erblasser genutzten Räumen und darin befindlichen Unterlagen möglich sein wird.
Читать дальше