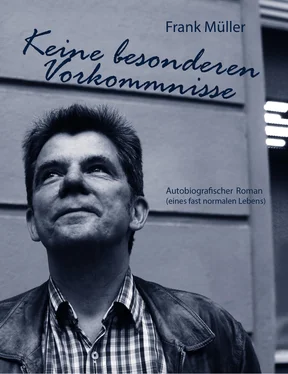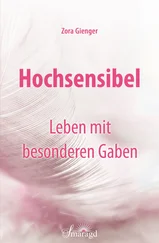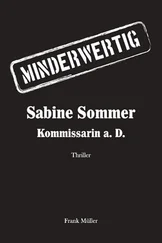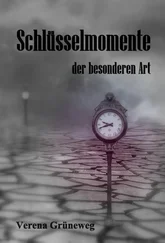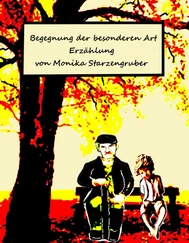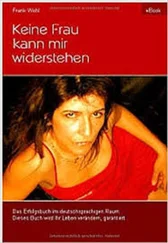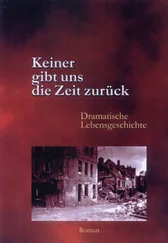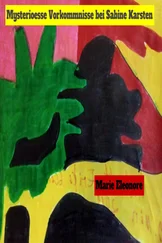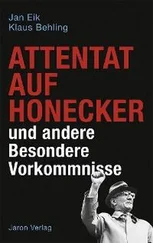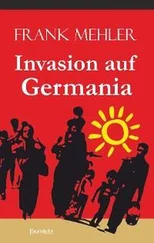Doch zurück an den Ort des bejubelten Fußballgeschehens. Der gepachtete Kleingarten in Heiligensee (die Anschaffung ging noch auf meinen Großvater mütterlicherseits, einen Zahnarzt, zurück) blieb unserer Familie noch gut dreißig Jahre nach dem Wegzug als Wochenendgrundstück erhalten. So gilt auch hier das Prinzip der Erinnerungsverschränkung. Der Garten spielte im weiteren Familienleben sowohl meiner Eltern als auch meiner Schwester eine wichtige Rolle. Von meinem Vater ist der zornige Ausruf überliefert, den er an Wochenenden ausstieß auf die ritualisierte Anregung meiner Mutter hin, man könne doch mal in den Garten fahren, um „zu kucken“. Es überschlug sich seine recht hohe Stimme dann nahezu bei der Entgegnung: „Wir fahren ja! Aber sag nicht: kucken. Wir graben fünfhundert Quadratmeter Sandfläche um.“ Und dabei fiel ihm vor Aufregung eine dünne Haarsträhne in die Stirn. Bei der Anschaffung eines Gartens wird oft vergessen, dass derselbe vor allem mit viel (oft lästiger) Arbeit verbunden ist. Die Vorstellung, die zu Beginn dominant ist, betrifft das Sitzen um einen fertig gedeckten Kaffeetisch bzw. das Herumstehen um einen Grill (die Bierflasche in der Hand), auf dem perfekte Steaks brutzeln. Die Gartenlogistik wird zunächst kaum berücksichtigt. Tatsächlich aber überwiegen doch das Organisieren, Einkaufen, Rasenmähen, Heckeschneiden (der Wegewart der Kolonie pflegte die korrekte Höhe der Hecken durch Anlegen eines goldenen Halskettchens zu ermitteln, ich hätte schießen mögen), Laubharken, Auskämmen von faulem Obst aus nassem Rasen und ähnlich ersprießliche Tätigkeiten. Nicht selten deutete meine Schwester ungehalten an, meine Frau und ich hätten doch auch mal „öfter eine Harke in die Hand nehmen“ können. Das tat ich dann mitunter (weil ich den Vorwurf nicht auf mir sitzen lassen wollte) auch bei ungünstigen Wetterbedingungen. Ich erinnere mich (und diesmal direkt) an einen kalten, regnerischen Novembertag, an dem ich finster entschlossen (und nicht ganz nüchtern) das letzte Laub und Faulobst des Jahres beseitigte. Mein Nachbar, ein stattlicher Kleingärtner par excellence (und ganz selten nur nüchtern), beobachtete mein Treiben vom Gartenzaun aus und wandte sich an mich mit dem legendären Satz: „Aber Herr Müller, dazu ist nun heute wirklich nicht das richtige Wetter.“ Und da hatte er Recht.-
Aber es gab auch selige Momente. Ich erinnere mich etwa daran, wie ich nach genau der richtigen Menge an Bier (nicht umsonst sprach Arno Schmidt vom strategisch sinnvollen Trinken) abends im Garten Gitarre spielte und sang, einige Gäste meiner Schwester dazu tanzten und Tanz, Gesang und Glück über den dunklen Heiligensee davonsegelten.
Hier also hatte alles mit mir begonnen, hier hatte ich zum erstenmal in die Jubelschreie der Fußballgemeinde eingestimmt, ohne jede Vorstellung davon, was sich in der Zukunft in diesem Garten zutragen würde. -
Wieder an einem Regentag, viele Jahre später, würde ich gemeinsam mit meinem Freund W. den Pachtvertrag für das Grundstück auflösen und die gelbe Laube für einen kleinen Erlös an einen der vielen Interessenten von den Wartelisten der Kleingartenvereine verkaufen. Eine Amtshandlung ohne große Emotionen (meine Schwester war mit ihrer Familie nach England gezogen und meine Frau und ich hatten uns in Berlin ein Haus mit Garten gekauft). Aber noch viel später, als der Garten für uns schon fast in Vergessenheit geraten war, bin ich immer mal wieder an die alte Stelle gefahren: Das Haus war in seiner Grundgestalt erhalten geblieben, erneuert, umgefärbt, der Garten ganz umgestaltet von fleißigeren Menschen, als wir es waren; und obgleich kaum ein Winkel aus alter Zeit erhalten geblieben war, schwebte über dem Garten noch – ach, ich weiß nicht was.-
Ich habe mich dafür entschieden, keine durchgängig chronologische Biografie zu schreiben, sondern einen thematisch orientierten Aufbau zu wählen, dessen einzelne Abschnitte freilich in sich chronologische Züge tragen. In diesem Kapitel nun soll es um Freundschaften gehen, ein schwierigeres Unterfangen, als man meinen möchte, soll sich doch keiner der Menschen, die in meinem Leben wichtig waren, ungerecht oder tendenziös dargestellt finden und die hier Fehlenden sich nicht übergangen fühlen. -
Meinen Freund G. haben wir bereits kennen gelernt: mit hölzernem Dreirad auf großer Fahrt zwischen den Eingangstüren der Häuser 14 und 15 der bürgerlichen Reinickendorfer Wohnstraße. Wir blieben die besten Spielkameraden für lange Zeit (uns erschien sie wie eine Ewigkeit), bis das Schicksal in Gestalt von G's späterer Geburt (er wurde erst nach dem damals gültigen Stichtag für die Einschulung sechs Jahre alt) uns trennte. Ich glaube mich noch erinnern zu können, wie sehr ihm die Tatsache zusetzte, nicht gemeinsam mit mit in die Schule gehen zu dürfen, sondern noch ein Jahr darauf warten zu müssen. Mir selbst hatte man die Schuleignung nur recht knapp zugesprochen, da ich die Frage der Prüferin, wie viele Räder denn ein Auto habe, mit „fünf“ beantwortete (ich hatte das Reserverad mitgezählt). G. und ich blieben in gutem Kontakt, wir traten sogar gemeinsam mit sieben Jahren in einen Reinickendorfer Fußballverein ein, aber die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Klassenstufen in der Schule hat für junge Leute etwas stark Trennendes. Es bilden sich ganz andere Freundeskreise (oder Feindeskreise) heraus, die Bezüge zu Lehrkräften unterscheiden sich, kurz: Die noch frischen Lebenserfahrungen weichen voneinander ab (und hier zähle ich noch nicht einmal diejenigen in den Elternhäusern mit). Im Grunde drifteten wir (trotz noch vieler gemeinsamer Begegnungen im Spiel, vor allem auf dem Hof unserer Wohnanlage) auseinander, machten unsere sehr persönlichen Erfahrungen, über die wir uns erst viel später austauschen sollten. G's Rolle in meinem Leben wurde eigentlich erst wieder wichtig, als wir uns zum Ende unserer Oberschulzeit regelmäßig in einer Stammkneipe zu treffen begannen („das Haus“), wo die Entscheidung getroffen wurde, nicht länger Mitglied in einem etablierten Sportverein bleiben zu wollen (ich hatte mittlerweile auch Handball im Verein gespielt), sondern einen eigenen Club im Freizeitbereich ins Leben zu rufen, dessen Präsident G. (der außerordentliche organisatorische Fähigkeiten besaß und besitzt) werden sollte. Dies geschah und der Verein wurde FC Triftpark genannt (nach dem Ort, an dem wir uns zu unverbindlichem Gekicke zu treffen pflegten). Er würde im weiteren Leben der meisten seiner Mitglieder eine wichtige Rolle spielen, aber dies ist nicht der Ort, um eine Chronik unseres selbstgegründeten Fußballvereins anzufertigen. G. und ich jedenfalls blieben uns von diesem Moment an wieder eng verbunden: organisatorische Absprachen, regelmäßiges Training, Spiele innerhalb des Freizeitfußballverbands, Vereinsmeierei, Vereinspartys; aber auch Aufleben des alten (eigentlichen) freundschaftlichen Kontakts zwischen G. und mir. Letzterer fand vor allem Ausdruck in der sogenannten „Herrenrunde“, zu welcher neben uns beiden noch zwei Klassenkameraden von G. gehörten (einer der beiden war auch einmal mein Klassenkamerad gewesen, aber so etwas ist ja bei den entsprechenden schulischen Verstrickungen keine Seltenheit). Diese „Herrenrunde“ besteht seit über vierzig Jahren, trifft sich etwa sechsmal im Jahr (nach dem Modus, dass immer der Reihe nach einer von uns mit der Bewirtung betraut ist), unternimmt Ausflüge und kleine Reisen und war und ist in unserem Leben eine Kostbarkeit. Innerhalb dieser Runde habe ich mich mit G. (der ein Meisterkoch ist) so oft und intensiv ausgetauscht, dass man schon nicht mehr zu unterscheiden weiß, was erlebt, was berichtet und was vielleicht nur eingebildet ist. Was ich aber weiß: G. ist nicht nur mein erster, sondern ein treuer, verlässlicher Freund, an den man sich stets wenden kann, wenn man im Alltag Hilfe braucht. Er ist eine feste Größe in meinem Leben. In unbestimmter Weise würde mir etwas fehlen, wenn es ihn nicht gegeben hätte.-
Читать дальше