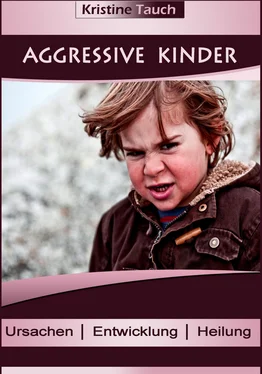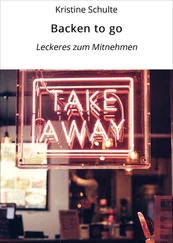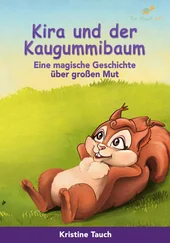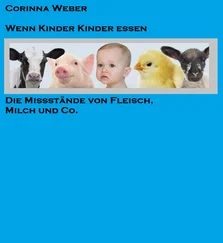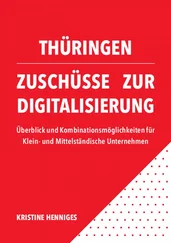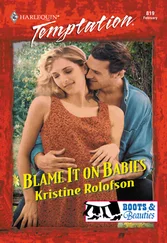Auch Ainsworth Beobachtungen von Kleinkindern in Uganda weisen darauf hin, dass das Interaktionsverhalten der Mütter entscheidend ist für die Bindungssicherheit ihrer Kinder (ebd.). Sie erarbeitete daraufhin Kriterien für die Beurteilung des Einfühlungsvermögens, die in Kapitel 2.2.1 besprochen werden.
Es ist auffällig, dass meist von einer Bindungsfigur gesprochen wird, die im Normalfall die Mutter ist. Heißt dies, dass das Bindungsverhalten auf eine einzige Person beschränkt bleibt? Bowlby unterscheidet die Kontaktpersonen des Kindes in eine Hauptbindungsfigur und mehrere Nebenbindungsfiguren, auf welche ebenfalls natürlicherweise Bindungsverhalten gerichtet wird (a.a.O., S. 279). Jedoch variiert die Art des gezeigten Bindungsverhaltens, je nachdem auf welche Figur es gerichtet wird. So stellt Bowlby fest, dass die Hauptbindungsfigur insbesondere in Anspruch genommen wird, wenn das Kind müde, hungrig oder krank ist, während andere Personen von dem Kind eher aufgesucht werden, wenn es gute Laune hat und spielen möchte. Darum schlägt Bowlby vor, den Terminus "Bindungsverhalten" nicht generell für soziale Verhaltensweisen zu benutzen beziehungsweise zwischen Annäherungen aufgrund von Bindungswünschen oder aufgrund von Spielaufforderungen zu unterscheiden (a.a.O., S. 280).
Es schließt natürlich das gemeinsame Spiel nicht aus, wenn eine Person für das Kind eine Bindungsfigur ist. Ich denke aber, dass eine wirkliche Bindungsfigur auch eine trost- und sicherheitsspendende Funktion haben muss. Ansonsten wären alle Personen, die das Kind kennt und mit denen es irgendwie in Kontakt tritt, als Bindungsfiguren zu bezeichnen.
Es besteht laut Bowlby eine Wechselbeziehung zwischen der Stärke der Bindung des Kindes zur Hauptbindungsfigur und der Vielfalt und Intensität weiterer sozialer Beziehungen. Die schwächer gebundenen Babys richten ihr Bindungsverhalten kaum auf andere Personen, sondern fast nur auf die Hauptbindungsfigur und umgekehrt werden Kinder mit einer starken Bindung vielfältige andere Beziehungen eingehen (a.a.O., S. 282f).
Dies könnte dadurch erklärt werden, dass die Kinder mit starker Bindung mehr Gelegenheit hatten Vertrauen aufzubauen und auch anderen Menschen dieses Vertrauen entgegenzubringen. Es stimmt nachdenklich, dass es gerade den Kindern, die keine ausreichende Vertrauensbeziehung zu ihrer Hauptbindungsfigur haben, so schwer fällt, andere Beziehungen einzugehen. Bowlby hat die Schwierigkeiten dieses Bezogenseins auf eine bestimmte Person erkannt und bezeichnet dies mit dem Begriff "Monotropie" (a.a.O., S. 283).
Neben den Bindungsfiguren spielen leblose Objekte eine wichtige Rolle für die kindliche Entwicklung. Auch hier zeigt Bowlby eine Korrelation auf, zwischen der Mutter-Kind-Bindung und Bindungen an Objekte, wie zum Beispiel ein Kuscheltuch oder ein weiches Spielzeug. Kinder, die zufrieden stellende Beziehungen erleben zeigen meist auch gewissen Objekten gegenüber Bindungsverhalten (a.a.O., S. 284f). Bowlby führt die Beobachtung von Provence und Lipton von 1962 an, dass Kinder, die ihr erstes Lebensjahr ohne eine Mutterfigur im Heim verbrachten, kein tröstendes Objekt besaßen und teilweise eine Abneigung gegen weiche Objekte zeigten (a.a.O., S. 285). Ein solches Objekt hat nach Bowlby Ersatzcharakter, es hat seine Aufgabe darin, das Kind zu trösten oder zu beruhigen, wenn die Bindungsfigur nicht anwesend ist (a.a.O., S. 286).
In Kapitel 2.1 habe ich die theoretischen Grundlagen der Bindungstheorie von John Bowlby erläutert. Eine Besonderheit dieser Theorie besteht in der Einführung eines Instinktbegriffes, der menschliches Handeln nach dessen arterhaltender Funktion erklärt. Das Verhalten des Menschen ist jedoch nicht allein instinktiv, im Sinne von genetisch, bestimmt, sondern abhängig von seiner Umwelt. Bowlby weist darauf hin, dass die verschiedenen Verhaltenssysteme, wie das Bindungs- und Pflegeverhaltenssystem, in ihrer Flexibilität bezüglich der Anpassung an verschiedene Umwelten, begrenzt sind. Das heißt, unter besonders ungewöhnlichen beziehungsweise ungewohnten Umständen setzt ihre Funktionsfähigkeit eventuell aus. In Bezug auf das mütterliche Pflegeverhalten sowie das kindliche Bindungsverhalten wird deshalb zu fragen sein, welche Umweltfaktoren das optimale Funktionieren dieser Systeme begünstigen und welche sie behindern.
Im Verlaufe der Anpassung an seine Umwelt bildet das Kind innere Arbeitsmodelle, die als Repräsentanzen seiner Interaktion mit den Bindungsfiguren gespeichert werden. Sie sind der Grundstein für ein tiefes Vertrauen gegenüber der Bindungsfigur und in die Welt im Ganzen. Auf diesen Arbeitsmodellen aufbauend entwickelt das Kind Bindungspläne, die sein Bindungsverhalten beeinflussen.
Im Unterschied zur Psychoanalyse gibt Bowlby den Freud’schen Energiebegriff auf und ersetzt ihn durch seine Instinkttheorie, womit er eine ethologische Erklärung für menschliches Verhalten integriert. Diese basiert auf der Annahme, dass der Mensch darauf angelegt ist, seine Verhaltenssysteme in einem gesunden Gleichgewichtszustand zu halten. Dieses Gleichgewicht ergibt sich aus einer gelungenen Anpassung an die Umwelt beziehungsweise der Eingliederung in Familie und Gesellschaft, welche als angenehm erlebt wird.
In Direktbeobachtungen entdeckten Robertson und Bowlby bei Kleinkindern, die eine längere Trennung von ihrer Mutter erlebten, drei Phasen des Verhaltens, Protest, Verzweiflung und Ablösung. Die Intensität dieser drei Phasen führte Bowlby zu dem Schluss, dass der Verlust der Mutterfigur zu schweren psychischen Störungen führen kann. Die Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung ist ein Prozess, der im ersten Lebensjahr des Kindes mittels gegenseitiger Interaktion ihren Anfang hat. Am Ende des ersten Lebensjahres ist das Kind deutlich auf die Person zentriert, die sich tagtäglich am intensivsten mit ihm beschäftigt. Je intensiver und zufriedenstellender diese Bindung sich entwickelt, umso offener wird das Kind dafür sein, auch andere Beziehungen einzugehen.
2.2 Methode und empirische Daten
Die empirische Fundierung der Bindungstheorie verdankt Bowlby der Psychologin Mary Ainsworth, die sich 1950 der von Bowlby geleiteten Forschungsgruppe an der Tavistock Klinik in England anschloss. Sie arbeitete mit an der Fragestellung, wie die Persönlichkeitsentwicklung von frühen Mutter-Kind-Trennungen beeinflusst wird (Bretherton 1999, S. 30f). Auch nach dieser dreijährigen Zusammenarbeit mit Bowlby und seinen Kollegen setzte Ainsworth ihre Arbeit an dem Thema Mutter-Kind-Bindungen fort. Während Bowlby den theoretischen Rahmen setzte, entwickelte Ainsworth Methoden und Messinstrumente und lieferte wichtige theoretische Beiträge für die Bindungsforschung; beide haben sich gegenseitig stark beeinflusst (a.a.O., S. 31 und 39).
Ainsworth begann Interaktionsschemen zwischen Mutter-Kind-Paaren in Uganda zu klassifizieren, nachdem sie von (dem in Kapitel 2.1.3 bereits erwähnten) James Robertson erfahren hatte, wie unterschiedlich die Reaktionen der beobachteten Kinder auf die Wiedervereinigung mit ihren Eltern nach einer Trennung waren (a.a.O., S. 34). Es folgte Ainsworth Baltimore-Studie, für die eines der wichtigsten Instrumente der Bindungsforschung entwickelt wurde, die „Fremde Situation“. Dieses dient der Zuordnung von Mutter-Kind-Paaren zu einem Bindungsmuster (siehe Kapitel 2.2.2). Die daraus resultierende Klassifikation von Bindungsmustern (Kapitel 2.2.2) und die Variable der mütterlichen Feinfühligkeit, die in Kapitel 2.2.1 erörtert wird, sind ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der heutigen Bindungstheorie.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше