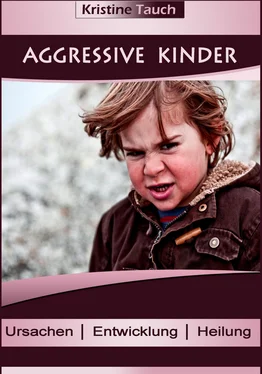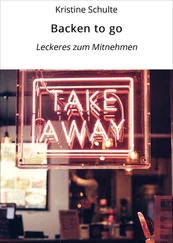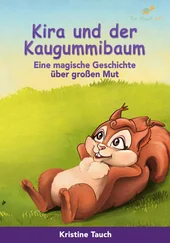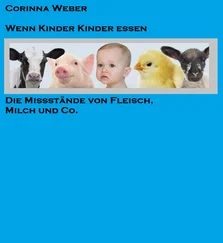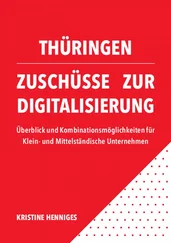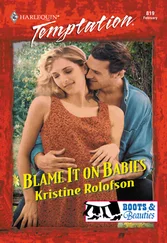So baut die Psychoanalyse, wie Brisch herausstellt, auf einer Triebtheorie auf, während die Bindungstheorie sich in der Begründung menschlichen Verhaltens auf Motivationssysteme, wie das Bindungssystem, beruft. Brisch zeigt außerdem, dass die Beziehung der Mutter zum Säugling in der Psychoanalyse als symbiotisch bezeichnet wird, das heißt, dass das Baby sich noch nicht von seiner Mutter abgrenzen kann und deshalb von Anfang an eine enge Bindung zu ihr besteht. Bowlby hingegen gibt die Vorstellung der anfänglichen Symbiose gänzlich auf und konstatiert, dass die Bindung zur Bindungsfigur erst im ersten Lebensjahr entsteht (Brisch 2000, S. 73).
Inge Bretherton zeigt weitere Gegensätze von Bowlbys und Freuds Denken auf. Freud ist der Meinung ein Baby könne zu viel Liebe von seiner Mutter empfangen. Bowlby hingegen geht davon aus, dass ein Kind so viel Zuneigung bekommen sollte, wie es verlangt und, dass es ein Zuviel davon nicht geben könnte. Problematisch wird die mütterliche Zuneigung nur, wenn sie als Kompensation unbewusster Feindseligkeit dient und somit als übertriebene Behütung bezeichnet werden kann, die nicht aus liebevollen Gefühlen resultiert (Bretherton 1999, S. 36). Bowlby kritisiert auch Anna Freuds Idee des infantilen Narzissmus, demzufolge die Ich-Strukturen des Kindes noch nicht ausreichend entwickelt seien, um Trauer zu erleben. Die Reaktionen eines Kindes auf längere Trennungen sind nach Bowlby ein eindeutiges Indiz für die Fähigkeit zur Trauer (a.a.O., S. 37). Die drei Phasen, die ein Kind bei der Trennung von seiner Bindungsperson durchmacht lassen sich mit den Phasen der Trauer bei Erwachsenen vergleichen, wie im folgenden Kapitel deutlich wird.
2.1.3 Bindungsverhalten bei Kleinkindern
„No form of behaviour is accompanied by stronger feeling than is attachment behaviour. The figures towards whom it is directed are loved and their advent is greeted with joy“ (Bowlby 1969, S. 209)
Das Interesse am Bindungsverhalten ergab sich für Bowlby aus Beobachtungen kindlicher Reaktionen in Zeiten des Getrenntseins von den Eltern, insbesondere von der Mutterfigur. Diese wird im Folgenden synonym mit "Mutter" oder "Mutterfigur" benannt, gemeint ist damit die Person, die sich am meisten mit dem Kind beschäftigt, die fast immer für es da ist. Diese Rolle kann natürlich auch von einem Mann, etwa dem Vater, ausgefüllt werden.
Von der World Health Organisation (im Folgenden WHO) bekam Bowlby 1950 die Gelegenheit auf diesem Gebiet zu forschen, er wurde beauftragt einen Bericht über die psychische Lage heimatloser (kriegsverwaister) Kinder zu erstellten. Er profitierte dabei von den Direktbeobachtungen James Robertsons, der seit 1948 mit Bowlby an dem Thema der frühen Mutterentbehrung und deren Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung arbeitete (Bowlby 1975, S. 9f).
Robertsons Beobachtungen betreffen Kinder im Alter von 15 bis 30 Monaten, die sich vorübergehend im Kinderheim oder Krankenhaus befanden und dort von fremden Personen betreut wurden. Er stellte fest, dass alle Kinder mit einer relativ stabilen Beziehung zu ihrer Mutter in der Zeit ihrer Abwesenheit drei Phasen durchliefen. Bowlby und Robertson nennen diese Phasen Protest, Verzweiflung und Ablösung.
Die Protestphase bezeichnet das suchende und verärgerte Verhalten des verlassenen Kindes, die zumindest solange anhält, bis nach Stunden oder mehreren Tagen die Hoffnung auf die Rückkehr der Mutter immer geringer wird und die stille Zeit der Verzweiflung einsetzt. Bowlby nennt das, einen Zustand tiefer Trauer und warnt davor ihn mit einem Nachlassen des Kummers zu verwechseln. Das Kind ist zu diesem Zeitpunkt passiv und resigniert. Mit der Phase der Ablösung beginnt es sich mehr für seine neue Umgebung zu interessieren und es wirkt wieder positiver. Dies ändert sich jedoch, wenn es Besuch von der Mutter bekommt, gegen die es sich zurückhaltend und uninteressiert verhält. Je länger ein solcher Heim- oder Krankenhausaufenthalt anhält, umso weniger interessiert ist das Kind, enge Bindungen einzugehen, aufgrund der vorhergehenden Enttäuschungen (Verlust der Eltern, Wechsel des Personals und so weiter). Materielle Dinge werden dann zunehmend wichtiger (a.a.O., S. 39f).
Aus diesem empirischen Material folgert Bowlby in seinem Bericht, dass der Verlust der Mutter eine wesentliche Variable für psychische Störungen ist (Bowlby 1975, S. 11). Die psychischen Vorgänge, die in der Beziehung zur Mutter und in Trennungssituationen wirksam sind untersucht Bowlby im ersten Band seiner Trilogie, da über diese im Rahmen des Berichtes für die WHO nichts in Erfahrung gebracht werden konnte (a.a.O., S. 10).
Zunächst betrachte ich Bowlbys Darstellung von Verhaltensweisen, die den Säugling befähigen eine enge Bindung einzugehen und aufzubauen. Nach Bowlby ist das Neugeborene bereits mit Verhaltenssystemen ausgestattet, die durch verschiedene Reize aktiviert, beendet, verstärkt oder geschwächt werden. Diese noch primitiven Systeme sind die Grundlage für die spätere Entwicklung von Bindung, so zum Beispiel das Schreien, Saugen, Festhalten und die Orientierung (a.a.O., S. 247). Es finden sich beim Säugling bestimmte prädispositionelle Vorlieben, die im Laufe der Entwicklung spezifischer werden und das Bindungsverhalten unterstützen. Bowlby bezeichnet dies als die "Verhaltensaurüstung des Neugeborenen" (a.a.O., S. 250) und nennt Reaktionen auf visuelle und akustische Reize, die in Versuchen bei mehreren Säuglingen beobachtet wurden (a.a.O., S. 251). Es zeigte sich, dass wenige Tage alte Kinder leise Geräusche lauten vorzogen sowie an gezeichneten Mustern mehr Interesse zeigten als an Farben. Diese Vorlieben werden im Laufe der Zeit spezieller, wenn insbesondere Bilder von menschlichen Gesichtern sowie die menschliche Stimme präferiert werden (a.a.O., S. 251).
Warum aber konzentriert sich der Säugling ab einem gewissen Alter besonders stark auf eine bestimmte Person? Dass diese Person meist für die Nahrungsgabe zuständig ist, verfestigte die gängige Meinung, diese sei ausschlaggebend für die kindliche Zuwendung. Bowlby weist aber darauf hin, dass es hierfür keine Beweise gebe und, dass die Entwicklung der Mutter-Kind- Bindung in der Interaktion beider miteinander begründet sei. Das Baby lernt, dass es mit seinem Verhalten (die Mutter beobachten, anlächeln etc.) bestimmte Resultate erzeugt (Zuwendung der Mutter). Dieses Feedback, so vermutet Bowlby, gelangt zu seinen Kontrollsystemen und wird dort verstärkt. Umso mehr die Mutter auf das kindliche Kontaktaufnehmen reagiert, umso mehr wird dieses weiterhin ein solches Verhalten zeigen (a.a.O., S. 254). Die Zentrierung auf eine Person folgt deshalb aus dem zeitlichen Umfang und der Intensität des Aufeinandereingehens. Bowlby beschreibt vier Vorgänge, die dazu führen, dass eine bestimmte Person als Bindungsfigur gewählt wird. Erstens bevorzugt der Säugling spezielle menschliche Reize, wie zum Beispiel Gesichter oder hohe menschliche Stimmen. Zweitens lernt er schnell, die Person, die ihn versorgt, von anderen zu unterscheiden. Drittens besteht eine angeborene Tendenz der Annäherung an Bekanntes und viertens erfährt der Säugling aus seiner Umgebung soziale Verstärkungen für bestimmtes Verhalten (a.a.O., S. 287).
Bowlby verwirft hiermit die psychoanalytische Sekundärtriebtheorie, wonach das Bindungsverhalten vor allem durch Nahrung verstärkt wird. Er nennt als wirksamsten Verstärkerreiz die Reaktion, die die Mutterfigur auf das soziale Verhalten des Kindes folgen lässt. Explizit ist damit die Bereitschaft der Mutter auf das Schreien des Kindes einzugehen sowie aktiv den Interaktionsprozess zu fördern gemeint (a.a.O., S. 288). Diese interaktive Dimension umfasst die Nahrungszufuhr ebenso wenig wie körperliche Pflege. Zur Unterstützung dieser Aussage führt Bowlby einige Untersuchungen in israelischen Kibbuzim an, wo die Kinder den größten Teil des Tages in einer Kindergruppe verbringen und deren physische Bedürfnisse von den Metapelot, den Pflegerinnen, befriedigt werden. Dennoch zeigen die Untersuchungen übereinstimmend, dass eine starke Bindung der Kinder an ihre Eltern besteht, mit welchen sie die Abende und Wochenenden verbringen und dass die Beziehung zu ihrer jeweiligen Metapelet wenig emotional ist (a.a.O., S. 289f.).
Читать дальше