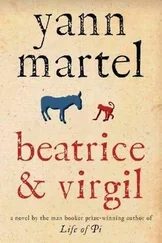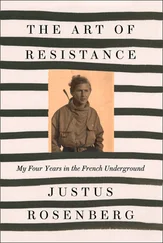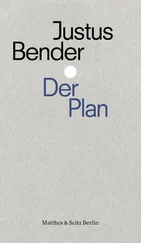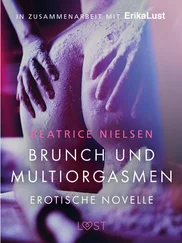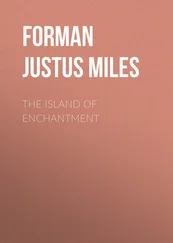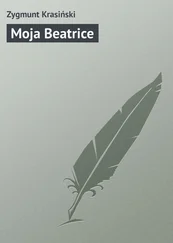„Entschuldigen Sie“, sagt er ein wenig zu laut, worauf die Frau ängstlich zusammenzuckt. „Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich glaube nur, Ihre Plastiktüten da, also, lange können Sie die nicht mehr so transportieren, die Henkel werden gleich reißen.“
Er zeigt auf die Tragetaschen, den Fünfhunderter in seiner rechten Hand verborgen.
„Jaja, danke“, sagt sie ein wenig ratlos und blickt sich Hilfe suchend um.
Das ist der Moment, auf den er gewartet hat. Schnell lässt er den Geldschein in einer der Taschen verschwinden, so, dass er nicht aus Versehen herausfallen kann.
„Ich wollte Sie nur warnen, nicht, dass Ihnen das hier alles gleich auf die Straße fällt. Vielleicht sollten Sie sich ein paar neue Tüten besorgen oder einen großen Karton, den man auf den Gepäckträger stellen kann.“
Mit diesen Worten verabschiedet er sich von der Frau, die sich nicht besser zu helfen weiß, als ihr Rad nun deutlich langsamer weiterzuschieben. Sie ahnt noch nichts von dem Geld. Natürlich nicht. Aber irgendwann wird sie es finden.
Er lächelt zufrieden und wünscht sich, dass Marie bei ihm wäre. Es kribbelt wieder in seinem Bauch. Ja, er ist verliebt! Und gerade hat er fünfhundert Euro verschenkt, und eine alte, arme Frau sehr glücklich gemacht. Ein berauschendes Gefühl. Schade nur, dass er nicht ihren Gesichtsausdruck sehen kann, wenn sie den Schein findet.
Wer wird nun sein nächstes Opfer? Er sieht eine junge Mutter in Punkerklamotten. Sie albert mit drei Freunden herum, die sich brennend für Fotos auf ihrem Handy interessieren und nicht so aussehen, als gingen sie einer geregelten Arbeit nach. Der kleine Junge im Buggy neben ihr, vielleicht ein Jahr alt, zerbröselt andächtig ein Brötchen. Er sieht übermüdet aus, nicht mehr lange, dann werden ihm die Augen zufallen. Wie zufällig bewegt er sich auf die kleine Gruppe zu. Neben dem Kinderwagen lässt er seinen Schlüssel fallen, hebt ihn auf und drückt dabei dem Kind einen zusammengerollten Fünfhunderter in die freie Hand. Weder die Mutter noch die jungen Männer bemerken es.
Schnell geht er weiter und bleibt erst an einem Zeitungsstand in etwa dreißig Metern Entfernung stehen. Er kauft die Frankfurter Allgemeine , über deren Rand er die Punker heimlich beobachtet. Immer noch schaut niemand nach dem Kleinen, der den Geldschein mittlerweile auseinandergefriemelt hat und nun mit der Zunge dessen Geschmacksrichtung erkundet.
„Scheiße, Mann!“
Endlich! Einer der Freunde hat das Geld entdeckt. Er schubst die anderen beiseite und stürzt auf den Buggy zu. Der Junge, sichtlich erschrocken, brüllt los.
Sofort springt seine Mutter herbei. „Hey, du Arsch, was soll … Scheiße, was ist das denn?“ Sie reißt ihrem Sohn den Fünfhunderter aus den Händen, worauf dieser herzzerreißend zu schluchzen beginnt. Aber das kümmert seine Mama wenig. Sie starrt den Geldschein an. „Ich … ich werd bescheuert!“, stammelt sie, während sich ihre Freunde vor Lachen nicht mehr einkriegen.
Einige Passanten bleiben stehen und beobachten verwirrt den Vorfall. Empört schütteln sie den Kopf. Diese Verrückten! Und das arme Kind!
Er schmunzelt und faltet die Zeitung zusammen. Geld heimlich zu verschenken ist nicht nur aufregend, es ist auch ausgesprochen amüsant. Was Dr. Sein wohl hierzu sagen würde?
Der Gedanke, wie sein ehemaliger Therapeut eine bestimmte Angelegenheit beurteilen könnte, hat sich wieder einmal in sein Bewusstsein geschlichen. Sofort ist ihm schmerzlich klar, dass er ihm nie wieder etwas von sich erzählen wird. Warum nur kann er sich nicht von diesem dummen Wunsch befreien, Dr. Sein überraschen und beeindrucken zu wollen? Wenn es einen Menschen in seinem Leben gibt, der seinen Respekt nicht verdient, dann ist es Dr. Sein.
Ein Kellner findet fünfhundert Euro in einer Tasse auf seinem Tablett mit schmutzigem Geschirr, eine Gruppe osteuropäischer Straßenmusiker entdeckt gleich zwei Scheine in ihrer Sammeldose. Das war ein Versehen, ihnen war eigentlich nur einer zugedacht, aber das Geld ist neu und wenig griffig, die Scheine lassen sich nicht gut voneinander trennen. Vor dem Schwarzen Stern steht ein fassungsloser Postbote. Sein Geschenk klemmt in der Fahrradklingel seines Dienstfahrzeugs, einem dicken gelben Drahtesel, ungefähr hundert Jahre alt und eine Tonne schwer. Er hält den Schein hoch in die Luft und dreht sich lachend im Kreis, wobei seine Augen die Umgebung absuchen. Glaubt er, es handelte sich um einen schlechten Scherz? Wonach sucht er, nach einer versteckten Kamera?
Überall auf dem Römerberg werden Menschen von dem unerwarteten Geldsegen überrascht. Eine euphorische Stimmung breitet sich aus. Neugierige Blicke in alle Richtungen. Wer ist der Wohltäter? Gibt es noch mehr Scheine zu entdecken? Die Japaner reden wild durcheinander und knipsen die glücklichen Finder, die ihnen stolz ihre Geldscheine präsentieren. Wahrscheinlich diskutieren sie, ob dem Ganzen so etwas wie eine deutsche Tradition zugrunde liegt. Nach einer knappen Stunde trifft die Presse ein, beinahe zeitgleich mit der Polizei. Menschen werden interviewt. Wer hat was gesehen? Gibt es zuverlässige Informationen? Schnell macht das Gerücht die Runde, ein bekannter Aktionskünstler könnte der Gönner sein. Wie war noch gleich sein Name?
Justus lacht. Geld verschenken als Kunstprojekt! Na ja, so kann man es vielleicht auch sehen.
Ein Fünfhunderter wird zeitgleich von zwei Männern gefunden, einer vielleicht gerade mal zwanzig, der andere im Rentenalter. Ein heftiger Streit bricht vom Zaun, und nun schlagen sie mit den Fäusten aufeinander ein. Sie hatten Glück, aber sie konnten es offenbar nicht teilen. Heißt es nicht, geteiltes Glück sei doppeltes Glück? Geld allerdings verdoppelt sich nicht, wenn man es teilt. Es ging den beiden also wohl nur ums Geld und nicht ums Glück. Ihr Pech. Nun haben sie die Gesetzeshüter am Hals, die sie auseinanderzerren, ihre Personalien aufnehmen und die fünfhundert Euro erst mal beschlagnahmen.
Aufmerksam verfolgt er das Geschehen auf dem Römerberg, spaziert dabei auf dem Platz hin und her, bis er einen freien Tisch in einem Straßencafé entdeckt. Er setzt sich und bestellt einen Milchkaffee.
Dieses ganze Theater ist seine Inszenierung, ein Experiment mit zwanzigtausend Euro in vierzig Scheinen. Das Resultat fasziniert ihn. Eigentlich hatte er vermutet, nur Einzelreaktionen beobachten zu können, doch nun ist eine ganze Menschenmenge involviert. Einige Passanten machen mit ihren Handys Fotos und tippen sodann eifrig auf dem Display herum. Wahrscheinlich verbreiten sie die Neuigkeit im Internet, bei Facebook und über Twitter. Wie viele Menschen werden von dem Vorfall erfahren? Wird man davon in der Tagesschau berichten? Wird es in der FAZ stehen?
Nachdenklich rührt er einen Löffel Zucker in seinen Kaffee. In Gedanken nehmen seine Freunde und Verwandten an seinem Tisch Platz, die Lebenden wie die Toten, einer nach dem anderen. Sie reden zu ihm, bewerten seine Tat. Ist sie gut oder böse? Du bist ein Hans-guck-in-die-Luft!, würde sein Großvater sagen. So leichtfertig geht man nicht mit Geld um. Ein bisschen mehr Verantwortung, bitte!
Jaja, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Er hat auch schon vorher größere Summen gespendet, zum Teil sogar deutlich mehr als zwanzigtausend Euro. Aber er hat es in aller Öffentlichkeit getan, hat sich dabei von der Presse ablichten lassen. Seine Spenden an wohltätige Organisationen waren alles andere als selbstlose Akte der Barmherzigkeit gewesen. Es gehörte schlicht zum Marketing eines bedeutenden Unternehmens dazu. Tue Gutes und rede darüber. Das war die Devise. Geld zu verschenken, ohne einen Gegenwert dafür zu erhalten, das war ein Sakrileg. Dafür konnte man womöglich entmündigt werden. Besonders, wenn man, wie er selbst schon mal, in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie gewesen war.
Читать дальше