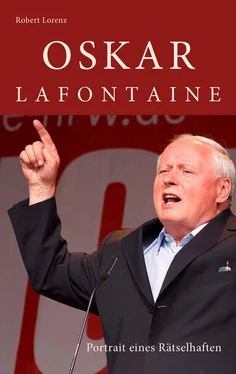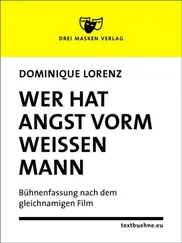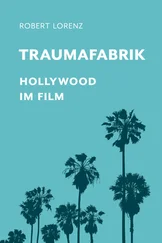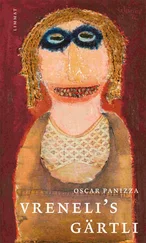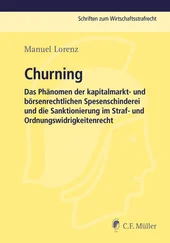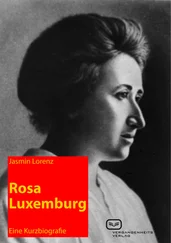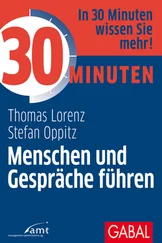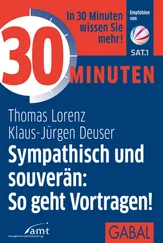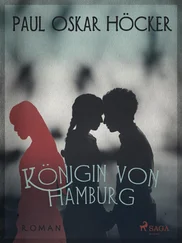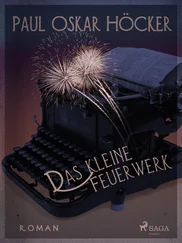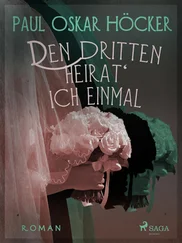Insgesamt verfügt Lafontaine während seiner Zeit als saarländischer Ministerpräsident also über ein extrem schlagkräftiges, in sich komplementäres Team, das seine Schwächen ausgleicht und ihm viel Freiraum für politische Aktivitäten jenseits seiner unmittelbaren Amtspflichten verschafft. Denn er mag zwar ein politischer Tausendsassa sein, ein Alleskönner ist er aber dennoch nicht. Auch hier gilt: Dass politische Anführer der Unterstützung durch einen Mitarbeiterstab bedürfen, ist Standard nahezu jeder Herrschaftspraxis und schon immer so gewesen. Doch gibt es stets Unterschiede in der Funktionstüchtigkeit solcher „Küchenkabinette“, die erheblichen Einfluss auf Bestandskraft und Qualität von politischer Führung besitzen.54 Lafontaine beweist also entweder die Fähigkeit oder hat einfach das Glück, lange Zeit auf taugliches Personal zurückgreifen zu können.
Daneben setzt Lafontaine weiterhin auf die Medien als Machtinstrument. Noch ehe Parteifreunde und offizielle Gremien von seinen Ideen, Vorhaben und Forderungen erfahren, teilt er sie Journalisten mit. Das sorgt zwar häufig bei seinen Parteifreunden für unliebsame Überraschungen, doch hat er damit naturgemäß den Überraschungsmoment auf seiner Seite und sieht sich zudem nicht durch die zeitaufwändige Kommunikation mit anderen Ebenen blockiert. Nicht viele andere Politiker haben den inzwischen durchaus üblichen Austausch von Information gegen Publizität, der zwischen Politikern und Medienmachern stattfindet, derart häufig und drastisch praktiziert wie Oskar Lafontaine; Gerhard Schröder und Joschka Fischer mag dies noch gelungen sein. Davon zeugen insbesondere Lafontaines zahlreiche Gespräche mit dem in den 1980er und frühen 1990er Jahren auflagenstarken Spiegel : „Der Druck wird immer stärker“55, „Die Koalitionsfrage unverkrampft sehen“56, „Jetzt habe ich den Schnuller ausgespuckt“57, „Saarland – Asyl für linke Lehrer?“58, „Bonn hat heute kein Konzept“59, „Ich allein bin nicht die Mehrheit“60, „Wenn wir eine Mehrheit hätten…“61, „Ich habe nicht gekniffen“62, „Die traditionellen Rollen aufbrechen“63, „Man muß auch anstößig sein“64 – um hier nur einige zu nennen. Mit solchen Stellungnahmen in Leitmedien inszeniert er sich als Intellektueller unter den Politikern, als Impulsgeber und Reformer; zugleich setzt er andere Akteure unter Zugzwang, um seinerseits am Ende als weiser Avantgardist da zu stehen, wohingegen der übrige Politikertross ihm lediglich nacheilt.
Merkwürdigerweise ist Lafontaines unstetes Familienleben kein Malus für den Fortgang seiner Politikkarriere. Eigentlich müsste man annehmen, das mit inzwischen drei Trennungen auf den ersten Blick instabile Familienleben habe Lafontaine stark belastet. Schließlich kann man sich leicht vorstellen, wie viel emotionale Kraft solche Brüche in Partnerschaften beanspruchen können, wie schwer sie überdies als prominenter, noch dazu in staatlicher Verantwortung stehender Persönlichkeit der Öffentlichkeit zu vermitteln und unter dem Druck der Medienaufmerksamkeit auszuhalten sind. Zumal, dass im katholisch geprägten Saarland ein seit 1988 zweifach Geschiedener mit absoluten Mehrheiten regierte, ist zumindest nicht selbstverständlich, wenn man die Religionszugehörigkeit nicht endgültig als wahlrelevanten Faktor ignorierte. Im Gegenteil verschaffte ihm dieser Umstand vermutlich sogar Sympathien: Denn die Bürger – somit auch: Wahlberechtigten – sahen in ihm keinen leblosen Politikroboter, kein selbstverleugnendes, gefühlskaltes Konstrukt, sondern einen Menschen mit Fehlern, die dieser auch als solche freimütig eingestand65, statt sie hinter unechten Inszenierungen zu verbergen.
War eine offizielle Trennung nicht viel besser, weil aufrichtiger als eine künstlich und lediglich für die Öffentlichkeit, somit aus wahltaktischen Gründen aufrechterhaltene Partnerschaft? Ließen sich in den Eheproblemen des Oberbürgermeisters bzw. Ministerpräsidenten nicht auch Parallelen zu eigenen Schwierigkeiten erkennen? Lafontaine führte kein Leben nach erzkatholischen Maßstäben; aber er schien sich zumindest an moralische Richtlinien zu halten, achtete via Eheschließung und -scheidung wenigstens auf einen aufrichtigen Familienstand, schien in seiner privaten Familienpolitik nachvollziehbare, ehrliche Entscheidungen zu treffen, trotz seines Freiheitsdrangs immerhin kein zügelloser Hallodri zu sein. Damit fügte er sich ganz gut in eine Gesellschaft, in der Scheidungen häufiger wurden und die formelle Zugehörigkeit zur Kirche abnahm. Lafontaines Partnerschaftsverhalten dürfte ihn daher eher entlastet haben; schließlich kann es genauso oder noch anstrengender sein, eine Beziehung nur noch für die Augen der Öffentlichkeit als strategische Camouflage aufrechtzuerhalten – die sich in der Geschichte der Bundesrepublik sicherlich nicht wenige Politikerpaare zum Leidwesen der gesamten Familie angetan haben.
Die wundersame Ablehnung des Parteivorsitzes
Am meisten dürfte jedoch für Lafontaines Zeit in den 1980er Jahren erstaunen, dass er nicht damals schon SPD-Parteivorsitzender geworden ist. Willy Brandt hätte ihn, seinen „Lieblingsenkel“, wohl in der Tat gerne an der Parteispitze als unmittelbaren Nachfolger gesehen;66 doch es wird Hans-Jochen Vogel – der mehr als 17 Jahre älter als Lafontaine ist, als SPD-Kanzlerkandidat in der Bundestagswahl 1983 gegen Helmut Kohl verlor und seit 1983 die Bundestagfraktion führt. Ganz abwegig ist Vogels Kür freilich nicht, schließlich gilt seine Kanzlerkandidatur 1983 als pflichtbewusste Aufopferung für die kriselnde Partei, außerdem scheinen innerhalb der SPD die Sympathien ihm zunächst noch stärker als Lafontaine zu gelten, gegen den die über 35-jährigen Parteimitglieder mehrheitlich Vorbehalte haben.67 Hier zeigt sich erstmals deutlich Lafontaines auf den ersten Blick gänzlich unkarrieristischer Hang zum Zaudern. Warum greift er damals nicht einfach zu? Ist der Bundesparteivorsitz nicht etwa das Ziel seiner Bestrebungen – eines Mannes, dem man ständig Züge absolutistischen Herrschaftsanspruchs nachsagt und der sich dadurch in eine historische Traditionslinie mit August Bebel, Friedrich Ebert und Willy Brandt stellen könnte? Muss es da nicht geradezu verrückt wirken, den Parteivorsitz auszuschlagen?
Doch man kann es auch anders sehen: Erstens befindet sich die SPD damals in einem Dauertief – wieso also soll sich nicht zuerst Vogel in dieser misslichen Lage verbrauchen, um dann von einem frischen Hoffnungsträger Lafontaine abgelöst zu werden? Zweitens benötigt er Amtsinhaber mit dem Profil Vogels als Kontrastfolie, durch die seine Wirkung umso positiver ausfällt. Denn der akribische, pflichtbewusste und fleißige Vogel ist in vielem das Gegenteil von Lafontaine. Das macht ihn aber auch langweilig und ermüdend. Als Vogel auf dem SPD-Parteitag 1987 redet, so erinnert sich der ehemalige Verteidigungsminister Hans Apel, spielt er lediglich „die alten Platten, die wir schon so oft von ihm gehört haben“, ab – „[a]lles abgerufen aus dem Personalcomputer namens Hans-Jochen Vogel, mit Kraft vorgetragen, ohne menschliche Wärme, ohne politische Perspektive […] Da kommt kein großer Jubel auf. Bei mir erst, als ich erfahre, dass St. Pauli gegen Braunschweig 1:0 gewonnen hat.“68 Wenig später, 1988, so schreibt Apel – der kein Lafontaine-Anhänger ist und dessen Aussagen daher wenig verdächtig sind: „Doch nun kommt Lafontaine und bestimmt die öffentliche Debatte. […] So wird man ‚Vordenker‘, wird man interessant und schafft sich das Maß an Glamour, das man braucht, um Kanzlerkandidat zu werden. Wie blass und bieder sieht dagegen Hans-Jochen Vogel aus, der sich auf das Zitieren von Parteitagsbeschlüssen beschränkt.“69 Und als Lafontaine einmal in Abwesenheit des Parteichefs Vogel eine Vorstandssitzung leitet, freut sich Apel, dass da „Bürokratismus, die penible Detailwut von Hans-Jochen Vogel“70 fehlten. Auch zu anderen Gelegenheiten wiederholt sich dieser für Lafontaine schmeichelhafte Gegensatz: „Vogel trägt seine bekannten, auf Statistiken beruhenden Argumente vor. Das beeindruckt die Gäste nur wenig. Lafontaine redet frei und wenig präzise, dennoch hängen sie an seinen Lippen.“71
Читать дальше