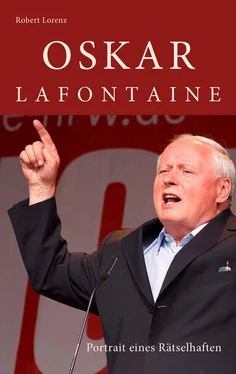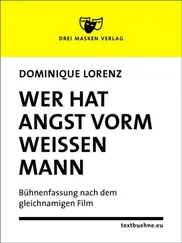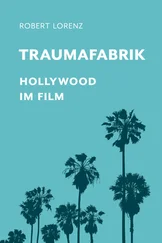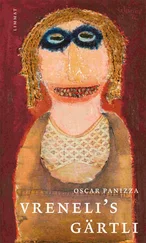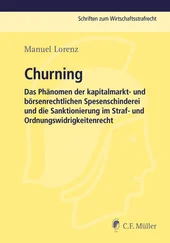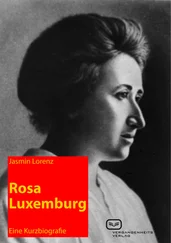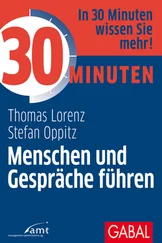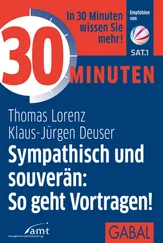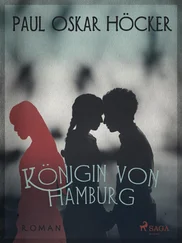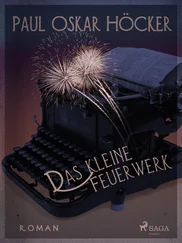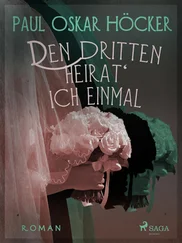Und allein schon als Ministerpräsident, noch dazu mit einer solchen Triumphgeschichte im Gepäck, zählt Lafontaine nun automatisch zu den Aspiranten auf Ämter und Positionen in der Bundespartei. 1985 ist Oskar Lafontaine also in der Parteielite angekommen; nun stellt sich für ihn die Frage, wie lange er dort bleiben, welchen Status er dort einnehmen wird. Denn einmal dorthin zu gelangen, glückt vielen – so z.B. auch dem gleichaltrigen Baden-Württemberger Dieter Spöri, der damals steuerpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion ist, jedoch mehrfach in seinem Bundesland erfolglos das Amt des Regierungschefs anstrebte und an den sich heute jenseits seiner Herkunftsregion vermutlich kaum mehr jemand erinnert.
Bekanntlich setzt sich Lafontaines Aufstieg tatsächlich fort. Seine Machtgrundlage, und damit eine Voraussetzung seines Aufstiegs, sind Wahlsiege. Bis er das Ministerpräsidentenamt 1998 mit seinem Wechsel in die Bundeshauptstadt niederlegt, erhält die Saar-SPD unter ihm dreimal in Folge die absolute Mehrheit, nach jedem Urnengang kann Lafontaine mit Traumergebnissen aufwarten: 1985 sind es 49,2 Prozent, 1990 im Jahr seiner Kanzlerkandidatur sogar 54,4 Prozent und 1994 noch immer 49,4 Prozent. Was auch immer sich für Vorfälle ereignen und wie klein das Saarland auch sein mag: Absolute Mehrheiten sind ein beeindruckender Erfolgsausweis, der sich schwerlich kleinreden lässt und Lafontaine in den eigenen Reihen so etwas wie Narrenfreiheit verschafft.
Aber das ist nicht alles: Mit seiner Regierungsbilanz beweist Lafontaine obendrein, dass er nicht bloß ein formidabler Redner ist, der im Angesicht eigener politischer Entscheidungsgewalt allerdings versagt. Vielmehr bewältigt er gleich zwei wirtschaftspolitische Probleme, die es in sich haben: das drohende Ende des Saar-Stahls und der Saar-Kohle.35 In beiden Fällen geht es darum, schwerwiegende Konsequenzen für die Region abzuwenden. Zum einen ist der Selbstwert der Saarländer als bedeutsamer Produktionsstandort und Energielieferant für das „Reich“, wie die übrige Republik im Saarland genannt wird, schlagartig bedroht; zum anderen sind schlichtweg etliche Arbeitsplätze betroffen. Freilich gibt sich Lafontaine nicht als Wunderheiler der siechenden Industriegesellschaft; die Stahlindustrie wird zwar nicht in vollem Ausmaß gerettet, doch mit sensiblen Sozialplänen, Auffanggesellschaften und kräftigen Staatsinvestitionen das Problem in einer verträglichen Weise gelöst. Die saarländischen Kohlegruben rettet Lafontaine damit zwar nicht, doch vertagt er deren Aus und schiebt der Bundesregierung die Schuld zu, die nötige Investitionen verweigere und dem finanzschwachen Saarland die Verantwortung aufbürde, obwohl doch die Region in den Jahren des „Wirtschaftswunders“ einen großen Beitrag zur westdeutschen Energieversorgung geleistet habe.
Der Ministerpräsident entkommt dem Problemkomplex damit eher gestärkt als geschwächt. Mit dem Aufschub bricht Lafontaine keine Versprechen – denn er hat keine gegeben. Außerdem zeigt er Bereitschaft, für den Erhalt der bedrohten Arbeitsplätze zu kämpfen und hierfür selbst vor einer Konfrontation mit der Bundesregierung nicht zurückzuschrecken. Und er schafft es, auch bei ökologiebewussten Wählern trotz seiner Verteidigung eines rückschrittlichen Wirtschaftszweiges nicht in Ungnade zu fallen. Denn zugleich erneuert er seine Kritik an Atomkraftwerken, zieht demonstrativ den umweltschädlichen Kohleabbau dem lebensgefährlichen Atomstrom vor. Damit gelingt Lafontaine das politische Kunststück, konservative Wirtschaftspolitik mit fortschrittlicher Energiepolitik zu vereinbaren, Arbeiterfamilien auf seiner Seite zu halten, aber gleichzeitig die ökologische Note seiner Programmatik zu wahren, kurz: materialistische wie postmaterialistische Befindlichkeiten parallel anzusprechen.
Auf diese Weise verschleißt er sich in der Regierungsverantwortung weitaus weniger, als dies möglich gewesen wäre. Lafontaines Ruf als zupackender und wirkungsvoller Ministerpräsident übersteht den Strukturwandel der saarländischen Wirtschaft. Trotz Stahl- und Kohle-Krise, einer wirtschaftlichen Zäsur also, hat sich Lafontaine in Amt und Würden nicht entzaubern lassen, ist er einem häufigen Effekt frisch gewählter Regierungen entgangen. Seine Resultate in der Kohle- und Stahlfrage erhöhen sogar eher seine Popularität unter den Saarländern, als dass sie sie verringern. Ironisches Detail der Geschichte: Hätte es sie damals gegeben, wäre der Ministerpräsident Lafontaine vermutlich mit allergrößter Härte von der LINKEN angegangen worden. Denn seine Regierung streicht Stellen im öffentlichen Dienst und verordnet allerorten Budgetkürzungen – in seiner ersten Legislaturperiode zwischen 1985 und 1990 spart das Lafontaine-Kabinett rund 260 Millionen Mark ein.36 Wichtig für seine politische Vita ist jedoch, dass Lafontaine keine Niederlage einstecken muss, dass er unter der Bürde ernster Probleme nicht zusammenbricht, sondern seinen Nimbus des politischen Siegers bewahrt. Besonders kurios: Obwohl sein Kultusminister als „Schulkiller“ verschrien ist, schadet Lafontaines Bildungspolitik keineswegs seiner Beliebtheit; denn er flankiert die Maßnahmen mit anderen Reformen, richtet z.B. Gesamtschulen ein und schafft das Sitzenbleiben nach der ersten Klasse ab.37 Auf diese Weise wirkt seine Politik nicht ausschließlich destruktiv, sondern tatsächlich reformatorisch, da sie einem erkennbaren Ziel verpflichtet wirkt.
Im Landtagswahlkampf 1990, dem naturgemäß große Symbolkraft für die nächsten Bundestagswahlen und einem möglichen Kanzlerkandidaten Lafontaine zugeschrieben wird, scheint die Wiederwahl des Ministerpräsidenten bereits nur noch reine Formsache zu sein. Die Saarländer fühlen sich mit „ihrem“ Oskar wohl, mit seiner resoluten Art und seinen provokanten Vorstößen in der Bundespolitik verleiht er ihnen Selbstbewusstsein und macht sie auch ein wenig stolz; er versprüht kosmopolitisches Flair und ist doch auch heimatverbunden und traditionsbewusst, sogar sein als opportunistisch ausgelegter Spürsinn für Gelegenheiten scheint der saarländischen Mentalität der Anpassung zu entsprechen – schließlich hat die Region seit dem Ersten Weltkrieg viermal die Nationalität gewechselt.38 Lafontaine und das Saarland passen gut zusammen und verleihen sich wechselseitig Stärke; die angesichts der regelmäßigen Wahlsiege unangefochtene Regentschaft untermauert Lafontaines politischen Status. Die vermeintliche Strukturschwäche seines Bundeslandes erweist sich für ihn letztlich als Vorteil.
Aus der Arbeiterfamilie in die Staatskanzlei
Darüber hinaus verfügt Lafontaine für seinen politischen Erfolg über eine Reihe von förderlichen Eigenschaften. Zunächst seine soziale Herkunft: Diese scheint wie gemacht für die Nachkriegssozialdemokratie. Er entstammt einer Arbeiterfamilie; seine Mutter arbeitete als Sekretärin, sein Vater – der als Wehrmachtssoldat den Krieg nicht überlebte – war gelernter Bäcker.39 In der Generation der Großeltern ging es noch proletarischer zu, der eine Großvater war Maschinist, der andere Bergmann. Nach dem Krieg – der Verbleib des Vaters war noch ungeklärt, das Familienhaus zerbombt – wuchs Lafontaine mit seinem Zwillingsbruder Hans und der Mutter in spärlichen Verhältnissen auf, womit er freilich das Schicksal vieler deutscher Familien in der Nachkriegszeit teilte: eine alltäglich improvisierte Lebensweise im ständigen Mangel.40 Es wäre daher zwar naheliegend und stimmig, aus der Sicht von Biografen auch verführerisch, jedoch keineswegs sinnvoll, anzunehmen, Lafontaines sozialer Aufstiegsdrang und seine Schwäche für kulinarische und materialistische Extravaganzen stammten allein aus dieser Erfahrung einer entbehrungsreichen Kindheit. Wie gesagt, in solchen Umständen aufzuwachsen, war damals kein Sonderfall. Und auch, ob der kindliche Oskar im Dillinger Stadtteil Pachten, in dem er aufwuchs, in Prügeleien mit anderen Kindern tatsächlich lernte, „sich selbst zu behaupten, als Einzelkämpfer zu überleben, gegenüber Älteren zu bestehen, oft allein, meist zusammen mit seinem verschüchterten Bruder“41, wie es Interpreten seiner Biografie vermutet haben, kann zumindest relativiert werden. Diese Umstände sprechen sicherlich nicht gegen den Charakter des späteren Politikers, der oft genug in die Kategorie „Alphamännchen“ eingeordnet wurde; doch daraus eine kontinuierliche Entwicklungslinie, ein frühzeitiges Merkmal abzuleiten, geht womöglich doch zu weit.
Читать дальше