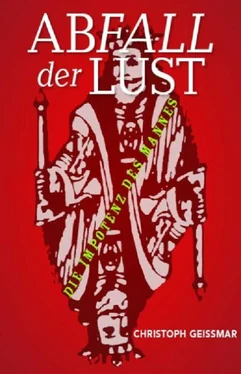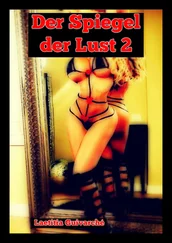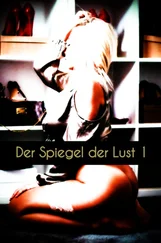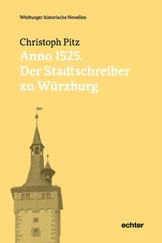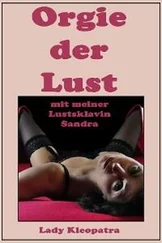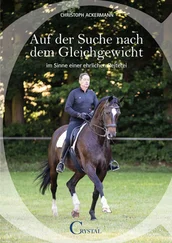Pierre sinkt in Wassermeere. Es ist nicht allein das mare vinum, das er trinkt. Nicht das Mineral, das er in sich hineinschüttet, nicht alle diese nassen Beruhiger. Pierres selbstregierter Körper schafft es, das Wasser wieder auszuschwitzen, sich damit zu umhüllen, sich in ein Schweißbad zu legen, jeden Tag. Das erfordert immer mehr Wasser, um den Durst der Nieren zu stillen. Pierres Darm resorbiert zu wenig und so setzt seine Trägheit aus. Der Körper verwandelt sich zu einer vertikalen Durchlaufstation für Flüssigkeiten. Alles was Pierre in sich hineintun will, möchte er wieder loswerden in der Art und Weise, wie er es als Baby tat, als ihn niemand fragte, was passiert, als es einfach so war. Als der nicht hinterfragte Körper einfach agierte, als es keine Grenze gab. Aber eben auch keinen Samen, den er hätte, nach außen pressen können.
Wiederkehrende Erinnerungen
Pierres Kopf ist voller Bilder. Wie kann man ihre Entstehung erklären, wie existieren sie? Sie setzen sich natürlich aus dem Gesehenen zusammen, der Erfahrung, der Möglichkeit Erlebtes zu erinnern. Dafür gibt es keine Hierarchie, vieles ist auch verschwommen aber dennoch da. Oder Pierre kennt nur noch die Kontexte, aber nicht mehr das Geschehen im Bild. Oder er hat nur noch eine Idee der Geräusche. Oft sind sie nicht spezifisch, aber zu verbinden. Das Wasser. Das Gebrüll der Düsen aller dieser Flugzeuge. Automotoren, die es mit den Vehikeln und ihren Insassen bis sonst wohin schafften. Das Ohr ist wichtig, es unterstützt den Bildsinn.
Das sind die Erinnerungen eines üblichen Lebens, besser, schlechter. Pierre sieht intensiver die Bilder seines Eigenlebens, die seiner Nächsten. Das sind keine vorbeifliegenden Landschaften, sondern feste Orte und die Reaktionen von Menschen, die erinnert werden. Die Statik von Gebäuden, nahe Umgebungen, bestimmte Bewegungen und eben die Laute, Stimmen. Sie verursachen in Pierres Kopf etwas ganz Eigenartiges, nämlich die dauernde Rückkehr der Bilder. Bestimmte Bilder bestimmen den Alltag der möglichen Imagination des Vergangenen. Sie setzen sich fest und beherrschen Pierre, wenn er schwach ist. Ihre Präsenz ist zunehmend dominant. Noch nahe am Erlebten waren die Kopfbilder zunächst flüchtiger, austauschbarer, leichter durch andere Bilder zu ersetzen. Mit der zunehmenden Ferne des Verlorenen ziehen sie sich zusammen. Es entsteht ein Katalog, in dem man verletzt blättern kann. Pierre kann Bilder aufrufen, die ihn schmerzen. Es sind nicht die überwältigenden Erinnerungen Tod, Verlust, Krieg, Gewalt. Es sind die kleinen Bilder, banale Situationen, die Pierre aus Jahren heraus erinnert. Vor allem die seiner Kinder. Das Fußballfeld mit den Eckfahnen, das er für seinen Sohn gebaut hat. Seine Tochter, die er auf dem Heimweg von der Schulbushaltestelle empfängt. Gänge durch die Küche, in den Kriechkeller und in den Schuppen, die er unternahm, dort, wo die Vorräte der Familie lagerten. Gedeckte Tische und sein Essen, das alle liebten. Das sind die Erinnerungen an ein friedliches Leben.
Jahre später kehren sie sich um und richten sich gegen Pierres Kopf. Sie lassen ihn nicht frei. Die Bilder reduzieren sich auf zwei Weisen. Pierre kann die Fotografien, die er hat, mit der Memoria verknüpfen oder eben seine selbst generierten Kopfbilder verwenden. Das Vorkommen reduziert sich mehr und mehr. Was dann übrig bleibt, generiert eine furchtsame, lusttötende Schleife im Kopf, einen immer wiederkehrenden Loop. Dieser Mischmasch stanzt sich ein in die verfügbare Vorstellungswelt von Pierres Kopf. Das geschieht auf brutale, serielle Weise. Um etwas zu fixieren, gibt es Tacker, kleine Maschinen, die Klammern mit hohem Druck in Materialien treiben. In Pierre wütet ein Bildertacker. Er hämmert die immer gleichen Bilderklammern in seinem Hirn fest und legt es Tag für Tag immer weiter lahm. Der Tacker verwendet die Bildergewalt, ihr Eigenleben, um Pierre zu dominieren. Er ist präzise, ein kleiner auslösender Moment, Zack-Tack, ist das Bild wieder fest im Hirn und Pierre muss es anschauen, erneut leben.
Nimmt Pierre nicht den Tacker an, sondern einfach seinen Augensinn, darf er sich nicht mehr Bilder machen. Wenn er die sieht, die er hat, stirbt er. Er sieht sein vergangenes Leben und das wird verboten, weil es weg ist. Die Bilder nehmen seinen Tod vorweg, sie zeigen den Weg dorthin. Sicher kann die Anschauung nicht töten, auf keinen Fall. Aber sie kann sprachlos und überwältigend führen.
Die Bilder sind sperrig. Ihr Reiz liegt darin, dass nicht direkt zutrifft, was sie zeigen. Ein bloßes Abbild ist nichts. Das bearbeitete Bild im Kopf macht den Punkt. Und seine Geschichte, denn die alten Bilder sind die besten, sie haben überlebt. Die Erinnerung muss leicht neben dem liegen, was wirklich war. Es darf kein Zerrbild sein, nur etwas leicht Verrücktes. Das Bild muss wahr sein, einen Abdruck bilden, aber die Erinnerung brechen und immer wieder aufschäumen.
Weibliche Busen wie Pos bilden die Formen der Rundung schlechthin und lösen damit in Pierre ein schwer zu hemmendes Verlangen aus, ihnen zu begegnen. Nicht nur schauend, sondern auch tastend, streichend, vorsichtig drückend, bewegend. Pierre begegnet so Reiz und Potenz der Form. Mag man ihm mit seiner Kunstgeschichte folgen, kennt sich Pierre mit der Formenwelt ein wenig aus. Aber diese ist sachlich in Bauten, Skulpturen, Bildern und Texten vorhanden und überwiegend gewesen – seit Jahrhunderten; Pierres gegenwärtige Pos und Busen sind warm und lebendig, er begreift sie als seinen taktilen Besitz. Sie haben einen aktuellen Reiz, den er fühlen, aber nicht in seinen Stream voranzukommen umsetzen kann. Er sucht vergeblich.
Der Eros der Wissenschaft und speziell der Kunst- und Bildgeschichte, Pierres Fach, besteht aus dem Finden. Etwas sichtbar zu machen, was andere noch nicht sahen. Oder was nicht mehr gewusst wird. Das sind keine isolierten Positionen. Diese Einsichten ergeben sich nur, wenn man das Wissenschaftssystem auf Löcher durchsuchen kann. In der Geschichte der Bilder geschieht das weitgehend zweckfrei. Findet man tatsächlich eine Lücke in dem enggestrickten Netz von Metabildern und Texten, die revidierend ist, kann der Kick enorm sein – es gibt zwei- dreimal im Wissenschaftlererosleben einen Geistesblitz, der mehr ist als ein nicht endender Megaorgasmus. Pierre hatte bisher einen Richtigen. Die Erkenntnis, der Blick, dauert nur ein paar zehntel Sekunden, dann weiß man es. Pierre vergewisserte sich so ruhig wie möglich ein paar Minuten, geht weg vom Objekt und lässt dann die Aufregung in sich kreisen, strömen, versucht die Ruhe zu halten. Er muss das Gefundene in sich begründen und dann haptisch werden lassen, es erneut berühren. Pierre fand ein Buch, er legte die Seiten erneut um, roch sie wie einen Körper, war verschämt, niemand sollte es sehen. Das war die Potenz von Pierres vollgefülltem Kopf, der Intelligenz. Ein Hinweis eines Kollegen hatte letztlich den Ausschlag gegeben, eine besonders schöne Form der Findung, ein in sich über die Kenntnis des Objekts voneinander entfernender, doch gemeinsamer Eros zweier ganz verschiedener Köpfe. Es entsteht eine Lust im Kopf, der Drang des Forschers Pierre, mit Schau und Lesen Neues zu finden. Der Reiz der Busen, des Po, des Bauches, der Beine und des Gesichtes sollte sich ebenso erdrängen lassen. Der Forscherdrang des Kopfkörpers ist eine nach außen auf das Objekt, das Original gerichtete Bewegung, der Fühldrang des Gliedkörpers die Tendenz zur Verschmelzung mit dem Gegenüberkörper. Der Satz vom Kopfkörper gilt, der Satz vom Gliedkörper gilt, eine Antinomie; sie kennzeichnet Pierre. Solche Impotenz beruht auf einer nur leichten Verschiebung dieses unauflöslichen Gleichgewichts zweier Verschiedenheiten, die Lust nicht aufkommen lässt. Der Kopf lässt das Glied baumeln, die Augen sind einmal machtlos, sie können den Penis nicht emanzipieren.
Читать дальше