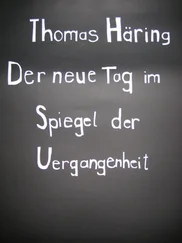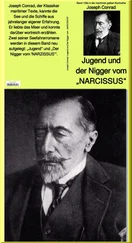Auch ich musste viel öfter eine große Portion Opportunismus an den Tag legen als mir lieb war, gegen eigene Überzeugungen reden, mich vormilitärisch ausbilden und dabei auf einen Angriffskrieg vorbereiten lassen, im FDJ-Hemd herumlaufen und kommunistische Kampfeslieder singen und so weiter und so weiter.
Manchmal waren die systemkonformen Mitstreiter geradezu zu beneiden, da diese sich zwar hatten völlig verblenden lassen, sich aber dafür nicht zu verbiegen brauchten.
Die in den 2000-er Jahren in den Medien einsetzende „Ostalgie“-Welle ist zu meiner Beruhigung wieder verebbt.
Die zum Teil verharmlosenden Filmchen über Liebschaften über die Mauer hinweg, bei denen dies in der Geschichte einzigartig brutale Grenzregime oft witzelnd verniedlicht wird, und das Hervorrufen von liebevollen Nostalgiegefühlen gegenüber typischen DDR-Eigenheiten war geradezu unerträglich und an Zynismus gegenüber den oben genannten offensichtlichen Regime-Opfern nicht zu überbieten.
Nicht verschwiegen soll jedoch auch werden, dass es natürlich auch sehr gute Produktionen mit sehr vielschichtigen Sichtweisen ohne Klischees wie den Film „Das Leben der anderen“ gegeben hat, bei denen die Täter in sehr differenzierter und psychologisch tiefgründiger Weise dargestellt wurden, ohne das inhumane Regime zu verharmlosen.
Unrealistisch empfinde ich auch immer dieses: „Wir hatten früher keine Ellenbogengesellschaft, wir haben noch zusammengehalten und uns gegenseitig geholfen.
Dass dies nur aus der Not heraus geboren war und lediglich dem allgegenwärtigen Mangel in allen Bereichen, dem „Aufeinander-Angewiesen-Sein“ entsprungen ist, wird geflissentlich „übersehen“. In einer freien Gesellschaft ist Konkurrenzdenken dagegen ganz natürlich und in gewissen Grenzen sogar für eine Weiterentwicklung notwendig.
Zu welchen Auswüchsen sich diese Denkweise allerdings entwickeln kann, ist eine ganz andere Geschichte, die hier aber nicht behandelt werden kann und soll.
Nur so viel: Nach einer anfänglichen Begeisterung gegenüber der „sozialen Marktwirtschaft“ in den 90-er Jahren, habe ich auch hierzu inzwischen eine deutlich kritischere Haltung eingenommen.
Doch waren nicht eigentlich alle DDR-Bürger Opfer in einem Staat der Repressionen gegenüber jeglichen Andersdenkenden?
Ist es nicht schon ein Verbrechen, wenn man bereits Kindergartenkinder auf die einzig akzeptierte politische Ausrichtung einer Diktatur einschwört?
Wenn man Schulkinder und Studenten zu politischen Äußerungen und Handlungen zwingt, die mit deren religiös-philosophisch oder politisch anerzogenen oder selbst erarbeiteten Werten und Ansichten in keiner Weise übereinstimmen?
Ist es nicht bereits eine Form von echter, wenn auch „nur“ psychischer Gewalt, die hier ausgeübt wird, wenn das ausbildungsbezogene und berufliche Fortkommen von der geradlinigen Parteilinie oder gar –zugehörigkeit oder der Länge der Dienstzeit bei der Armee abhängt?
Da ich juristisch nicht ausgebildet bin, vermag ich nicht zu entscheiden, ob es sich hier um einen klaren Fall von staatlich ausgeübter Nötigung handelt, aber im moralischen Sinne ist er das sicherlich allemal.
Also ist das Ziel dieser Zeilen eine persönliche Abrechnung mit dem DDR-System und dessen unmenschlichen „Nebenwirkungen“?
Nein, dies ist so nicht der Fall.
Das DDR-Regime steht hier nur stellvertretend für JEGLICHE Form von Gleichschaltungsversuchen, totalitären Strukturen, Individualismusbekämpfung, „Meinungsmacherei“ und so weiter.
Letztlich besteht die Absicht, eine aufrichtige autobiografische Skizze eines Menschen vorzulegen, die nicht in erster Linie GEGEN irgendetwas oder gar irgendwen gerichtet ist, sondern vor allem ein engagiertes Statement FÜR den Menschen als Individuum, für die Förderung seiner Persönlichkeit, für das Aufrufen zur Selbstverwirklichung und die Selbstbestimmung als mündigem Bürger im Gefühl der individuellen Freiheit inmitten der Grenzen einer freien Gesellschaft sein will.
An einem kalten Sonntag im Winter 1965, (angeblich) genau um 18.00 Uhr, erblickte ich in der Erfurter Frauenklinik das Licht der Welt.
Meine Mutter, eine Operettensängerin am Nordhäuser Theater, Jahrgang 1929, hatte sich sehr auf mich gefreut. So sehr, dass sie ein Jahr nach meiner Geburt Ihren Beruf aufgab, um sich nunmehr ausschließlich den mütterlichen Freuden zu widmen.
Ganz dem klassischen Rollenbild entsprechend hatte mein Vater, der nach einer wegen der Schließung des Ausbildungsbetriebes abgebrochenen Kaufmannslehre sich mit Jobs wie Rettungswagenfahrer, Pfleger in einer Nervenklinik und Arbeiter in einem Betonwerk durchgeschlagen hatte, den alleinigen Part der materiellen Versorgung der Familie zu übernehmen.
So richtig gut ging es ihm erst als Taxifahrer, einer Tätigkeit, die man - aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar - zu DDR-Zeiten fast schon als privilegiert bezeichnen konnte.
Schließlich war in der Mangelwirtschaft alles knapp, eben auch die Möglichkeit, beispielsweise als Barmixer einer Nachtbar nachts um drei Uhr nach Hause zu kommen.
So hatte man jede Menge so genannter Beziehungen. Schließlich brauchte auch ein Arzt zu Silvester ein Taxi, oder eben auch mal die Gemüsehändlerin, oder die Frau aus dem Buchladen und so weiter.
Trinkgelder flossen zuweilen in angenehmer Höhe und man hatte ein leidliches Auskommen für DDR-Verhältnisse.
Hinzu kamen noch Einnahmen aus Gewinnen von gelegentlichen Verkäufen, da meine Eltern sehr ambitionierte Antiquitätensammler waren.
Darüber hinaus lebte ein Bruder meiner Mutter - sie hatte drei Geschwister - in der Nähe von Düsseldorf und versorgte uns all die Jahre sehr großzügig mit den beliebten Westartikeln von Kaffee und Schokolade bis hin zu „echten“ Jeans, Quarzuhren und allem, was das DDR-Bürgerherz erfreute.
Viel wichtiger war jedoch die ebenso wenig fehlende Liebe, die ich in meiner Kindheit seitens meiner Eltern erfuhr.
Meine Mutter lebte ihr Leben bis hin zur Selbstaufgabe ausschließlich für ihre Liebsten, so dass sie sich im hohen Alter nur noch über das Befinden selbiger definierte.
In ihr spiegelte sich in gewissem Maße der Gesamtzustand ihrer Geschwister, ihres Sohnes und der Enkel wieder. Ging es diesen gut, so konnte es ihr selbst auch gut gehen, was im gegenteiligen Falle natürlich ebenso galt.
Manchmal glaube ich, derjenige Mensch, über den sie am wenigsten nachdachte und um den sie sich am wenigsten sorgte, war sie selbst. Und das ist heute alles eher noch etwas intensiver, da sie seit drei Jahren als Witwe lebt.
Dennoch konnte ihren unerschütterlichen Optimismus so gut wie nie etwas aus der Ruhe bringen.
Mein Vater nahm sich trotz seiner Arbeit im Dreischichtsystem viel Zeit und kümmerte sich vor allem in der Freizeit um mich, während meine Mutter die schulischen Belange unter ihre Fittiche nahm.
Man kann also sagen, dass ich im familiären Umfeld eine unbeschwerte Kindheit hatte, was mein selbstständiges Denken sicher förderte und mir eine stabile Psyche bescherte.
Da ich keinen Kindergarten besuchte, was damals relativ selten vorkam, da die meisten Mütter keine Schwierigkeiten mit Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen hatten und unabhängig von ihren Wünschen die kärglichen Löhne in der DDR mit aufbessern helfen mussten, wurde ich auch noch nicht mit der Staatsmacht konfrontiert und musste noch keine den Sozialismus und Militarismus verherrlichenden Lieder singen wie damals bereits im Vorschulalter üblich. Machten die Erzieher ihre Arbeit „gut“, hatte bereits eine große Anzahl von Kindergartenjungen den Berufswunsch „Soldat“.
Statt des Kindergartens besuchte ich eine so genannte Vorschule.
Im Jahre 1971 fand dann meine Einführung in die POS 27, die Neuerbe-Oberschule, in der Nähe des Erfurter Flutgrabens und Bahnhofsviertels statt.
Читать дальше