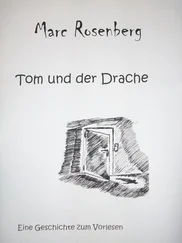„Ich arbeite“, sagte ich nur und Mutter wusste, dass ich in den nächsten Stunden nicht gestört werden wollte.
Bevor ich das Paket öffne, mache ich die Musikanlage an. Das gehört zusammen: Musik hören und Bücher auspacken.
Auch, wenn es diesmal gar keine Bücher sind. Es sind Teile einer Geschichte.
Ich habe mir das Paket selber geschickt. Um mir eine Freude zu machen. Um zu testen, ob es verschickt wird. Ob es ankommt. Der Inhalt. Ob es jemand merkt, was denn da drinnen verschickt wird. Ein Geschenk von Michaela. Etwas unfreiwillig, aber notwendig. Sie konnte ja nicht mehr widersprechen, sich auflehnen. Aber kalt war sie noch nicht. Sie roch noch nach sich, nach Liebe, oder Sex? Nach Angst? Nach Gier vielleicht, nach Lust und Schmerzen, ja. Das riecht intensiv, das schmeckt intensiv, erregend und betörend. Unvergleichlich. Der Blick in ihren Augen, bevor es vorbei war. Die Augen. Kurz bevor es vorbei ist. Die Augen sind das Faszinierende, wenn das Ende kommt, als würde sie es sehen. Das Ende, wie es naht. Ob schleichend oder plötzlich angesprungen.
Und es wird verschickt. Ich freue mich. Eine nette kleine Erinnerung. Obwohl ich keine Erinnerung brauche, keine Gedächtnisstützen. Ich kann es mir merken. Das schon, was wir erlebt haben. Michaela und ich, obwohl sie es ja nicht wirklich überlebt hat, nur in meiner Erinnerung, in meinem Kopf. Ich aber werde dafür sorgen, dass sie unvergessen bleibt. Es wird nicht vergebens gewesen sein, Michaela. Für manche Dinge im Leben reicht Fantasie eben nicht aus. Es gibt Geschichten, die schreibt das Leben besser als jede Fantasie. Ja. Und ich schreibe sie auf. Die Geschichten. Für euch. Die ihr diese Geschichten lesen wollt. Das erfordert Opfer. Bereitwillig, wie ich versichern kann. Bis zu einem bestimmten Punkt zumindest. Aber Ekstase und Obsession sind wie ein Schmerzmittel. Nur besser.
Ich bekomme eine Erektion. Vom Gedanken an Michaela. Vegetarierin. Sie war Vegetarierin. Auch das noch. Und ich sah schon eine Freude, ein Vergnügen schwinden. Direkt vor meinen Augen.
„Nehmen Vegetarierinnen eigentlich einen Schwanz in den Mund?“, fragte ich. Ich hatte es gerade erst erfahren, aber ich ergriff die Gelegenheit beim Schopf, wie immer. Es gab nur zu gewinnen. Verlieren konnte ich nicht. Nicht mehr. Im Dunklen gibt es nichts, was ich verlieren kann.
Sie schaute mich an. Ich sah, dass sie noch nicht wusste, ob sie loslachen oder wütend sein sollte. Sie schwankte. War verlegen. Und ich hatte gewonnen. Ich lächelte.
„Ich meine, das ist doch Fleisch.“
„Ja, schon, aber es ist ja noch lebendig.“
„Gutes Argument“, meinte ich und fügte hinzu, „lebendig ist gut. Es gibt wohl doch Dinge, die auch in den Händen und im Mund einer Vegetarierin wieder lebendig werden.“
„Bisher hat sich noch niemand beklagt.“
„Das freut mich zu hören.“
„Außerdem ist der Schwanz eines Mannes ja nicht tierisch.“
Ich horchte auf.
„Nicht tierisch?“
„Ja. Vegetarier essen keine toten Tiere. Der Schwanz eines Mannes, eines männlichen Menschen ist kein tierisches Fleisch. Also im strengen Sinne.“
„Im strengen Sinne?“
„Na, ja. Wie soll ich sagen?“, sie senkte den Blick.
Und wusste nicht, dass ich bereits wusste, worauf sie hinaus wollte. Aber ich sah es gern, wie sie sich unter meinen Blicken, meinem Zögern, meinem Schweigen und meinem Erwarten wandte. Ich nahm ihr nichts ab, noch nicht.
Es erregte mich.
„Manchmal wünscht sich eine Frau ein Tier, also, dass der Träger eines Schwanzes zum Tier wird. Auf ihr, hinter ihr, in ihr. Mit den Kopf zwischen ihren Schenkeln. Ihren Saft trinkend.“
„Ach, tatsächlich?“
„Ja“, seufzte sie.
Ich wusste, sie war bereits bereit, feucht, willig. Sie erwartete mich. Erregt. Sie würde die Schmerzen mit Lust und Freude empfangen, sich dem Verlangen nach mehr hingeben und sich unter ihnen winden, während ich sie dem finalen Höhepunkt entgegen treiben würde. Final. Und einmalig. Ja. Der letzte Orgasmus.
Es war natürlich kein Zufall, dass wir zusammen in diesem Restaurant saßen. Das Internet hat mir meine Arbeit, meine Recherchen wesentlich erleichtert. Fast schon zu einfach. Chatrooms. Man wird zu jemandem, der ich nicht bin oder der ich gerade eben doch bin und den ich dann so echt spiele, dass kein Zweifel aufkommt. Lebensecht. Wer auf „Geschichte der O“ reagiert, muss damit rechnen, dass es weh tut, dass es Schmerzen geben wird. Aber Schmerzen kennen Grenzen, Michaela lernte sie kennen. Mit mir. Und einen Teil davon habe ich mir selbst geschickt. Ich übertreffe mich selber. Das bewundere ich so an mir.
Es hat funktioniert.
Und ich muss kichern. Wie eine alte Frau.
Mutter, denke ich, ja, es wird Zeit.
4.
Ich schließe hinter mir ab und gehe nach oben. Die Sonne ist schon fast weg, aber es ist noch nicht dunkel. Für die Bühne reicht es. Es kann losgehen. Showtime. Kasperletheater. Ich mag das eigentlich nicht. Zu viele Erinnerungen. Aber es muss wohl sein. Teil der Geschichte. Und deswegen liebe ich es doch. Ja, ich liebe es. Ich liebe, was ich tue, weil es vollkommen absurd ist. Erkennt der Weise, dass er verrückt ist?
Das Kleid und die Perücke, das reicht. Beides liegt griffbereit auf dem Bett in ihrem Zimmer. Hier hat sich nichts verändert, außer, dass sie hier oben nicht mehr schläft. Ein kurzer Blick in den Schrankspiegel.
„Perfekt!“, sagt sie und ich stimme ihr zu.
Manche Dinge erweisen sich in absurden Situationen als großer Vorteil. Größe zum Beispiel oder besser Länge. Ich bin nur etwas länger als meine Mutter. Das ist erst einmal vollkommen unwichtig, gewinnt aber in außergewöhnlichen Umständen an Bedeutung. Ich gehe langsam die Treppe herunter, weil ich nicht stolpern will, und weil ich schon einmal üben will. Langsam und ein Bein leicht nachziehend, so bewegte sich meine Mutter. In der Öffentlichkeit. In der Küche ist das Licht bereits an. Ich hasse Gardinen, aber auch sie haben ihre Existenzberechtigung. Jetzt zum Beispiel. Sie ermöglichen Einblick, erlauben aber keine Details. Draußen ist es dunkler als in der Küche, ich brauche nur eine Weile hier hin und her zu laufen, mir einen Tee zu machen, mich an den Tisch zu setzen und mich vom Küchenlicht anstrahlen zu lassen und ich weiß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass ich, nein, dass Mutter gesehen wird. Oder besser, dass das gesehen wird, was sie glauben zu sehen. Was ich ihnen erlaube zu sehen. Das beruhigt die erhitzten Gemüter, die neugierigen Schachteln. Ich war heute Morgen wirklich viel zu freundlich.
Ich setze mich mit dem Rücken zum Fenster und hebe den Kopf.
„Ich sag dir was“, sage ich, „was meinst du, wie lange geht das noch gut, mein Sohn?“
Ich muss kichern. Ich hebe den rechten Arm und drehe den Kopf zur Seite.
„Hoffentlich guckt auch jemand her, wozu mache ich denn diese ganze Show?“, sage ich und bewege meine Hand beim Sprechen. Körpersprache ist wichtig. Wenn man nichts hört, muss man sehen, dass jemand redet.
„Klaus-Peter“, höre ich meine Mutter sagen, so hat mich nur meine Mutter genannt. Und so darf mich auch nur meine Mutter nennen, ungestraft.
Vater sagte „Sohn“ oder Klaus. Das macht er aber schon lange nicht mehr.
„Du bist verrückt, weißt du das, Klaus-Peter?“, meint Mutter.
Vielleicht treffen sie sich ja, schießt es mir durch den Kopf. Nichts ist unmöglich, na ja, manches vielleicht doch. Aber denkbar. Sie gehörten nicht zusammen. Das passte einfach nicht. Ich weiß es. Ich habe es herausgefunden. Aber alles weiß ich doch nicht. Mutter hatte ihre Geheimnisse. Vater anscheinend auch. Die hat er mitgenommen oder er ist zu ihnen zurückgekehrt. Wie auch immer.
„Ja“, sage ich, „ich weiß, dass ich verrückt bin. Ich bin krank, Mutter, sehr krank. Ich habe wieder Kopfschmerzen. Aber du kannst mir nicht mehr helfen, nicht mehr.“
Читать дальше