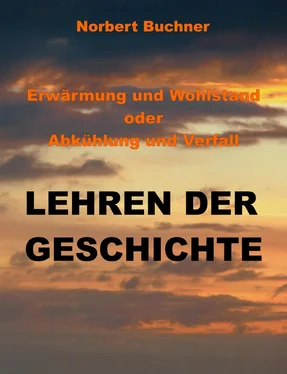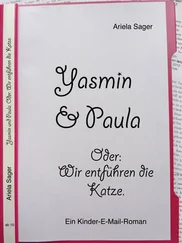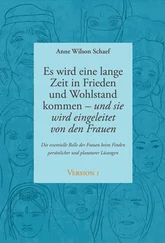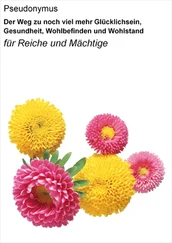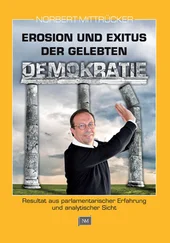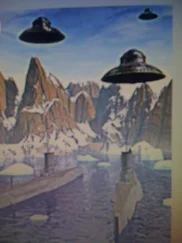Mit der Verbesserung des Klimas um 3300 – 3200 v.Chr., als es mit dem raschen Rückzug des Eises im Atlantik (Abb. 10) nicht nur schnell wärmer sondern auch recht feucht wurde (Abb. 15), wurden auch in der Levante die Verhältnisse schlagartig wieder besser: die kulturelle Entwicklung erwachte wieder und die „Frühe Bronzezeit I“ (3300 – 3000 v.Chr.) setzte ein verbunden mit einer allmählichen wirtschaftlichen Wiedererholung. Es ergibt sich aber ein noch recht lückenhaftes Bild: es scheint, dass sich nun ein Netz von verstreuten Siedlungen zu organisieren begann.
Ein jäher Absturz in eine kurze Phase mit hoher Trockenheit setzte allerdings diesem ersten Abschnitt wieder ein Ende (Abb. 15).
Der zweite Teil der „Frühen Bronzezeit II“ (3000 – 2700 v.Chr.) war dann auch in der Levante über die lange Zeit von 3 Jahrhunderten von großen Gunstwerten hinsichtlich Temperatur und Feuchtigkeit geprägt (Abb. 15). Die bisherigen kleinen Siedlungen verwandelten sich nun in kleine und mittelgroße Städte, deren Wirtschaft auf Ackerbau, Weidewirtschaft und Jagd beruhte. Der scharfe Einbruch bei Temperatur und Feuchtigkeit zwischen den beiden Perioden hatte die Menschen aber offensichtlich zu Sicherungsmaßnahmen gegen Raub und Überfälle gezwungen, denn die Städte beideits des Jordan waren ab der zweiten Periode mit Befestigungen versehen.
In kleinräumigeren Palästina konnte die Kultur der Frühen Bronzezeit nicht das Niveau von jener der großen Flusstäler, Euphrat und Tigris bzw. Nil, erreichen und es wurde in dieser Zeit dort auch kein Schriftsystem wie in diesen Tälern entwickelt. Lit. 15.3
Erster Auftakt der Indus-Kultur: Harappa
Die Gunst des klimatischen Optimums wirkte sich auch im pakistanisch-indischen Raume aus und dort wurden schon in der sog. Ravi-Periode die Fundamente zur späteren Indus-Kultur gelegt. Man datiert sie auf 3300 – 2800 v.Chr. und sie umfasst damit das Klimaoptimum, in welchem das sumerische Uruk III zur Hochblüte kam, einschließlich ihrer Auf- und Abschwungphasen. An einem damaligen Lauf des Flusses Ravi, eines Nebenflusses des Indus, entstanden in dieser Zeit landwirtschaftlich geprägte Dörfer, in denen Ackerbau und Viehzucht sowie Jagd und Fischfang betrieben wurden. Die Menschen in dem fruchtbaren Tal züchteten Rinder und bauten Weizen, Gerste, Gemüse und Sesam auf ihren Feldern an. Von den vielen Dörfern, welche im heutigen Punjab damals entstanden, wuchs aber offensichtlich nur ein einziges, Harappa, später zu einer städtischen Bedeutung heran.
Harappa wurde in der Neuzeit zwar erforscht, aber diese Erforschung war erschwert: beim Bau der Bahnstrecke Lahore – Multan im Jahre 1857 wurde die frühgeschichtliche Stadt von den Engländern aus Unkenntnis als Steinbruch benutzt und die gewonnenen gebrannten Ziegel wurden als Schotterunterlage für eine neue Bahnstrecke verbaut. Als frühgeschichtliche Stätte entdeckte man Harappa erst sehr viel später.
Ein Fundament der wirtschaftlichen Beständigkeit stellten neben der Landwirtschaft das Handwerk und ein florierender Handel dar. Dieser hat dann später wohl auch zur großen kulturellen Einheitlichkeit der „Indus-Kultur“ in einem riesigen geografischen Raum beigetragen. In Harappa wurden Perlen und Reife hergestellt, aus Terrakotta für die einfacheren Leute und aus exotischen Steinen und Muscheln für die Begüterten. Die Rohmaterialien hierfür mussten über weite Wege beschafft werden.
Schon in der ersten Phase der Siedlung hat man Symbole in Tonwaren eingeritzt, von denen einige in die spätere Indusschrift eingegangen sind, welche in der Zeit zwischen 2800 und 2600 v.Chr. ausreifte – nur wenig später als die sumerische Keilschrift. Man fand aus dieser Phase auch schon die für die spätere Indus-Kultur typischen großen eckigen Siegel mit eingravierten Tieren der Gegend, begleitet von eben diesen „Schriftzeichen“. Vorläufer dieser Siegel hatte man schon viel früher in Mehrgarh, der Pforte zum Indus-System, angetroffen. In der zweiten Kulturphase von Harappa wurden dann die Gewichte vereinheitlicht: ein kleiner Kubus von 1,13 Gramm wurde später zum Gewichtsstandard der Indus-Kultur. Dieses Gewichtssystem wurde dann auch von den seefahrenden Händlern in Bahrain am Persischen Golf übernommen.
Die auf die Gunstphase folgende Zeitspanne zwischen 2800 und 2600 v.Chr. war von 2 tiefen Einbrüchen der Temperatur gezeichnet (s.Abb. 17), als deren Folge das Wachstum in den Dörfern zu stagnieren begann. Nur Harappa entwickelte sich allmählich zu einer mächtigen Metropole weiter. Während sich die Städte an Euphrat und Tigris in dieser wechselvollen Zeit blutige Schlachten lieferten scheint es aber in Indien trotz Klimaverschlechterung friedlich geblieben zu sein, denn es fehlen die üblichen martialischen Funde anderer Kulturen, wie Waffenlager und Zeichen für bewaffnete Konflikte, oder entsprechend zugerichtete Skelette, Brandschichten, bildliche Darstellungen von Kriegern oder von siegreichen Kriegsherren. Lit. 15.4
Kultureller Aufschwung in Ägypten: Thinitische (Frühdynastische) Epoche.
Mit der beginnenden Austrocknung der Sahara, welche vom Osten ausging und sich nach dem Westen hin ausbreitete, wurde das vorher zu feuchte Niltal als Siedlungsgebiet attraktiv und Menschen aus der Sahara begannen nun dort zu siedeln. Ihre frühen Darstellungen auf Tongefäßen ähnelten noch stark jenen der Felszeichnungen in der Sahara. Sie kannten schon den Ackerbau, die Keramik- und Textilherstellung, die Verwendung von Ziegeln und die Verarbeitung von Gold und Kupfer. Ihre Siedlungen wuchsen allmählich an und kleine Städte und Staaten begannen sich herauszubilden.
Eine altägyptische Kultur entwickelte sich dann, vom Delta des Nils abgesehen, in einem schmalen Streifen am Nil von höchstens 20 Kilometer Breite, in dem das Wohl und Wehe wegen der spärlichen Niederschläge der Region direkt vom Fluss abhing. Das jährliche Hochwasser sorgte für Feuchtigkeit und Fruchtbarkeit und einen Wasservorrat und das abfließende Wasser auch für eine Entsalzung der Böden. Auf den bewässerten Feldern baute man Weizen, Gerste und Dinkel an und in den Gärten wurde vielerlei Gemüse und Obst gezogen. Außerhalb der bewässerten Felder und des feuchten Deltagebiets hielt man Rinder, Schafe und Esel.
Allmählich wurden dann, um den Fluss unter Kontrolle zu bringen und Wasser für die Trockenzeit zu speichern, imposante Deich- und Kanalbauten errichtet. Diese Aufgaben erforderten – ähnlich wie in Mesopotamien – eine übergeordnete Autorität zur Mobilisierung und Koordinierung der Aktivitäten und auch um zu sichern, dass für Hungerzeiten Lebensmittelreserven angelegt und sinnvoll verteilt wurden. Das waren dann auch die Voraussetzungen für das Entstehen eines zentral geleiteten Staatswesens und sein Funktionieren war auch auf eine schriftliche Dokumentation angewiesen.
Maßgeblich für die Fruchtbarkeit des Niltals war die Stärke der jährlichen Monsunregen im ostafrikanischen Einzugsgebiet des Nils. Nur Unterägypten, vor allem das Deltagebiet, konnte von einer zweiten Feuchtigkeitsquelle zehren, den Niederschlägen aus dem Atlantik-/Mittelmeergebiet. Diese verhielten sich nicht unbedingt synchron zu den Monsunregen, weil sich infolge von Temperaturschwankungen die atlantischen Tiefdruckgebiete mehr nach Norden oder nach Süden verlagern konnten. Diese doppelte Feuchtigkeitsquelle machte Ägypten insgesamt wirtschaftlich stabiler als Nachbarregionen wie Anatolien, Obermesopotamien und die Levante, deren Niederschläge im Wesentlichen von einer einzigen Feuchtigkeitsquelle abhingen. Deshalb galt in Notzeiten Ägypten oft als Retter für Menschen und Völker aus diesen Regionen. Allerdings kamen diese oft nicht nur in friedlicher Absicht und Hilfe suchend nach Ägypten, sondern Unterägypten war in Phasen von Trockenheit der Nachbarn immer wieder feindlichen Einfällen ausgesetzt.
Читать дальше