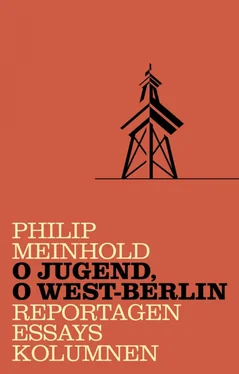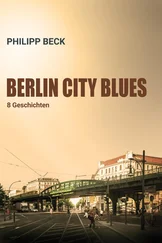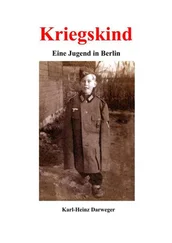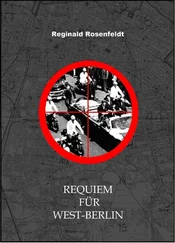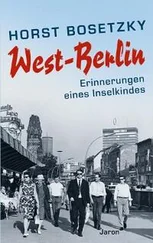Martin bildet sich ein, der Schweiß und Menschendunst im Roses würde sich im Fell unter der Decke sammeln und von dort auf uns niederschweben: höchste Zeit also, weiterzuziehen. Am Kotti böten sich im 360-Grad-Winkel Möglichkeiten: Möbel Olfe, Würgeengel, Festsaal Kreuzberg, Monarch – doch egal, was wir in Erwägung ziehen: Überall wird es voll sein und voller Touristen. Und so voll sind wir noch nicht!
Wie ein Drehkreuz spült der Platz das Partyvolk in die verschiedenen Richtungen; vorbei die Zeiten, als man sich hier vorkommen konnte wie Snake Plisken in John Carpenters „Die Klapperschlange“, abgeworfen über einem gesetzlosen, sich selbst überlassenen Ort voll verkommener Elemente.
Meiner Freundin fällt ein Club ein, der ihr kürzlich empfohlen worden ist, und so nehmen wir die 270-Grad-Ausfahrt in Richtung Reichenberger und gehen ins Bohnengold. Drei hintereinander liegende Räume ziehen sich wie Katakomben in ein Mietshaus hinein: im ersten Raum eine vollbesetzte Kneipe voller Menschen und Lärm, dahinter ein schlauchartiges Zimmer im 70er-Jahre-Style; zwei Stufen hinab, durch eine Eisentür, ein Keller mit Tanzfläche. Es riecht nach Schimmel, doch das scheint niemand zu stören, ein DJ legt Elektro mit 80er-Einschlag auf. Wir schlagen uns durch zur Bar. Die Mädchen bleiben bei Jägermeister, wir Jungs bei Bier – wir stellen fest, dass wir zu dick sind, um hier dazugehören. Die Jungs tragen Röhrenjeans, bedruckte T-Shirts und Scheitel; magersüchtig und milchgesichtig stehen sie auf der Tanzfläche rum, die knochigen Knie zucken zur Musik. „Man erkennt nie, ob das nun Hipster sind oder Trottel“, erklärt Martin. Merkwürdig, dass die ironische Distanz zur eigenen Jugend heute schon während ihr einsetzt.
Vor uns geht ein Mädchen auf einen Hipster-Jungen zu, beide sind Anfang zwanzig. Sie sagt: „I‘ve watched you? What are you drinking?“
Zwischen den Elektro-Beats hören wir die Bruchstücke eines Gesprächs, wie es in dieser Sekunde in Berlin wahrscheinlich fünfzig Mal geführt wird: I‘m from Sweden. / Berlin is so great. / Where have you been so far … und so weiter. Man weiß nicht so recht, ob man das süß finden soll, oder ob man die beiden kräftig schütteln soll und sagen: „Könnt ihr nicht aufhören, Plattitüden aneinanderzureihen?“
Weil wir es in der Hipsterhölle nicht mehr aushalten, setzen wir uns vorne an einen Tisch; obwohl keine Musik läuft, ist es unfassbar laut: Am Tisch neben unserem wird auf Englisch geschrien, irgendwer zersticht die Luftballons einer Geburtstagsrunde. Wir stellen uns die Fragen, die uns begleiten: Wären wir früher auch in so einen Laden gegangen? Stört es die Touristen nicht, nur unter ihresgleichen zu sein? Wollen sie nicht irgendwo feiern, wo Berliner sind?
„Ob die es gut finden, heutzutage jung zu sein?“, frage ich. „Ich finde, sie sehen nicht so aus.“
„Jung sein ist doch immer gleich“, erklärt meine Freundin, „und außerdem haben sie keinen Vergleich.“
Weil wir den aber haben, finden wir es hier schrecklich. „Kommt, lasst uns gehen“, spricht G. schließlich aus, was wir denken. „Ich ertrag die Oberflächlichkeit und die aufgesetzte Coolness nicht, das Englisch, die gute Laune und das Gebrüll.“ Ein letztes Mal wechseln wir die Lokalität, gehen in die Meuterei schräg gegenüber.
An den Wänden hängen Plakate mit der Aufschrift „Stille Straße bleibt“ und „20 Jahre Rostock-Lichtenhagen“, aus den Boxen dringt Musik mit orientalischem Einschlag. Wir bestellen vier Fassbrause à 1,30 Euro. Wie schön, in einem so unprätentiösen, uncoolen Laden zu sitzen. Erleichtert atmen wir durch. Natürlich ist es toll, was man in Berlin alles erleben kann: von der Hardcore-Laden in die Schwulenbar, von der Hipsterhölle in die Politkaschemme – und das alles im Umkreis von zehn Minuten. Aber man kann sich auch vorkommen wie auf einer Interrail-Tour: Das Abteil heißt Kreuzberg, das Ziel Montagmorgen – und im Grunde ist den meisten ist es ziemlich egal, wo sie sind.
(2012)
Der Mann, der nie ein Dicker werden wollte
Vor 30 Jahren erschien sein Album „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ – ein Klassiker der deutschen Popgeschichte. Später nannte sich Marius nur noch Westernhagen und tauschte die Lederjacke gegen Designeranzüge. In dieser Woche feiert er seinen 60. Geburtstag.
Als ich zwölf war, schenkte mir mein Bruder eine selbst aufgenommene Kassette. Auf der einen Seite gab‘s das Abschiedskonzert der Punkband Slime, auf der anderen das Westernhagen-Album „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“. Eine Kombination, die für andere etwas merkwürdig anmuten mochte – doch für mich handelte es sich um Brüder im Geiste.
Während Slime „All cops are bastards“ skandierten, sang Marius Müller-Westernhagen gegen Polizeiwillkür an; während Slime dem Oberpiraten Störtebecker huldigten, besang Marius den Hehlerkönig Willy Wucher. Und hieß es bei Slime unheilschwanger: „Es ist bei uns wieder mal so weit, nur ein kurzer Weg bis zum 4. Reich“, so warnte Marius – nur um Nuancen vorsichtiger: „Eines ist mir sonnenklar, falls wir glauben sollten, Terror kann man durch Terror bremsen, dann sind wir bald wieder so weit.“ Für mich handelte es sich jedenfalls nicht nur um zwei Seiten der selben Kassette, sondern auch der gleichen Medaille; es um Außenseiter und Ausgestoßene, ums Aufbegehren und um Authentizität.
Zwar war „Pfefferminz“ bereits Westernhagens viertes Album, jedoch das erste mit unverwechselbar eigener Handschrift: Zehn knappe Songs, kein schwacher Titel, eine Platte wie aus einem Guss. Worum es ging, sagte im Grunde schon das Plattencover: Oben prangte der Name des Sängers in der Glück verheißenden Neonschrift eines Pornokinos, darunter eine Eckkneipe mit Trinkern, Nutten und zwielichtigen Typen, in der Mitte der dürre Hering Marius in Jeans und in Lederjacke. Sämtliche Figuren aus den Songs schienen hier versammelt: Margarethe, Willy, Klaus, Peter – Menschen, die von der Vergangenheit träumten oder der Zukunft; die sich nach der großen, weiten Welt sehnten und es doch nur bis in die Bahnhofsgaststätte schafften.
Natürlich war das nicht meine Welt, die Welt eines Gymnasiasten aus Berlin-Wilmersdorf – aber es war eine Welt, die Echtheit und Freiheit verhieß, jenseits jeder spießbürgerlichen Moral. Ganz so, wie Marius es in „Ab 18“ versprach: „Ich möchte zurück auf die Straße, möcht‘ wieder singen, nicht schön, sondern geil und laut. Denn Gold find‘ man bekanntlich im Dreck, und Straßen sind aus Dreck gebaut.“
Als Alternative drohte ein Leben wie das von Klaus, dem das Arbeitsamt den Job ausgesucht hatte und die Eltern Sabine, und den ich nehmen und schütteln wollte, damit er sein Leben endlich in die Hand nahm. Das unverfrorene Stück „Dicke“ hörte ich weniger als Affront gegen Fettleibige, denn vielmehr als trotzigen Trost für einen schmächtigen Körper; und wenn Marius im fröhlich-anarchischen Titelstück proklamierte: „Glaubst du an den lieben Gott? Oder an Guevara? Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in bar“, dann ließ er damit sogar die Anarcho-Punks von Slime alt aussehen.
Dabei war es nicht die Musik, die etwas Besonderes war (nicht mal beim Erscheinen der Platte anno 78): Marius röhrte, krähte und nölte sich durch straighte Rock ’n Roll-Nummern und erdigen Blues. Was neu und besonders war, war die Haltung: das Rotzige, Trotzige, Frische. Westernhagen war unverschämt unverstellt, er konnte einen Dicken als „fette Sau“ titulieren und das Wort „Neger“ singen, ohne dass man’s ihm krumm nahm. Und als er kurz darauf in „Theo gegen den Rest der Welt“ auch noch das Stehaufmännchen mit den Nehmerqualitäten gab, da hatte er dem Underdog endgültig ein Denkmal gesetzt. Eins war klar: Es gab nichts Cooleres, als ein Loser zu sein. Hauptsache, die Klappe war groß genug.
Читать дальше