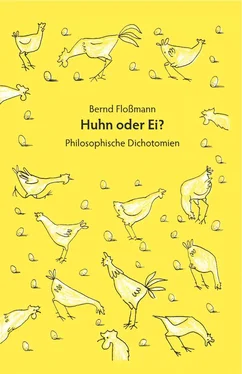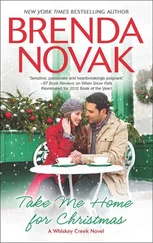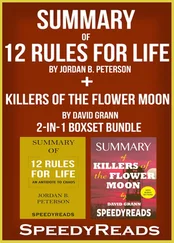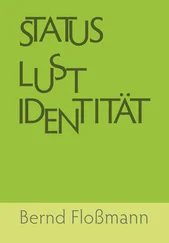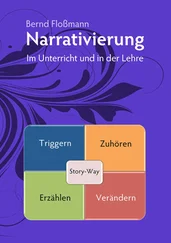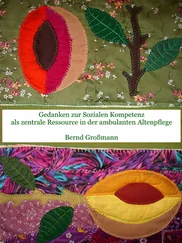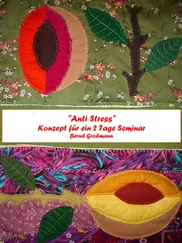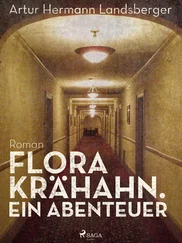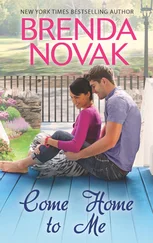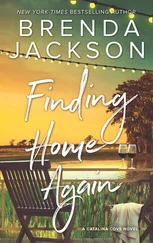So bezeichnet das von den Atomisten Demokrit, Leukipp und Epikur eingeführte Wort Atom »Ungeschnittenes“. Der Unterschied zwischen Ungeschnittenem und Unteilbarem ist im Laufe des philosophischen Denkens vergessen worden und erst durch Hegel wieder ins Bewusstsein gekommen. Deshalb spricht Hegel immer von »das Atome“, nicht von »dem Atom“. Und von ihm stammt auch das geniale Wort vom »Ungeteilten“(Hegel 2000: 431) im Gegensatz zum Getrenntsein von Begriffen. In der schulischen Umgangssprache kann gelegentlich die Formulierung gehört werden: »Die Familie der Rüsseltiere zerfällt in Waldelefanten, asiatische und afrikanische Elefanten!“ Natürlich zerfällt hier gar nichts, es wird bewusst unterschieden, was in der Natur gemeinsam existiert.
Aber diese Sprechweise korrespondiert mit dem gesunden Menschenverstand, der überall zwei Wesen wittert: Ich und Andere, Gute und Böse, Große und Kleine, Gewinner und Verlierer, Besitzende und Besitzlose und so weiter. Deshalb hält sich dieses trennende, im Gegensatz zum unterscheidenden, Sprechen trotz der offensichtlichen Falschheit im öffentlichen Bewusstsein, ja wirkt bis in das Philosophieren selbst zurück.
Auch Begriffe sind voneinander nicht zu trennen, nur zu unterscheiden. Es sollte überhaupt vorsichtig mit dem Terminus »trennen“ umgegangen werden, der hat zu zweitausend Jahren sinnloser philosophischer Diskussion geführt, wie zum Beispiel an der Diskussion um Sein und Bewusstsein nachvollzogen werden kann. Was du getrennt hast, kannst du wieder zusammenfügen. Aber es wird dir geschehen, wie dem Anatomen, den Hegel beschrieben hat als Einen, der versucht die Teile eines Menschen wieder fein säuberlich zusammenzufügen, nachdem er ihn auseinandergenommen hat und doch kein Leben mehr hineinbringt.
Im Übergang vom griechischen zum römisch-lateinischen Philosophieren ist dieses Wissen verloren gegangen. Die Römer benutzen das Wort Individuum: In–divi–duum → nicht–teilbar in–zwei-Teile. Dass bis in den heutigen Sprachgebrauch mit diesem Wort einzelne Menschen bezeichnet werden, ist aus dem griechischen Erbe erhalten geblieben, dass es sich aber um etwas Ungetrenntes handelt, etwas, was nur im Zusammenhang mit dem lebendigen Umfeld, dem οίκος (oikos ’Haus’) verstanden werden kann, ist vergessen worden. Teil und Ganzes blieben seit dieser Zeit Rätsel, welche Zenon mit seinen Aporien auf die Spitze getrieben hat, denn, so die Voraussetzung, dieses Verschiedene kann nicht dasselbe sein. Das wäre widersinnig.
Das Argument der Widersinnigkeit, das sehr oft bei Aristoteles vorkommt, ist sehr eigenartig. Widersinnig heißt »wider unseren Sinneseindruck“. Aristoteles aber benutzt den Ausdruck als »ist gegen den Bewegungssinn der Logik gerichtet“.
Auch daran hat Aristoteles seinen Anteil. Seine Bevorzugung der πολιτικὴ κοινωνία (politiké koinonia ’Zivilgesellschaft’) gegenüber dem οίκος λόγος (oiko logos ’Haushalt’) begünstigte eine trennende gegen eine unterscheidende Denkweise. Für Aristoteles war die Sicherung der Grundbedürfnisse im Haushalt des privaten Interesses (ἰδιότης idiótes) nicht so notwendig und wichtig wie das tugendhafte Handeln in der Stadt (πολις). Für ihn war der Mensch vorrangig ein ζῷον πολιτικόν (zoon politikon), ein Lebewesen in der Polisgemeinschaft. Dieser Gedanke klingt sogar noch bei einem seiner schärfsten Kritiker, Karl Marx, nach, wo dieser in seiner 6. Feuerbachthese behauptet:
»Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“ (Marx 1969: 5 ff)
Utopische Ideen neigen dazu, von freien Individuen, basierend auf gesellschaftlichem Eigentum an den Produktionsmitteln zu träumen. Karl Marx machte da keine Ausnahme: Er fand mindestens drei typische Gesellschaftsformationen: erst, ganz naturwüchsig auf persönlicher Abhängigkeit beruhend – Sklaverei und Feudalismus, dann auf persönlicher Unabhängigkeit aber gegründet auf sachlicher Abhängigkeit – Kapitalismus und schließlich:
»Freie Individualität, gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität, als ihres gesellschaftlichen Vermögens, ist die dritte Stufe.“ (Marx 1983: 91)
Lange Jahre haben die Menschen in den »sozialistischen“ Ländern gehofft oder geglaubt, in einer solchen Gesellschaft zu leben oder irgendwann leben zu können. Dafür haben viele von ihnen auf ihre freie Individualität verzichtet und sich dem Willen einer Partei untergeordnet. Aber Pustekuchen! Das Privatinteresse, die Idiotie der kleinen Leute an ihrem Haushalt, an kleinen Reisen und einem einigermaßen guten Leben hat all die großen Hoffnungen auf Sozialismus und Kommunismus, vom Leben in einer glücklichen Gemeinschaft politischer, bewusster, allseitig entwickelter Persönlichkeiten innerhalb weniger Monate des Jahres 1989 wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen. Unterordnung der gemeinschaftlichen Produktivität ist ohne freie Individualität, so hat sich erwiesen, nur eine andere Form feudaler, persönlicher Abhängigkeit – daher die Bedeutung persönlicher Beziehungen im internen Markt der sozialistischen Staaten wie in den sozialen Marktwirtschaften auch und daher der Trend zur Familiendynastie, wie sie noch heute im so genannten kommunistischen Nordkorea oder auch in China, aber auch gelegentlich in der Abfolge amerikanischer Präsidenten beobachtet werden kann.
In diese Denkungsart fällt auch die Verwechslung von Konkurrenz – eigentlich das gemeinsame Auftreten auf dem Markt – mit dem von Plautus, einem römischen Komödiendichter (!) beklagten Wolfsgesetz: »Der Mensch ist des Menschen Wolf“. Selbst Wölfe können nicht in angeblich unversöhnlicher Feindschaft allein existieren. Dieser Gedanke wird oft Hobbes zugeschrieben. Doch er wird von diesem komplexer betrachtet, indem er schreibt, es seien
»… beide Sätze wahr: Der Mensch ist ein Gott für den Menschen, und: Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen; jener, wenn man die Bürger untereinander, dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht.“ (Hobbes 1966: 59)
Was geschieht hier? Wer hat ein so großes Interesse, der Philosophie etwas zu unterstellen, was in ihr nicht geschieht, wer hat ein Interesse Philosophen Sätze in den Mund zu legen, die sie nicht gesagt haben, wer ist daran so brennend interessiert, statt wissenschaftlicher Diskussion nur unsinniges Geschwätz zu kolportieren?
Wer reduziert die Geschichte der Philosophie auf den immerwährenden Streit zwischen zwei Meinungen?
Weder die Frage nach den Engeln auf der Nadelspitze lässt sich historisch belegen, noch die Diskussion über Huhn oder Ei. Diese Anschuldigungen gegen die Philosophie erweisen sich bei einiger Nachprüfung als üble Nachrede.
Das Geheimnis löst sich auf, in dem die Erzählweise des öffentlichen Bewusstseins, vertreten durch den gesunden Menschenverstand, genauer betrachtet wird: Es gibt offenbar ein öffentliches Bedürfnis nach einer einfachen Erzählung (Narrativierung) komplexer Strukturen. Diese einfache Erzählung sollte so weit als möglich den Augenschein abbilden. Sie sollte auch den gesunden Menschenverstand auf keine allzu harte Probe stellen.
Was sind die Elemente dieser Narrativierung? Es sind:
Dualisierung
Antagonisierung
Symbolisierung
Dramatisierung und
offene Finalisierung.
Das erste Element ist der Trend zum Dualismus. Zusammen gehörende ungeteilte Gegensätze werden als selbständige Individuen unterschieden und als getrennte Wesenheiten betrachtet. Aus den miteinander auf Tod und Leben verbundenen Agenten des Kapitals »Kapitalist“ und »Arbeiter“ werden so zum Beispiel Todfeinde, die einander vernichten wollen, um nach Vernichtung des Feindes autonom existieren zu können. Die einen sind die Guten und die Anderen sind die Bösen. Und die Bösen sind nur böse und die Guten, nun ja, sind weitestgehend gut und manchmal ein klein wenig böse wegen der Individualität, verstehen Sie? Dritte Figurengruppen, wie die Intelligenz, wechseln gelegentlich die Seite oder bewegen sich in und aus einer Metaebene wie ein Deus ex machina. Diese Figuren, welche sich noch einen Rest der Einheit der Gegensätze gesichert haben, beschreiben sich oft selbst als die eigentlich interessanten und aufregenden Figuren des Dramas.
Читать дальше