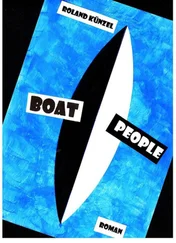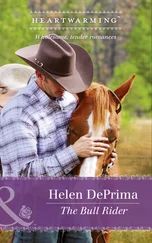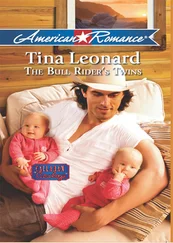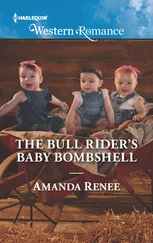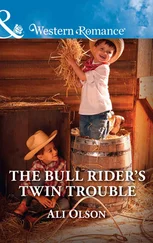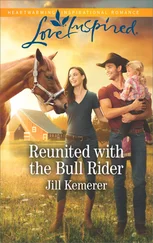"Stell' dir vor, die Räder wären h i e r über dich -", und der Rest geht in prustendem Gelächter unter.
Besorgt schaut die barmherzige Schwester Eusebia durch den Türspalt. Gegrüßet seiest Du, Maria... Sie sieht zwei zwölfjährige Jungen, die sich gegenüber sitzen und den Bauch halten vor Lachen. Danach ist Hans so erschöpft, dass er wieder in seine Kissen zurücksinkt. Aus halb geschlossenen Lidern mustert er den Freund, der im Zimmer auf und ab geht. Bewunderung? Verwunderung? Eben noch einen Pfeil im Gesicht, und schon denkt er ans Weitermachen.... Die blitzenden, braunen Augen, die Witz und Freude verströmen, aber auch rätselhafte Melancholie... So etwas kann ein Zwölfjähriger noch nicht beschreiben. Aber er spürt es.
"Morgen komme ich wieder", sagt August zum Abschied. "Und dann bringe ich dir etwas mit."
Er hält Wort.
"Rate mal, was ich dabei habe!"
August hat das Krankenzimmer betreten und hält die Hände hinter dem Rücken verschränkt.
"Keine Ahnung."
Hans setzt sich im Bett auf und vergisst für einen Moment die Schmerzen in seinen frisch verbundenen Beinstümpfen.
"Etwas, womit du immer gern gespielt hast. Ich habe es gestern für dich geschnitzt."
"Mach's nicht so spannend, August."
"Attacke!!!"
Mit drohend gezücktem Schwert springt August vor das Bett des Amputierten, als wolle er ihn zum Duell herausfordern. Attacke!
Hans schaut zur Seite.
"Ein Schwert", sagt er leise.
"Was ist? Freust du dich denn gar nicht?"
"Ach schon", antwortet Hans, ohne August anzusehen. Er schämt sich seiner Tränen, während er sich seiner Kämpfe erinnert: draußen, zwischen Brennnesseln, Ziegelsteinen und Marterpfählen. Pfeile, Lassos, Schwerter, Geschrei; Angriff und Rückzug, wenn die Übermacht der Feinde zu groß war. Sprünge wie ein Känguru; Hangeln, Klettern mit Armen und Beinen... mit Armen und Beinen...
An diesem Tag verlässt August das Krankenhaus gesenkten Kopfes. Am Gürtel seiner Hose baumelt lustlos ein hölzernes Schwert, das später auf seinem Kleiderschrank verstauben wird.
+ + +
Wieder steht Schwester Eusebia als schwarzer Schatten in der Tür, und wieder traut sie ihren Augen nicht. Diesmal hat kein unpassendes Lachen ihren Verdacht erregt, sondern die Tatsache, dass aus dem Krankenzimmer, in dem die beiden Buben sind, kein einziger Laut dringt.
Was ist los?
Wieder sitzen sich Hans und August gegenüber; der eine mühsam aufgerichtet in seinem Bett, der andere auf dem Schemel, der daneben steht. Nein, diesmal halten sie sich nicht die Bäuche vor Lachen. Die Atmosphäre am Krankenlager hat sich verändert. Zwischen Schemel und Bett steht ein kleiner Tisch, und auf dem Tisch liegt ein Bogen Papier, der von bunten Kamelen, Dattelpalmen, Minaretten und Beduinen bevölkert ist.
Ein Pinsel gleitet lautlos durch die Szenerie, verharrt kurz, beschreibt einen Kreis und verschwindet schließlich im Teeglas des Patienten, das statt Kamillentee nun trübes, schmutziges Wasser enthält. Schwester Eusebias Mund öffnet sich erstaunt, aber sie sagt kein einziges Wort.
Knallgelb und gnadenlos prallt die Wüstensonne vom wolkenlosen Himmel - "... wie bitte? Das ist dir zu heiß? Zu trocken?" - bis sich das Firmament durch wenige Pinselstriche verfinstert, grau wird, schwarz wird, und ein Wolkenbruch auf die armen Kamele und ihre Beduinen hinunterprasselt. Die letzten Tropfen pustet August über das Papier, bis sie getrocknet sind.
"Jetzt geht's erst richtig los! Amerika!"
Die Wüste wird zur Seite gelegt, das nächste Blatt hervorgezogen und das schmutzige Wasser im Teeglas erneuert. Amerika...: Indianer mit abenteuerlich rot und weiß geschminkten Gesichtern. Mustangs mit wehenden Mähnen. Tomahawks! Lassos! Marterpfähle... er kann nicht aufhören. Aber Hans sagt kein Wort. Er schaut. Mit den Blicken ist er ganz nah bei den Bildern, die sein Freund für ihn malt. Mit den Gedanken ist er ganz weit weg: Auf großen, starken Beinen durchquert er die Wüste Sahara, durchwatet den Atlantik und erreicht mit Siebenmeilenstiefeln das Land der Prärien und unendlichen Träume.
Schwester Eusebia schließt leise die Tür und zieht aus ihrer schwarzen Nonnenkluft ein kleines weißes Taschentuch. Ganz unauffällig wischt sie sich damit über die Augen. Sie entfernt sich auf Zehenspitzen.
Ein Sommerabend im Tannenbusch, dem großen Exerzierplatz im Norden der Stadt, auf dem sich keine einzige Tanne befindet. Dafür wird er von hochgewachsenen Pappeln eingerahmt, die noch auf Napoleon zurückgehen. Die Neuzeit hat dem Gelände eine weitere Begrenzung gebracht: den Bahndamm. Immer wieder poltern auf seinen Gleisen funkenspeiende Lokomotiven vorüber und ziehen dabei lange, weiße Dampfwolken hinter sich her.
August liegt im Gras unter den Bäumen, schaut den Zügen nach und sieht zu, wie sich hinter ihnen die Wolken in der Glut des Abendhimmels langsam auflösen. Erst hatte der weiße Nebel, der aus dem Schornstein gequollen ist, den Horizont verhüllt und seine leuchtenden Farben ausgelöscht. Doch je dünner die Dampfschwaden werden, desto stärker gewinnt das Licht wieder die Oberhand: Es kündigt sich an als ein zartes Blau, zu dem sich allmählich violette Töne gesellen, die schließlich dem flammenden Rot des Firmaments Platz machen.
August kaut an einem Grashalm. Er schmeckt nach Sommer. Es riecht nach Sommer. Sommerlicht. Sommerwärme. Die Arme im Nacken verschränken. Hochschauen, dorthin, wo die Welt zuende ist. Die Farben eines Sommerhimmels, der nicht dunkel werden will, rieseln auf ihn herab wie Sternschnuppen. Ist er glücklich?
Er lächelt, weil ihm das Mädchen eingefallen ist, das ihm täglich auf dem Schulweg begegnet. Ihre schwarzen Haare hat sie im Nacken locker zusammengesteckt. Sie kann nicht viel jünger sein als er; vielleicht ist sie fünfzehn. Sie scheint die Töchterschule zu besuchen. Jedenfalls geht sie morgens in ihre Richtung und kommt mittags von dort zurück.
Das Mädchen irritiert ihn. Es weicht seinem Blick nicht aus, wenn es an ihm vorbeigeht. Im Gegenteil: freundlich, mit einer Spur von Neugier, schaut es ihm ins Gesicht und hält seinem Blick stand. Das ist ungewöhnlich. Und wenn es manchmal sogar lächelt bei der Begegnung, dann deswegen, weil es ihrerseits in zwei aufmerksame braune Augen schaut, die unter der Krempe eines schwarzen Schlapphuts hervorleuchten. Einen Packen Bücher unter dem Arm, den Kopf leicht zur Seite geneigt - so, wie er auch seine Bilder betrachtet - geht er an dem Mädchen vorbei. Bald weiß jeder vom andern, in welchem Haus er wohnt, obwohl noch kein einziges Wort zwischen ihnen gefallen ist.
Lisbeth verschwindet im Haus der Fabrikantenfamilie Gerhardt, während August noch ein paar Schritte weiter geht, vorbei am alten Friedhof, bevor er sein Domizil in der Meckenheimer Straße erreicht. Zwar ist das Haus geräumig, aber die meisten Zimmer sind vermietet. Augusts Vater ist in Bonn nicht mehr Glück beschieden als in Köln. Seit die Baufirma, an der er beteiligt war, bankrott ist, hält seine Frau die Familie durch Pensionsgäste über Wasser: eine bunte Mischung aus Studenten, Dozenten, Künstlern und Gymnasiasten, die das Mackesche Haus bevölkert; jung an Jahren, klamm an Geld, strotzend vor Kraft, Ideen und Zeit; Tischgespräche und Diskussionen bis in die Nacht. Trotz aller äußeren Knappheit, spürt August, ein reiches Leben. Ist er glücklich?
Er seufzt, reibt sich die Augen und sieht dem entschwindenden Tag hinterher. Lisbeth und leuchtender Himmel. Die Farben des Glücks, die sich wie ein Regenbogen in der Dunkelheit verlieren; in einem Abgrund voller Melancholie.
August steht auf und schüttelt den Staub von seinen Kleidern. Langsam schlendert er heimwärts. Der Weg führt immer am Bahndamm entlang. Auf der anderen Seite dehnen sich Kornfelder, die langsam in die Vorstadt übergehen. Von weitem grüßt der Turm der Marienkirche.
Читать дальше