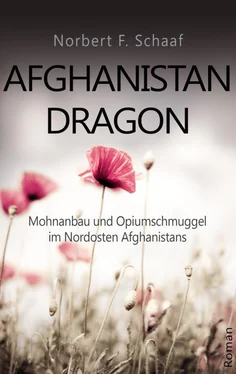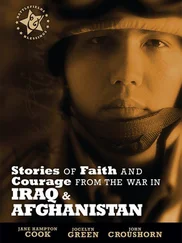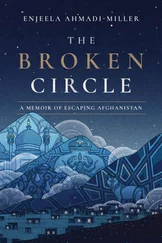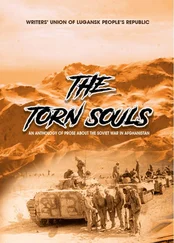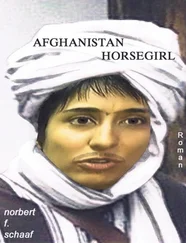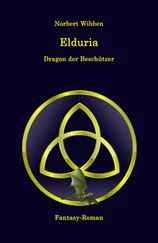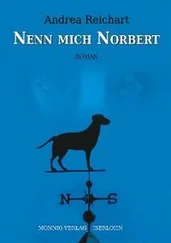Das Mädchen starrte ihn an. Jalaluddin nickte müde. „Und sie haben nichts weiter gesagt, qariadar?“
„Gesagt haben sie, dass sie ihn wegen unerlaubtem Verkauf von Rohopium mitnehmen.“
„Dem Händler haben sie nichts getan?“
„Nein. Er hat noch erwähnt, dass es das erste Mal war seit langer Zeit, dass so etwas geschah. Überall wird gelegentlich Opium angeboten, meistens kleinere Mengen, aber die Polizei hat sich sonst nie darum gekümmert.“
„Weißt du, wohin sie ihn gebracht haben?“
„Ins Stadtgefängnis. Ich war dort, aber man ließ mich nicht zu ihm. Ich bin auch zu einem Anwalt gegangen. Der Händler hat es mir geraten. Der Anwalt hat mit den Beamten im Gefängnis gesprochen. Und die haben ihm gesagt, er soll sich die Mühe sparen. Mir Khaibar wurde zur weiteren Untersuchung des Falles nach Kabul gebracht. Wenn er einen Beistand braucht, wird er ihn dort bekommen.“
Jalaluddin hob die Hände und drehte die Handflächen nach oben, raue, rissige Handflächen. Eindringlich sah er Sanaubar an und schloss bedrückt: „So bin ich heimgekommen. Kein Geld, nicht einen einzigen Afghani. Das Opium ist verloren, und niemand weiß, was aus Mir Khaibar wird.“
Eine Weile saßen sie nebeneinander und überlegten. Was da geschehen war, konnten sie sich nicht erklären. Gewiss, es gab das Verbot des Opiumhandels. Doch warum musste Mir Khaibar der erste sein, auf den es angewandt wurde? Und warum sollte er nach Kabul gebracht werden?
Sanaubar entschied schließlich: „Wir müssen etwas unternehmen. Ich werde meiner Khala schreiben. Vielleicht wird sie herausfinden, wie wir Mir Khaibar helfen können.“
Jalaluddin äußerte zögernd: „Du willst dich an Shalla wenden? Aber – vielleicht ist es ihr nicht recht?“
„Sie wird uns helfen.“
Shalla war die jüngste Schwester ihres früh verstorbenen Vaters. Ihr Leben war ein wenig seltsam verlaufen, Sanaubar wusste nicht viel darüber. Sie hatte ihre Tante ein einziges Mal gesehen, vor einigen Jahren, als Shalla in Begleitung ihres Mannes für einige Tage in das Dorf gekommen war. Und es war wohl der Mann, der Jalaluddin zweifeln ließ. Shalla war mit einem Kanadier verheiratet, der sich vor annähernd dreißig Jahren in Afghanistan niedergelassen hatte. Es hieß, sie habe diesem Kanadier, als sie selbst noch ein Kind gewesen war, das Leben gerettet, damals, während des schlimmen Krieges gegen die Russen. Doch die Einzelheiten dieser Geschichte kannte Sanaubar nicht. Jalaluddin gab vor, sie auch nicht genau zu kennen. Sanaubar erinnerte sich nur daran, dass Shalla ihr Hilfe versprochen hatte, für den Fall, dass sie sie einmal brauchen sollte. „Wir sind ziemlich wohlhabend“, hatte sie gesagt. „Wir haben keine Kinder. Wenn du in Not kommst, erinnere dich an uns.“
Sanaubar hatte von Khaled erfahren, dass er die Verwandten gelegentlich besuchte. Schließlich verdankte er ihnen die Vermittlung seines Studienplatzes.
„Ich werde sofort schreiben“, erklärte das Mädchen. Sie lief zum Haus, um Papier und einen Stift aus einem Kampferholzkasten zu holen.
In der Hütte angekommen sah sie zuerst nach Shanzai, einem versehrten jugendlichen Mädchen, das bei einem Selbstmordattentat auf dem Bazar in Faïzabad ihre gesamte Familie sowie sämtliche Gliedmaßen eingebüßt hatte außer dem rechten Bein. Geschehen damals, kurz vor der „Zeit der dunklen Bärte“, als die Bürgerkriegsparteien des Golbud-Din Hekmatyar und des Ahmad Schah Massoud sich bis aufs Blut zerfleischt hatten.
Shanzai hatte selbst keine Erinnerung daran; sie war noch zu klein gewesen, und eine schwere Gehirnerschütterung hatte wohl auch vorlegen. Gelegentlich veranlasste sie Sanaubar, ihr den Hergang zu erzählen. Es war an einem heißen Sommertag gewesen. Kinder waren auf dem Nachhauseweg von der Schule. Kurz bevor sie den Rand des Bazars erreichten, geschah es. Eine gewaltige Detonation. Ein infames Selbstmordattentat, wie sich rasch herausstellte. Die Eltern, als man ihnen die schreckenerregende Nachricht brachte, eilten herbei, irrten hysterisch kreischend am Unglücksort herum, eine Mutter sammelte Teile ihres Sohnes in ihre Schürze ein, Shanzais Kaka Noor, der Bruder ihrer Mutter, barg von seiner Nichte, was übrig geblieben war, die Verwandten fanden erst Tage oder Wochen später von ihrer geliebten Angehörigen einen Arm, einen Ellbogen, eine Hand und das Bein, dessen Fuß noch in Strumpf und Schuh steckte und bereits in Verwesung übergegangen war, auf dem Dach eines der umstehenden Häuser. Shanzai konnte schwerversehrt gerettet werden. An den schmerzhaften, langwierigen Prozess der Genesung hatte sie nur schemenhafte Erinnerungen – bruchstückhaft wie das, was das Leben von ihr übriggelassen hatte.
„Hallo, Sanaubar jo“, grüßte Shanzai, während sie der Freundin auf ihrem einen Bein entgegenhüpfte mit der geschmeidigen Anmut eines jungen Kängurus. „Ist etwas Schlimmes passiert?“
Sanaubar antwortete ausweichend. „Es sind schlimme Zeiten, Shanzai jo.“
„Auf Sonnenglut folgt Regenguss“, sagte Shanzai.
„Es war etwas Schlimmeres als schlechtes Wetter.“
„Es gibt gar kein schlechtes Wetter. Das sagt auch Khaled jo. Es gibt nur nützlicheres und schädlicheres Wetter.“
„Ach, Shanzai jo, zurzeit scheint sich alles zum Schlechteren zu wenden.”
„Es kommen auch wieder gute Zeiten“, sagte Shanzai. Sie stand still mit erhobenen Haupt und der stromlinienförmigen Grazie eines Flamingos, die Sanaubar lächeln ließ.
Nachdem Sanaubar ihrem Pflegling die hijab auf ihrem pechschwarzen Haar gerichtet und sie mit dünnem chai versorgt hatte, kehrte sie mit den Schreibutensilien zu Jalaluddin zurück und ließ sich wieder auf dem Stamm nieder. Sie musste bei jedem Wort nachdenken, denn sie schrieb nicht oft. Gelernt hatte sie es von einem ehemaligen Soldaten, der ins Dorf zurückgekehrt war. Man hatte ihm bei der Armee Lesen und Schreiben beigebracht, und er hatte seine Kenntnisse an einige jüngere Leute im Dorf weitergegeben. Jalaluddin sah dem Mädchen zu, wie es das Papier mit den seltsam verschlungenen Linien der Dari-Schrift füllte. Als sie endlich fertig war, brach die Nacht herein.
„Ich bringe den Brief morgen nach Shari-i-Buzurg“, sagte Sanaubar. „Wenn ich zeitig genug aufbreche, kann ich vor Nachteinbruch dort sein. Am nächsten Abend bin ich zurück.“
Jalaluddin nickte nur, obwohl er sie nicht gern allein den fünfzig Kilometer weiten Weg durch die Berge machen ließ. Von Shari-i-Buzurg, der nächsten Poststation aus, würde der Brief mindestens noch eine Woche bis Kabul brauchen. Was mochte bis dahin aus Mir Khaibar geworden sein?
Während es dunkelte, kochte Sanaubar eine bescheidene Reismahlzeit. Irgendwo wurden shahnai-Flöten geblasen und dohol-Trommeln geschlagen. Jalaluddin dachte daran, dass er am frühen Morgen auf die Mohnfelder hinausgehen musste. Bei dem beschlagnahmten Opium hatte es sich um Gemeinschaftseigentum gehandelt. Wie sollte er nur den Dorfbewohnern den Verlust beibringen? Der Alte strich unruhig durch den großen Raum des Lehmhauses. Er fasste hier einen Kochtopf an und dort eine Matte, stand herum, ein wenig ratlos, bis Sanaubar zu ihm trat und ihn aufforderte: „Leg dich schlafen, Jalaluddin. Es wird alles gut werden. Mach dir jetzt keine Gedanken mehr.“
Sie selbst verließ noch einmal das Haus und lief zur Wasserstelle. Aus den Bergen sickerte ein Rinnsal bis in die Nähe des Dorfes, wo die Bewohner einen Schacht angelegt hatten, in dem sie es auffingen. Sanaubar schöpfte mehrere Eimer voll und trug sie in das Badehaus. Es diente allen. Heute aber war niemand da außer Sanaubar. Sie warf das verblichene Kleid ab, dessen einst tiefblaue Farbe die Sonne in ein schmutziges Grau verwandelt hatte. Dann ließ sie sich das Wasser aus den Eimern über den Körper laufen. Sie griff in den Haufen feinen Sandes, der im Badehaus lag, und rieb damit die Haut. Seife gab es nicht, sie war teuer, und man musste sie aus Faïzabad holen. Darum begnügte man sich mit dem Sand aus den Bergen.
Читать дальше