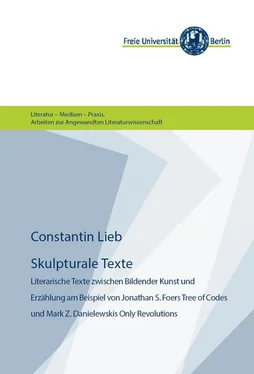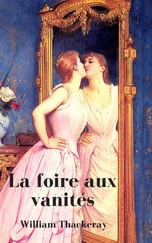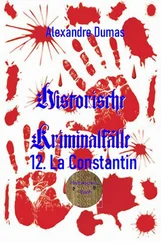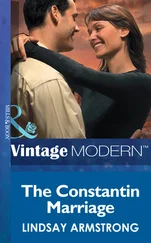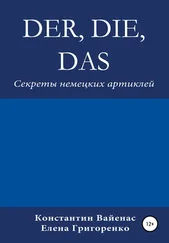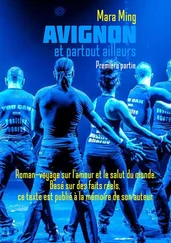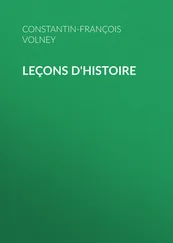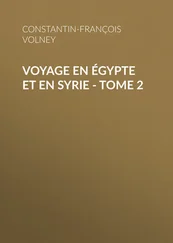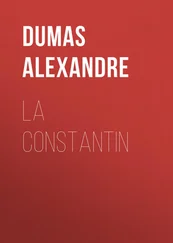1 Der Körper des Buches
1.1 Mallarmé – Barthes – Hine
2 Skulptur – Plastik – Buchobjekt
2.1 Skulptur oder Plastik?
2.2 Erweiterung skulpturaler Motive und Darstellungsformen im 20. Jahrhundert
2.3 Buchobjekte – Künstlerbücher
2.4 Erste Zusammenfassung
3 Das Buch der Lücken
3.1 Zu Jonathan Safran Foer
3.2 Die Vorlage: Bruno Schulz
3.3 Inhalt und Referenz in Tree of Codes
3.4 Anwesend in der Abwesenheit – Leerstellen bei Tree of Codes
3.5 Tree of Codes als skulpturaler Text
4 Das Buch der Bewegung
4.1 Zu Mark Z. Danielewski
4.2 Kreis und Zahlenspiele bei Only Revolutions
4.3 Für immer und ewig jetzt – Inhalt und Sprache
4.4 Only Revolutions als skulpturaler Text
5 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Sofern nicht anders angegeben, wurden ausschließlich eigene Fotos verwendet.
Zeilenumbrüche bei Un Coup de dés / Ein Würfelwurf
Wolkenmarmorpapier und Typographie bei Indigo
Claes Oldenburg im Museum Ludwig
Anthony McCall im Hamburger Bahnhof
Analphabetisches Monument
Scharfes Buch
Die erste Seite bei Tree of Codes
Leser-Interaktion bei Tree of Codes
Lücken bei Tree of Codes
Scan-Ästhetik, Spalten und Typographie in Das Haus
Spaltenaufteilung bei Only Revolutions
Typographie bei Only Revolutions
Innenspalten bei Only Revolutions
Farbliche Markierung bei Only Revolutions
ToC Tree of Codes
OR Only Revolutions
Sich auf zwei derart komplexen Feldern wie dem der Bildenden Kunst und dem der Literaturwissenschaft gleichzeitig zu bewegen, noch dazu, wenn die Arbeit hinsichtlich ihres Umfangs bestimmten Einschränkungen unterliegt, gleicht in etwa dem Versuch, auf einem Basketballfeld eine Partie Fußball zu spielen. Obwohl zwei Mannschaften, zwei Tore/ Körbe und ein Ball vorhanden sind, ist es ein ziemlich makabres Unterfangen, betreibt man das Spiel nicht nur aus Jux, sondern mit einem tatsächlichen Anliegen. Dass es nicht ohne eine gewisse Form von Freizügigkeit in der Argumentation geht, liegt in der Sache selbst. Aus Richtung der Kunstwissenschaft kann man durchaus Befremden über die grobe Auswahl der angeführten Werke und Künstler aufbringen und auch das Aussparen des zeitgenössischen Kunst-Diskurses beklagen. Von Seiten der Literaturwissenschaft mag wiederum die freie Reflexion über Autorschaft und Werk, gerade in Zusammenhang mit dem Fernbleiben des sonst so gerne ausgeschlachteten Duktus literaturwissenschaftlicher Analyse, befremden. Hätte man sich aber zu Gunsten der einen oder der anderen Seite stärker auf einen Fachdiskurs eingelassen, wäre es unmöglich geworden, dem eigentlichen Anliegen dieser Arbeit nahe zu kommen. Man wäre zwar mit dem zum Spielfeld passenden Ball unterwegs, aber stets von den eigenen Spielern blockiert gewesen. Gerade die produktive Verquickung beider Rezeptionsmechanismen ist es nämlich, die mich bei der Beschäftigung mit Tree of Codes und Only Revolutions interessiert hat. Ein Buch nicht nur als Buch, sondern auch als Skulptur zu verstehen und damit den Begriff der Skulptur auch ins Spielfeld der Literatur zu werfen, war mein prinzipielles Anliegen. Wie man nun mit diesem Spielball am besten agiert, müsste in anschließenden Arbeiten untersucht werden.
Berlin, im August 2014
Constantin Lieb
1 Der Körper des Buches
1.1 Mallarmé – Barthes – Hine
„The book has a nervous system, as the term spine surely promises.“1
Das Buch verstanden als Körper und der Körper des Buches als Gegenstand mit sinnlich wahrnehmbarer Außenhaut und geistigem Innenleben. Zunächst einmal lediglich ein Gedankenspiel. Denken wir uns den Rücken des Buchs als physischen Rücken, verstehen wir die darin umtriebige Schrift als Nervensystem, Gedanken-Transmitter, also als eine Art Grundlage des Lebendigen und Voraussetzung einer Lebenswirklichkeit, die in Kommunikation zwischen Werk und Rezipient fundiert ist. Damit steht der potentielle Leser nicht nur einem Objekt gegenüber, sondern dem Gegenpart einer Kommunikationsrelation. Beide sind gleichgestellt, agieren und reagieren miteinander. Hank Hine, Mitgründer des berühmten Verlagshauses Limestone Press in San Francisco, hat in der oben zitierten spielerischen Aussage den grundlegenden Wert eines Buches fern seiner Entindividualisierung durch technische Reproduzierbarkeit festgehalten. In seiner zugrunde liegenden, simplen Hypothese „Das Buch ist ein realer Körper “ wird die Überzeugung eines leidenschaftlichen Verlegers deutlich, der das Buch nicht als Ware versteht, sondern als Kulturgut und damit Teil eines sozialen Miteinanders, das es zu schützen gilt.
Das Sprachspiel scheint im Grunde genommen eine weiter gedrehte Wendung von Stephane Mallarmés Formulierung zu sein, nicht der Autor spreche in einem literarischen Text, sondern die Sprache selbst. 2Hine setzt an die Stelle der Sprache das Objekt Buch und subjektiviert es. Aus Mallarmés mystisch durchdrungener Formulierung wird eine direkte Verbildlichung, allerdings nicht ohne Folgen. Wo Mallarmés Personalisierung der Sprache Roland Barthes zur Konstatierung des Todes des Autors bei gleichzeitiger Geburt des Lesers als Schöpferfigur führte, gelangt man mit Hine in gewisser Hinsicht zu einem phänomenologischen Perspektivwechsel. Der Text eines Buches wird gemeinsam mit dessen formaler Gestaltung zum gleichberechtigten Mitspieler der Autor-Leser Kommunikation. Wir haben es dabei buchstäblich mit einer Ménage-à-trois zu tun. Autor, Buch und Leser stehen als drei Körper in einer sich gegenseitig bedingenden, notwendigen Beziehung zueinander. Ein Verhältnis, das durchaus auch amourös sein kann. Nach Barthes allerdings ist die Grundlage des eigentlichen „Ortes der Literatur“ nicht nur der Text oder das Buch, sondern der Vorgang des Lesens selbst. 3Dabei kommt es Barthes gerade nicht auf den Text an, denn diesen wertet er gleichzeitig als unoriginelles, bloßes Produkt multipler Schreiber. 4Ihm geht es um das prozessuale Vervollständigen der Autorschaft im Rezipienten. Nimmt man Hines Hypothese des Buches als Körper ernst, denkt man sie in diesem Zusammenhang weiter, muss man anführen, dass das Buch, verstanden als realer Körper, zunächst in die Gegenrichtung führt. Beschreibt man es als Subjekt-Körper mit einem Rücken und einem Nervensystem, bedeutet dies die Individualisierung desselben und proklamiert damit die Originalität jedes einzelnen Buches und gerade nicht die vollständige Auflösung des (materiellen) Textes im Akt des Lesens, die Barthes postulierte. Mallarmé hingegen scheint auch ganz dem poetischen Prinzip des Mystischen zu folgen, wenn er schreibt: „Ein Vorschlag, der von mir stammt [...], will, daß alles auf der Welt existiert, um in ein Buch zu münden.“ 5Dieser durchaus als radikal zu verstehende Gedanke kehrt das Verständnis von Literatur als Weltbegegnungs-Medium um. Hier geht es nicht mehr nur darum, mit der Literatur die Realität abzubilden, ihr zu begegnen oder um den Versuch, sie zu verstehen. Es geht auch nicht darum, der Literatur als Medium einen individuellen Charakter zuzuschreiben, sondern um das Begreifen der Realität als etwas, das in der gesamten Daseinsform nur auf die Literatur hin gerichtet ist. Jede Form von Bedeutsamkeit sei also nur durch die Literatur gegeben.
Читать дальше