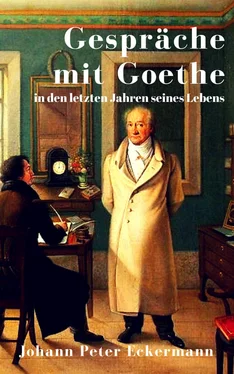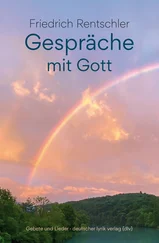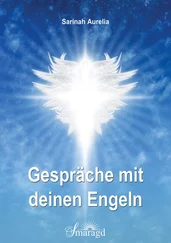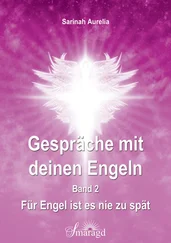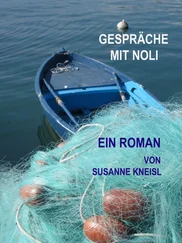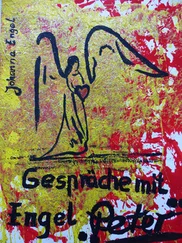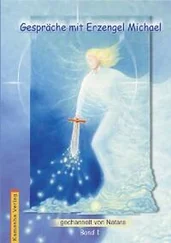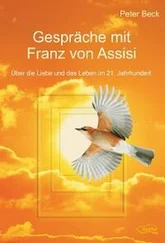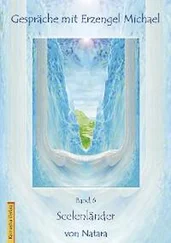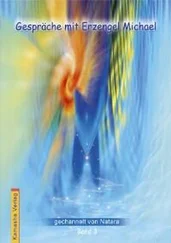Alle Engländer sind als solche ohne eigentliche Reflexion, die Zerstreuung und der Parteigeist lassen sie zu keiner ruhigen Ausbildung kommen. Aber sie sind groß als praktische Menschen.
So konnte Lord Byron nie zum Nachdenken über sich selbst gelangen; deswegen auch seine Reflexionen überhaupt ihm nicht gelingen wollen, wie sein Symbolum ›Viel Geld und keine Obrigkeit‹ beweiset, weil durchaus vieles Geld die Obrigkeit paralysiert.
Aber alles, was er produzieren mag, gelingt ihm, und man kann wirklich sagen, daß sich bei ihm die Inspiration an die Stelle der Reflexion setzt. Er mußte immer dichten; und da war denn alles, was vom Menschen, besonders vom Herzen ausging, vortrefflich. Zu seinen Sachen kam er wie die Weiber zu schönen Kindern; sie denken nicht daran und wissen nicht wie.
Er ist ein großes Talent, ein geborenes, und die eigentlich poetische Kraft ist mir bei niemanden größer vorgekommen als bei ihm. In Auffassung des Äußern und klarem Durchblick vergangener Zustände ist er ebenso groß als Shakespeare. Aber Shakespeare ist als reines Individuum überwiegend. Dieses fühlte Byron sehr wohl, deshalb spricht er vom Shakespeare nicht viel, obgleich er ganze Stellen von ihm auswendig weiß. Er hätte ihn gern verleugnet, denn Shakespeares Heiterkeit ist ihm im Wege; er fühlt, daß er nicht dagegen aufkann. Pope verleugnet er nicht, weil er ihn nicht zu fürchten hatte. Er nennt und achtet ihn vielmehr, wo er kann, denn er weiß sehr wohl, daß Pope nur eine Wand gegen ihn ist.«
Goethe schien über Byron unerschöpflich, und ich konnte nicht satt werden, ihm zuzuhören. Nach einigen kleinen Zwischengesprächen fuhr er fort:
»Der hohe Stand als englischer Peer war Byron sehr nachteilig; denn jedes Talent ist durch die Außenwelt geniert, geschweige eins bei so hoher Geburt und so großem Vermögen. Ein gewisser mittler Zustand ist dem Talent bei weitem zuträglicher; weshalb wir denn auch alle große Künstler und Poeten in den mittleren Ständen finden. Byrons Hang zum Unbegrenzten hätte ihm bei einer geringeren Geburt und niederem Vermögen bei weitem nicht so gefährlich werden können. So aber stand es in seiner Fracht, jede Anwandlung in Ausführung zu bringen, und das verstrickte ihn in unzählige Händel. Und wie sollte ferner dem, der selbst aus so hohem Stande war, irgendein Stand imponieren und Rücksicht einflößen? Er sprach aus, was sich in ihm regte, und das brachte ihn mit der Welt in einen unauflöslichen Konflikt.
Man bemerkt mit Verwunderung,« fuhr Goethe fort, »welcher große Teil des Lebens eines vornehmen reichen Engländers in Entführungen und Duellen zugebracht wird. Lord Byron erzählt selbst, daß sein Vater drei Frauen entführt habe. Da sei einer einmal ein vernünftiger Sohn!
Er lebte eigentlich immer im Naturzustande, und bei seiner Art zu sein, mußte ihm täglich das Bedürfnis der Notwehr vorschweben. Deswegen sein ewiges Pistolenschießen. Er mußte jeden Augenblick erwarten, herausgefordert zu werden.
Er konnte nicht allein leben. Deswegen war er trotz aller seiner Wunderlichkeiten gegen seine Gesellschaft höchst nachsichtig. Er las das herrliche Gedicht über den Tod des General Moore einen Abend vor, und seine edlen Freunde wissen nicht, was sie daraus machen sollen. Das rührt ihn nicht, und er steckt es wieder ein. Als Poet beweist er sich wirklich wie ein Lamm. Ein anderer hätte sie dem Teufel übergeben!«
Mittwoch, den 20. [Dienstag, den 19.] April 1825
Goethe zeigte mir diesen Abend einen Brief eines jungen Studierenden, der ihn um den Plan zum zweiten Teile des ›Faust‹ bittet, indem er den Vorsatz habe, dieses Werk seinerseits zu vollenden. Trocken, gutmütig und aufrichtig geht er mit seinen Wünschen und Absichten frei heraus und äußert zuletzt ganz unverhohlen, daß es zwar mit allen übrigen neuesten literarischen Bestrebungen nichts sei, daß aber in ihm eine neue Literatur frisch erblühen solle.
Wenn ich im Leben auf einen jungen Menschen stieße, der Napoleons Welteroberungen fortzusetzen sich rüstete, oder auf einen jungen Bau-Dilettanten, der den Kölner Dom zu vollenden sich anschickte, so würde ich mich über diese nicht mehr verwundern und sie nicht verrückter und lächerlicher finden, als eben diesen jungen Liebhaber der Poesie, der Wahn genug besitzt, aus bloßer Neigung den zweiten Teil des ›Faust‹ machen zu können.
Ja ich halte es für möglicher, den Kölner Dom auszubauen, als in Goethes Sinne den ›Faust‹ fortzusetzen! Denn jenem ließe sich doch allenfalls mathematisch beikommen, er steht uns doch sinnlich vor Augen und läßt sich mit Händen greifen. Mit welchen Schnüren und Maßen aber wollte man zu einem unsichtbaren geistigen Werk reichen, das durchaus auf dem Subjekt beruht, bei welchem alles auf das Aperçu ankommt, das zum Material ein großes selbstdurchlebtes Leben und zur Ausführung eine jahrelang geübte, zur Meisterschaft gesteigerte Technik erfordert?
Wer ein solches Unternehmen für leicht, ja nur für möglich hält, hat sicher nur ein sehr geringes Talent, eben weil er keine Ahndung vom Hohen und Schwierigen besitzt; und es ließe sich sehr wohl behaupten, daß, wenn Goethe seinen ›Faust‹ bis auf eine Lücke von wenigen Versen selbst vollenden wollte, ein solcher Jüngling nicht fähig sein würde, nur die wenigen Verse schicklich hineinzubringen.
Ich will nicht untersuchen, woher unserer jetzigen Jugend die Einbildung gekommen, daß sie dasjenige als etwas Angeborenes bereits mit sich bringe, was man bisher nur auf dem Wege vieljähriger Studien und Erfahrungen erlangen konnte, aber so viel glaube ich sagen zu können, daß die in Deutschland jetzt so häufig vorkommenden Äußerungen eines alle Stufen allmählicher Entwickelung keck überschreitenden Sinnes zu künftigen Meisterwerken wenige Hoffnung machen.
»Das Unglück ist«, sagte Goethe, »im Staat, daß niemand leben und genießen, sondern jeder regieren, und in der Kunst, daß niemand sich des Hervorgebrachten freuen, sondern jeder seinerseits selbst wieder produzieren will.
Auch denkt niemand daran, sich von einem Werk der Poesie auf seinem eigenen Wege fördern zu lassen, sondern jeder will sogleich wieder dasselbige machen.
Es ist ferner kein Ernst da, der ins Ganze geht, kein Sinn, dem Ganzen etwas zuliebe zu tun, sondern man trachtet nur, wie man sein eigenes Selbst bemerklich mache und es vor der Welt zu möglichstes Evidenz bringe. Dieses falsche Bestreben zeigt sich überall, und man tut es den neuesten Virtuosen nach, die nicht sowohl solche Stücke zu ihrem Vortrage wählen, woran die Zuhörer reinen musikalischen Genuß haben, als vielmehr solche, worin der Spielende seine erlangte Fertigkeit könne bewundern lassen. Überall ist es das Individuum, das sich herrlich zeigen will, und nirgends trifft man auf ein redliches Streben, das dem Ganzen und der Sache zuliebe sein eigenes Selbst zurücksetzte.
Hiezu kommt sodann, daß die Menschen in ein pfuscherhaftes Produzieren hineinkommen, ohne es selbst zu wissen. Die Kinder machen schon Verse und gehen so fort und meinen als Jünglinge, sie könnten was, bis sie zuletzt als Männer zur Einsicht des Vortrefflichen gelangen, was da ist, und über die Jahre erschrecken, die sie in einer falschen, höchst unzulänglichen Bestrebung verloren haben.
Ja, viele kommen zur Erkenntnis des Vollendeten und ihrer eigenen Unzulänglichkeit nie und produzieren Halbheiten bis an ihr Ende.
Gewiß ist es, daß wenn jeder früh genug zum Bewußtsein zu bringen wäre, wie die Welt von dem Vortrefflichsten so voll ist und was dazu gehört, diesen Werken etwas Gleiches an die Seite zu setzen, daß sodann von jetzigen hundert dichtenden Jünglingen kaum ein einziger Beharren und Talent und Mut genug in sich fühlen würde, zu Erreichung einer ähnlichen Meisterschaft ruhig fortzugehen.
Viele junge Maler würden nie einen Pinsel in die Hand genommen haben; wenn sie früh genug gewußt und begriffen hätten, was denn eigentlich ein Meister wie Raffael gemacht hat.«
Читать дальше