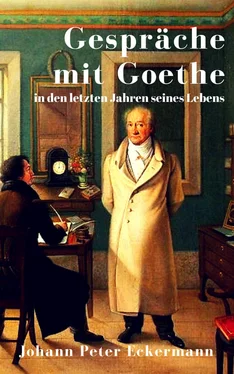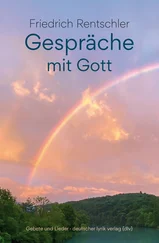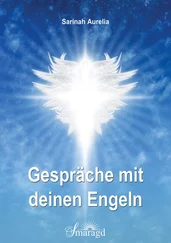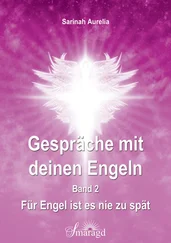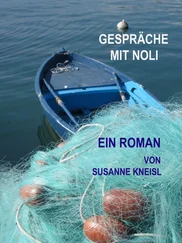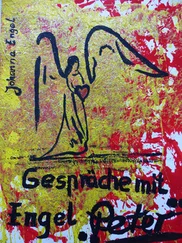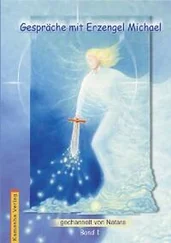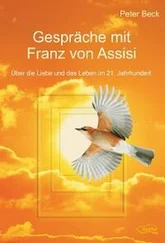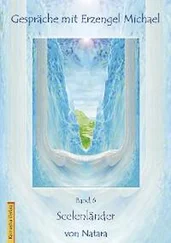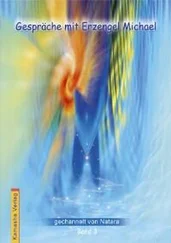Ich hatte schon im Laufe des Sommers die Freude gehabt, alle diese noch ungedruckten Lebensjahre bis auf die neueste Zeit herauf wiederholt zu lesen und zu betrachten. Aber jetzt in Goethes Gegenwart sie laut vorlesen zu hören, gewährte mir einen ganz neuen Genuß. – Riemer war auf den Ausdruck gerichtet, und ich hatte Gelegenheit, seine große Gewandtheit und seinen Reichtum an Worten und Wendungen zu bewundern. In Goethen aber war die geschilderte Lebensepoche rege, er schwelgte in Erinnerungen und ergänzte bei Erwähnung einzelner Personen und Vorfälle das Geschriebene durch detaillierte mündliche Erzählung. – Es war ein köstlicher Abend! Der bedeutendsten mitlebenden Männer ward wiederholt gedacht; zu Schillern jedoch, der dieser Epoche von 1795 bis 1800 am engsten verflochten war, kehrte das Gespräch immer von neuem zurück. Das Theater war ein Gegenstand ihres gemeinsamen Wirkens gewesen, so auch fallen Goethes vorzüglichste Werke in jene Zeit. Der ›Wilhelm Meister‹ wird beendigt, ›Hermann und Dorothea‹ gleich hinterher entworfen und geschrieben, ›Cellini‹ übersetzt für die ›Horen‹, die ›Xenien‹ gemeinschaftlich gedichtet für Schillers ›Musenalmanach‹, an täglichen Berührungspunkten war kein Mangel. Dieses alles kam nun diesen Abend zur Sprache, und es fehlte Goethen nicht an Anlaß zu den interessantesten Äußerungen.
»›Hermann und Dorothea‹«, sagte er unter andern, »ist fast das einzige meiner größeren Gedichte, das mir noch Freude macht; ich kann es nie ohne innigen Anteil lesen. Besonders lieb ist es mir in der lateinischen Übersetzung, es kommt mir da vornehmer vor, als wäre es, der Form nach, zu seinem Ursprunge zurückgekehrt.«
Auch vom ›Wilhelm Meister‹ war wiederholt die Rede. »Schiller«, sagte er, »tadelte die Einflechtung des Tragischen, als welches nicht in den Roman gehöre. Er hatte jedoch unrecht, wie wir alle wissen. In seinen Briefen an mich sind über den ›Wilhelm Meister‹ die bedeutendsten Ansichten und Äußerungen. Es gehört dieses Werk übrigens zu den inkalkulabelsten Produktionen, wozu mir fast selbst der Schlüssel fehlt. Man sucht einen Mittelpunkt, und das ist schwer und nicht einmal gut. Ich sollte meinen, ein reiches mannigfaltiges Leben, das unsern Augen vorübergeht, wäre auch an sich etwas ohne ausgesprochene Tendenz, die doch bloß für den Begriff ist. Will man aber dergleichen durchaus, so halte man sich an die Worte Friedrichs, die er am Ende an unsern Helden richtet, indem er sagt: ›Du kommst mir vor wie Saul, der Sohn Kis, der ausging, seines Vaters Eselinnen zu suchen, und ein Königreich fand.‹ Hieran halte man sich. Denn im Grunde scheint doch das Ganze nichts anderes sagen zu wollen, als daß der Mensch trotz aller Dummheiten und Verwirrungen, von einer höheren Hand geleitet, doch zum glücklichen Ziele gelange.«
Der großen Kultur der mittleren Stände ward darauf gedacht, die sich seit den letzten funfzig Jahren über Deutschland verbreitet, und Goethe schrieb die Verdienste hierum weniger Lessingen zu als Herdern und Wieland. »Lessing«, sagte er, »war der höchste Verstand, und nur ein ebenso großer konnte von ihm wahrhaft lernen. Dem Halbvermögen war er gefährlich.« Er nannte einen Journalisten, der sich nach Lessing gebildet und am Ende des vorigen Jahrhunderts eine Rolle, aber keine edle gespielt habe, weil er seinem großen Vorgänger so weit nachgestanden.
»Wielanden«, sagte Goethe, »verdankt das ganze obere Deutschland seinen Stil. Es hat viel von ihm gelernt, und die Fähigkeit, sich gehörig auszudrücken, ist nicht das geringste.«
Bei Erwähnung der ›Xenien‹ rühmte Goethe besonders die von Schiller, die er scharf und schlagend nannte, dagegen seine eigenen unschuldig und geringe. »Den ›Tierkreis‹,« sagte er, »welcher von Schiller ist, lese ich stets mit Bewunderung. Die guten Wirkungen, die sie zu ihrer Zeit auf die deutsche Literatur ausübten, sind gar nicht zu berechnen.« Viele Personen wurden bei dieser Gelegenheit genannt, gegen welche die ›Xenien‹ gerichtet waren; ihre Namen sind jedoch meinem Gedächtnis entgangen.
Nachdem nun so, von diesen und hundert andern interessanten Äußerungen und Einflechtungen Goethes unterbrochen, das gedachte Manuskript bis zu Ende des Jahres 1800 vorgelesen und besprochen war, legte Goethe die Papiere an die Seite und ließ an einem Ende des großen Tisches, an dem wir saßen, decken und ein kleines Abendessen bringen. Wir ließen es uns wohl sein; Goethe selbst rührte aber keinen Bissen an, wie ich ihn denn nie abends habe essen sehen. Er saß bei uns, schenkte uns ein, putzte die Lichter und erquickte uns überdies geistig mit den herrlichsten Worten. Das Andenken Schillers war in ihm so lebendig, daß die Gespräche dieser letzten Hälfte des Abends nur ihm gewidmet waren.
Riemer erinnerte an Schillers Persönlichkeit. »Der Bau seiner Glieder, sein Gang auf der Straße, jede seiner Bewegungen«, sagte er, »war stolz, nur die Augen waren sanft.« – »Ja,« sagte Goethe, »alles übrige an ihm war stolz und großartig, aber seine Augen waren sanft. Und wie sein Körper war sein Talent. Er griff in einen großen Gegenstand kühn hinein und betrachtete und wendete ihn hin und her, und sah ihn so an und so, und handhabte ihn so und so. Er sah seinen Gegenstand gleichsam nur von außen an, eine stille Entwickelung aus dem Innern war nicht seine Sache. Sein Talent war mehr desultorisch. Deshalb war er auch nie entschieden und konnte nie fertig werden. Er wechselte oft noch eine Rolle kurz vor der Probe.
Und wie er überall kühn zu Werke ging, so war er auch nicht für vieles Motivieren. Ich weiß, was ich mit ihm beim ›Tell‹ für Not hatte, wo er geradezu den Geßler einen Apfel vom Baum brechen und vom Kopf des Knaben schießen lassen wollte. Dies war nun ganz gegen meine Natur, und ich überredete ihn, diese Grausamkeit doch wenigstens dadurch zu motivieren, daß er Tells Knaben mit der Geschicklichkeit seines Vaters gegen den Landvogt großtun lasse, indem er sagt, daß er wohl auf hundert Schritte einen Apfel vom Baum schieße. Schiller wollte anfänglich nicht daran, aber er gab doch endlich meinen Vorstellungen und Bitten nach und machte es so, wie ich ihm geraten.
Daß ich dagegen oft zu viel motivierte, entfernte meine Stücke vom Theater. Meine ›Eugenie‹ ist eine Kette von lauter Motiven, und dies kann auf der Bühne kein Glück machen.
Schillers Talent war recht fürs Theater geschaffen. Mit jedem Stück schritt er vor und ward er vollendeter; doch war es wunderlich, daß ihm noch von den ›Räubern‹ her ein gewisser Sinn für das Grausame anklebte, der selbst in seiner schönsten Zeit ihn nie ganz verlassen wollte. So erinnere ich mich noch recht wohl, daß er im ›Egmont‹ in der Gefängnisszene, wo diesem das Urteil vorgelesen wird, den Alba in einer Maske und in einen Mantel gehüllt im Hintergrunde erscheinen ließ, um sich an dem Effekt zu weiden, den das Todesurteil auf Egmont haben würde. Hiedurch sollte sich der Alba als unersättlich in Rache und Schadenfreude darstellen. Ich protestierte jedoch, und die Figur blieb weg. Er war ein wunderlicher großer Mensch.
Alle acht Tage war er ein anderer und ein vollendeterer; jedesmal wenn ich ihn wiedersah, erschien er mir vorgeschritten in Belesenheit, Gelehrsamkeit und Urteil. Seine Briefe sind das schönste Andenken, das ich von ihm besitze, und sie gehören mit zu dem Vortrefflichsten, was er geschrieben. Seinen letzten Brief bewahre ich als ein Heiligtum unter meinen Schätzen.« Goethe stand auf und holte ihn. »Da sehen und lesen Sie«, sagte er, indem er mir ihn zureichte.
Der Brief war schön und mit kühner Hand geschrieben. Er enthielt ein Urteil über Goethes Anmerkungen zu ›Rameaus Neffen‹, welche die französische Literatur jener Zeit darstellen, und die er Schillern in Manuskript zur Ansicht mitgeteilt hatte. Ich las den Brief Riemern vor. »Sie sehen,« sagte Goethe, »wie sein Urteil treffend und beisammen ist, und wie die Handschrift durchaus keine Spur irgendeiner Schwäche verrät. Er war ein prächtiger Mensch, und bei völligen Kräften ist er von uns gegangen. Dieser Brief ist vom 24. April 1805 – Schiller starb am 9. Mai.«
Читать дальше