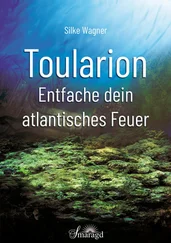„Mach bitte kein Licht. Sie haben Mutter verhaftet.“
Sie war zu ihm gegangen und hatte leicht seine Schulter berührt.
„Es ist meine Schuld.“
Er antwortete nicht. Sie setzte sich zu ihm und hielt seine Hand. Wie lange hatte es gedauert, bis ihr die Wölbung unter dem Stoff von Rüdigers Hose zu Bewusstsein gekommen war? Zuerst sah sie weiter starr geradeaus, als habe sie nichts bemerkt. Doch dann hörte sie ihn atmen und spürte seinen Blick auf ihrer Wange. Gelegenheit, etwas gut zu machen, dachte sie und drehte sich zu ihm.
„Komm.“
Sie öffnete die Augen und umklammerte die Bettkante. Sieh dir das Zimmer an, sagte sie sich. Konzentrier dich auf die Einzelheiten. Die Tür, die Decke, das Fenster. Sie redete in Gedanken auf sich selbst ein wie auf ein verängstigtes Kind und ließ ihren Blick über die Gegenstände gleiten. Ihr Atem beruhigte sich. Das Telefon. Sie sollte jemanden anrufen.
Kann es einen solchen Leberfleck zweimal geben? Sieht er vielleicht doch in das Gesicht eines Fremden? Das hat er sich gefragt, als er in diesem Graben stand. Und zugleich gewusst, dass diese Frage ein Verrat war. Brüder sollten einander unter allen Umständen erkennen. Heinrich hatte sich aus freien Stücken in einen Fremden verwandelt. Doch der Verrat des einen Bruders zieht den des anderen unweigerlich nach sich. Das Schweigen. Das Vergessenmüssen. Den Zweifel. Er hatte das immer gespürt, aber in diesem Graben begriff er es in einer neuen Deutlichkeit. Eigenartigerweise verabscheute er den Toten nicht. Das stumpfe Weiß seiner Augäpfel hatte Recht und Unrecht ausgelöscht. Nie wieder würde er Heinrichs Blick begegnen können. Der Gedanke war noch dabei, sich in seinem Kopf festzusetzen, als zwei Männer aus seinem Trupp den Toten packten und forttrugen. Er hinterließ nicht einmal einen Blutfleck. Die Erde sah aus, als hätte dort nie einer gelegen.
Seine Zunge tat es der Erde gleich. Weder seiner Mutter noch Grete erzählte er, dass er seinem Bruder wiederbegegnet war. Wahrscheinlich. Wiederbegegnet? Grete erfuhr nie, dass er überhaupt einen Bruder gehabt hatte. Die meiste Zeit hatte er nicht einmal das Gefühl zu lügen, wenn er behauptete, dass er mit seinen Eltern allein gewesen sei. Heinrich war verschwunden, als habe ein riesiges Loch ihn verschluckt, das weder Laute noch Farben kannte. Nur in den Augen seiner Mutter hinterließ er Spuren. Aber sie schlug die Augen nieder, aus Angst, der Vater könnte diese Spuren entdecken. Wie immer schon aus Angst.
„Mit diesem Fraß hier beleidigst du mich und meine Arbeit.“ Der Vater schlug die Kelle mitten in den Eintopf hinein, sodass Kartoffeln und Gemüse über den Rand spritzten und auf dem Tisch landeten. Seine Stimme schwoll an und dehnte sich bis in jeden Winkel der Küche aus.
„Geht.“
Sie mussten die Worte von den blutleeren Lippen der Mutter ablesen. Heinrich nahm seine Hand.
„Komm.“
Sobald sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, hörten sie die Schläge und die Schmerzenslaute der Mutter. Heinrich legte ihm den Arm um die Schultern.
„Wir gehen in den Wald.“
Seine Stimme war ein Balsam, der die Striemen in seiner Seele kühlte. Sie barg ihn vor dem Grauen der rotgeschwollenen Stimme des Vaters und der Schmerzenslaute in einer Welt fremder Worte und Zeichen, von Katheten, Hypothenusen, Sinus und Cosinus.
„Geometrie ist schön. Sie hat klare Regeln und Gesetze, auf die man sich verlassen kann. Und trotzdem entdeckt man immer neue Geheimnisse.“
Mit einem Stock zeichnete Heinrich ein Dreieck und darüber ein Netz aus Quadraten in die aufgelockerte Erde. Die Furchen hoben sich dunkel vom Boden ab. Sie gaben seinen Augen Halt, erinnerten ihn an einen frisch gepflügten Acker, während Heinrichs Worte wie rätselhafte Zauberformeln in seinen Ohren klangen. Seine Stimme hatte jetzt, vom Eifer des Erklärens durchdrungen, einen etwas höheren und schärferen Ton angenommen. Sein halblanges, schwarz gelocktes Haar fiel über seine Wangen, während er sich vorbeugte und zeichnete. Er strich sie hinter sein Ohr und streifte ihn mit einem kurzen Seitenblick, um zu sehen, ob er auch bei der Sache war. Der große Leberfleck unter seinem linken Auge schimmerte in einem rosa unterlegten Braunton. Es machte nichts, dass er nicht verstand, was Heinrich ihm zeigte. Für einen Moment waren sie beide geborgen und in Sicherheit.
Er und sein nur zwei Jahre älterer Bruder. Der Kluge, dessen Klugheit weh tat.
„Mutter kann ich nicht beschützen, aber dich.“
Der Schöne, der den Mädchen im Dorf am besten von allen gefiel. Solange Heinrich da gewesen war, hatte er selbst wie im lichtdurchlässigen Schatten einer Erle gelebt, deren bebende Krone den Himmel mit einem feinen Netz unaufhörlich sich öffnender und schließender Fenster überzog. Ohne dieses Netz hätte sein Blick länger allein am Boden gehaftet. Aber es ließ ihn auch spüren, dass der Himmel für ihn unerreichbar bleiben würde. Er begriff früh, dass der Abstand, den er zwischen sich selbst und Heinrich empfand, nicht durch die Jahre geschaffen wurde, sondern durch Unterschiede ihres Wesens. Er würde nie dorthin gelangen, wo sein Bruder sich befand.
Die Stirn des Toten unter der Mütze war hoch und schmal gewesen, eine Denkerstirn. Die hatte ihm am Ende nichts genützt. Er war aus dem Graben gekrochen wie ein gequältes Tier, das längst für den Tod bereit ist.
Er zwingt sich, die Augen zu öffnen, und schlägt mit der Faust auf den Tisch, sodass die angebrochene Flasche umfällt. Der Wein ergießt sich über die Tischkante auf den Fußboden. Stöhnend wuchtet er sich von seinem Stuhl hoch und hinkt ins Schlafzimmer. Er nimmt Gretes Kittel vom Kopfkissen und presst sein Gesicht hinein. Atmet mühsam wie ein Ertrinkender.
„Christiane Stinhöfer.“ Sobald Edith die vertraute Stimme hörte, hatte sie das Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu gewinnen. Das Tier in ihrem Körper löste sich auf. „Ich brauche jemanden, der mir zuhört.“
„Leg los.“
Sie stellte sich vor, wie Christiane langsam, Telefon und Hörer in den Händen, durch das helle Zimmer ihrer Kreuzberger Hinterhofwohnung ging und sich in ihrem großen Sessel am Fenster niederließ. Dort würde sie den Schneidersitz einnehmen und ihren gedrungenen, fülligen Körper entspannt zurücklehnen, in einer Pose der Unerschütterlichkeit, noch einmal kurz ihre bunten Locken aus der Stirn schütteln und konzentriert zuhören. Jedes Mal, wenn Edith diese Bewegung sah, musste sie an ihre Mutter denken. War es möglich, dass Angewohnheiten sich vererbten? Falls ja, so hatte das Erbe bei Christiane eine Veränderung durchlaufen. Sie schüttelte ihr Haar ohne Ungeduld, mit einer sanften, spielerischen Kopfbewegung, die zur Vielfarbigkeit ihrer Frisur passte. Das Gemisch aus rotblonden und blassgrünen Locken war weder geeignet, ihr Gesicht zu verfinstern noch es bloßzustellen, gleich, in welche Richtung es fiel. Edith suchte nach den richtigen Worten. „Ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll. Es hat ganz mies angefangen.“ Christiane wartete ab. Wie so oft fand Edith ihr Schweigen auch dieses Mal mühsam. Sie wünschte, ihre Schwester würde irgendetwas sagen. Das werde ich nicht tun. Wie häufig hatten sie das schon diskutiert. Es gibt zu viele Leute, die einfach irgendetwas sagen, wenn jemand versucht, sich mitzuteilen. Wir schwätzen einander in Grund und Boden. Was ist so schlimm daran, eine Weile abzuwarten, bis jemand die richtigen Worte gefunden hat?
„Er demütigt mich dauernd.“
„Wer? Dieser Mann aus der Zeitung?“
„Otto Guse, ja.“
„Wie?“
„Er spottet über meine Kleidung, duzt mich und nennt mich Mädchen.“
Bedroht mich mit der Axt, setzte sie in Gedanken fort, rührt alte Wunden wieder auf. Aber sie sprach es nicht aus. Plötzlich befürchtete sie, Christiane würde ihr genauso wie Rüdiger raten, nach Berlin zurückzukehren. Also hatte sie doch entschieden zu bleiben? Ihr fiel wieder ein, dass sie eben noch gekrümmt im Bett gelegen hatte, in der Gewalt des aufgewachten Tieres.
Читать дальше