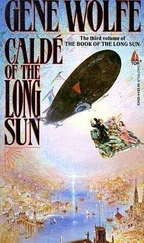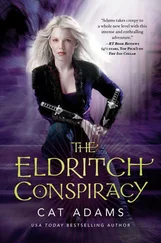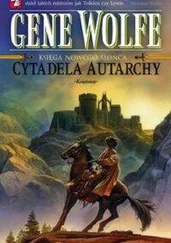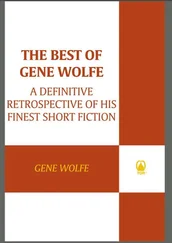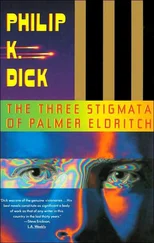Wolfe Eldritch - Winterwahn
Здесь есть возможность читать онлайн «Wolfe Eldritch - Winterwahn» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Winterwahn
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Winterwahn: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Winterwahn»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Jarl von Krakebekk eine Tat, die Norselund an den Rand eines Krieges bringt.
Während Varg av Ulfrskógr einen verzweifelten Versuch unternimmt, den außer Kontrolle
geratenen Jarl zur Vernunft zu bringen, kämpft Shaya am anderen Ende der Welt um das nackte Überleben.
Währenddessen nähern sich aus dem Osten unaufhaltsam Mächte, die das Königreich von Stennward ebenso ins Chaos zu
reißen drohen, wie Norselund und den Rest der bekannten Welt.
Winterwahn — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Winterwahn», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Inhaltsverzeichnis
1. Prolog1
2. Kapitel 117
3. Kapitel 234
4. Kapitel 356
5. Kapitel 480
6. Kapitel 5103
7. Kapitel 6123
8. Kapitel 7145
9. Kapitel 8168
10. Kapitel 9180
11. Kapitel 10202
12. Kapitel 11226
13. Kapitel 12246
14. Kapitel 13278
15. Kapitel 14293
16. Kapitel 15320
17. Kapitel 16339
18. Kapitel 17361
19. Kapitel 18380
20. Kapitel 19399
21. Kapitel 20424
22. Kapitel 21442
23. Kapitel 22456
24. Kapitel 23474
25. Kapitel 24493
26. Epilog513
Winterwahn
Ein Roman von Wolfe Eldritch
Weltengrau Band 3
E-Mail: wolfeeldritch@outlook.de
www.facebook.com/WolfeEldritch
1. Prolog
Ostmark
Das gleichmäßige, monotone Rumpeln der Räder auf der unebenen Straße hatte mittlerweile etwas Einschläferndes. Hatten sie sich am Anfang ihrer Reise noch durchgeschüttelt gefühlt, wirkte das ständige Gerüttel inzwischen eher beruhigend. Zumindest auf die anderen. Bozena und der fünf Jahre alte Zlata dösten denn auch schon den ganzen Vormittag über.
Miró warf einen kurzen Blick nach hinten in den Wagen, wo sein Sohn friedlich in den Armen seiner Frau lag. Beide hatten die Augen geschlossen und waren von einem Wust aus Decken und Fellen umgeben. Die neunjährige Dobrina saß neben ihm auf dem Bock des Wagens und war ebenfalls in eine dicke Decke eingewickelt. Seine Tochter war wie meist zu energiegeladen, um schläfrig zu werden. Sie kompensierte das Unvermögen, in der Gegend herumzurennen und Schabernack zu treiben auf ihre Weise. Mal mit leise summenden Tagträumereien, mal mit aufmerksamem Studium der völlig trostlosen Landschaft. Dabei spielte sie mit ihren langen, gedrehten Goldlocken, von denen niemand genau wusste, woher die Kleine sie hatte. Alle anderen in der Familie hatten dunkles Haar, wie es für die Menschen der äußeren Ostmark üblich war. Trotz der engen Verbundenheit zu seinem Weib wären Miró vermutlich irgendwann ob dieser Haare stille Zweifel gekommen. Dobrina hatte jedoch neben den Augen und der Gesichtsform ihrer Mutter zum Glück auch unverwechselbar seine Nase und seinen Mund. Überhaupt hatte es nie Misstöne in ihrer Familie gegeben. Bis zum Begin dieses Jahres waren sie, obwohl bitterarm, auf ihre bescheidene Art und Weise glücklich gewesen auf ihrem kleinen Hof in den Grenzlanden.
Jetzt fand Miró ebenso wenig Ruhe wie seine Tochter. Sein Grund war allerdings kein Überschuss an jugendlicher Energie, sondern tiefe, zehrende Sorge um die Zukunft. Dabei hatte er eine ganze Reihe von Dingen, um die er sich den Kopf zerbrechen konnte. Zu allererst war da das Hier und Jetzt. Die unebene, streckenweise kaum noch existente Straße, über die der von zwei altersschwachen Ochsen gezogene Wagen rumpelte, auf dem sich alles befand, was sie besaßen. Er betete im Stillen ständig, das die alten Achsen und Räder hielten, denn weder hatte er Ersatzteile, noch wäre er allein in der Lage gewesen, das Fahrzeug zu reparieren.
Die Tatsache, dass sie überhaupt vorankamen, verdankten sie einer weiteren Gefahr für ihr Leben, nämlich dem bereits regelmäßig einsetzenden Nachtfrost. Allein dem durch die Kälte hartgefrorenen Boden war es zu verdanken, dass die Ochsen nicht bis zum Bauch und der Wagen bis zur Achse im Schlamm versanken. Auf der anderen Seite stellte eben jene Kälte im Moment zugleich die größte Gefahr für das Leben der kleinen Familie dar. Wenn ihnen hier draußen der Wagen kaputtging, würden sie jämmerlich erfrieren. Noch blieb es bei Nachtfrösten, während sich die Temperaturen am Tage knapp überhalb des Gefrierpunktes hielten. Jene waren jedoch in diesem Jahr früh dran, und der Winter würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das war einer der Gründe, warum Miró so nervtötend langsam fuhr. Nur nichts bei dieser Witterung riskieren, so sehr es ihn auch noch immer drängte, möglichst schnell und weit vom Grenzland wegzukommen, das bis vor Kurzem seine Heimat gewesen war.
Nahrung hatten sie immerhin genug auf ihrer Reise. Miró schnaufte leise und schalt sich in Gedanken. Von wegen Reise. Nenn es doch beim Namen, eine Flucht ist es, nichts anderes. Das war es schon, als du von zu Hause aus nach Brosteni aufgebrochen bist. Unwillkürlich lief ihm ein Schauer über den Rücken und er spürte, wie sich sein Körper unter den vielen Schichten Kleidung mit einer Gänsehaut überzog. Allein der Name der Ortschaft, in der er mit seiner Familie gehofft hatte, Zuflucht zu finden, war ihm inzwischen ein Graus.
Sein Blick strich über die Rücken der beiden alten Ochsen, die gemächlich über den gefrorenen Boden hinwegschritten, über die leicht vereisten Felder, durch die sie seit Tagen fuhren. Hier gab es nichts als karges, unebenes Land, dass nur ab und an von kleinen, eine Handvoll Bäume umfassenden Wäldchen unterbrochen wurde. Die Welt war eine trostlose, stumpfe Suppe aus Grau. Den Göttern sein Dank hatte sich der Regen in den letzten Tagen ihrer Reise in Grenzen gehalten. Auch jetzt war es bereits bitterkalt, und der Wind blies wie kleine Messer in jede nicht geschützte Stelle der Haut, aber es fiel nur vereinzelter, leichter Nieselregen.
Bis vor einigen Monaten waren sie mit dem Wenigen, das sie hatten, zufrieden gewesen. Miró gehörte eines der siebzehn bescheidenen Gehöfte, die in ihrer Gesamtheit das kleine Dörfchen Frasin bildeten. Es lag nur fünf Tagesreisen von dem Beginn der östlichen Tundra entfernt, weit draußen in den Grenzlanden des Königreiches. Miró wusste, dass sie sich in einem Königreich befanden. Wie der König hieß, wusste er nicht, und es war ihm auch herzlich gleichgültig. Sie lebten ein Leben in Armut, aber sie hatten einander und die harte Arbeit war erträglich, weil es immer gerade so dazu reichte, dass sie nicht hungern mussten. Miró wusste, dass das keine Selbstverständlichkeit war.
Seine Großeltern waren in der Hungersnot nach dem Einbruch des Grau gestorben und sein Vater hatte die Erinnerung an sie und die schreckliche Zeit damals mit seinen Geschichten am Leben erhalten. Sie kamen zurecht, sie litten keinen Hunger und vor allem waren die Kinder gesund und kräftig. So ging es allen Familien in Frasin, denn auch wenn die Dorfgemeinschaft im Grunde nur aus verstreuten Gehöften bestand, hatte man doch einen Dorfplatz und ein Gemeindehaus, in dem man sich regelmäßig traf und besprach. Man half sich gegenseitig und rang dem harten Land so das Nötigste ab, um zu überleben. Daran hatte sich auch nichts geändert, als man die ersten Hühner hatte töten müssen. Natürlich schlachtete man des Öfteren Hühner. Diese hatte man allerdings verbrannt, was unter normalen Umständen als unverzeihliche Verschwendung gegolten hätte. Sie mochten einfältige Menschen sein, aber keiner von ihnen wäre so dumm gewesen, das Fleisch dieser verwachsenen Tiere zu essen.
Das alles hatte im Frühjahr 825 angefangen, wenn Miró sich recht erinnerte. Niemand hatte eine derartige Krankheit je beim Federvieh gesehen und die Besorgnis war groß gewesen. Man hatte sofort Tiere untereinander getauscht und ein paar neue Ställe gebaut, um nicht von einem Brutplatz abhängig zu sein. Von da an war es immer wieder vorgekommen, dass ganze Gelege Küken hervorgebracht hatte, die man sofort getötet und verbrannt hatte. Die Vorfälle wurden bald zur Gewohnheit und man nahm sie hin, wie man es in diesen harten Landen gewohnt war, Dinge hinzunehmen. Man ertrug sie und arbeitete noch ein wenig härter.
Im späten Herbst 825 hatte man dann auf dem Hof vom alten Krasiemir die erste Ziege getötet. Sie hatte merkwürdig verformte Hinterläufe und einen schiefen Brustkorb, am übelsten aber war die Geschwulst auf ihrer Stirn, gleich oberhalb der Augen. Es sah aus, als würde dem armen Tier ein drittes, entzündetes Horn wachsen. Ziegen waren schlimmer als Hühner. Ziegen gab es nicht so viele, sie wuchsen nicht so schnell wie Federvieh und ihr Fleisch und ihre Milch war kostbar. Als das Frühjahr 826 anbrach, waren schon die Hälfte der Ziegen und fast ein Drittel der Hühner tot. Manche behaupteten, dass sie die Tiere am Abend gesund und normal im Stall einschlossen und sie am nächsten Morgen mit diesen widerlichen Verwachsungen vorfanden und erschlagen und verbrennen mussten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Winterwahn»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Winterwahn» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Winterwahn» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.