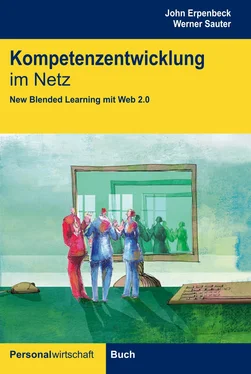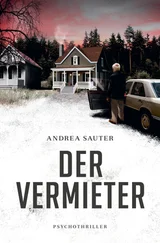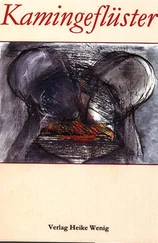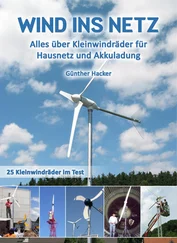Zu (e) und (g): Das allgemeinpsychologisches Thema ist hier das Verhältnis von Emotionen, Motivationen und Kommunikation.
Wie werden Emotionen und Motivationen kommuniziert und inwiefern werden sie anders als Wissen im engeren Sinne kommuniziert? Wir gehen hier nur kurz darauf ein und widmen der generellen Wertkommunikation einen gesonderten Abschnitt. Denn unsere Absicht geht ja gerade dahin, mit Hilfe neuer, netzbasierter Kommunikationsmittel Werte so weiterzugeben, dass sie emotional verankert und interiorisiert werden. Dazu müssen wir insbesondere die unterschiedlichen Funktionen sprachlicher und anderer kommunikativer Entäußerungen charakterisieren und ergründen, wo es tatsächlich nur um die Vermittlung von Sachverhalten geht, wo Werte des Kommunizierenden selbst, dann seines Kommunikationspartners oder seiner Kommunikationspartnerin, und schließlich Werte künftiger Ziele, die durch eigenes oder gemeinsames Handeln angestrebt werden könnten, im Spiele sind. Um das genauer zu umreißen und vor allem, um dann die verschiedenen Formen symbolischer Wertkommunikation zu charakterisieren werden wir auf das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun zurückgreifen.
Zu (f): Das allgemeinpsychologische Thema ist hier das Verhältnis von Emotion, Motivation, Willen sowie Handlungsantizipation und Handlung. [17]
Emotional verankerte Werte können, müssen aber nicht in Motive, also Beweg-Gründe umgesetzt werden. Hier werden eigene psychische Mechanismen wirksam auf die wir zumindest hinweisen wollen. Auch das zeigt sich in dem Holodynski – Friedlmeier – Modell sehr anschaulich. Die emotionale Handlungsregulation erscheint dort als eine Ebene, die eingebettet ist in die Verhaltens-, die Willens- und die Reflexionsebene der Emotionen. Diese Systemebenen werden nicht physiologisch belegt, geben jedoch zumindest ein Bild der äußerst komplexen Zusammenhänge, die unserer stark vereinfachenden Beschreibung zugrunde liegen.
Zu (g): Das allgemeinpsychologische Thema ist hier die Interiorisation kulturell - politisch entstandener Regeln, Werte und Normen zu individuellen Emotionen und Motivationen vieler Einzelner, zu sozial relevantem Handeln gebündelt.
Dies können wir im engen Rahmen unseres Anliegens, Kompetenzentwicklung im Netz zu verstehen und zu nutzen, natürlich nicht ausführen. Von Anfang an – und heute verstärkt – werden intra- und interpersonale Aspekte von Emotionen und Motivationen diskutiert. [18]Sozial organisierende Werte dienen – im Sinne moralanalogen oder politikanalogen Verhaltens (Führungskämpfe) – schon bei vielen Säugetierarten als hoch überlebenswichtig. Das sind sie aber nur, wenn sie im einzelnen Exemplar der Art derart verankert sind, dass dessen Verhalten dadurch gesteuert wird. Es steht außer Frage, dass es sich dabei um emotional-motivationale Verankerungen handelt. Mit der Entwicklung von Sprache und Kultur, Kunst und Politik beim Menschen wird die mögliche Vielfalt extrem erweitert. Bestehen bleibt allerdings, dass alle Werte nur dann sozial wirksam werden, wenn sie für einzelne Individuen emotional – motivational verankert und damit handlungsentscheidend sind. Allerdings entstehen nun viele Werte, die nicht nur nicht überlebenswichtig sind, sondern die, im Extremfall, zum Untergang allen Lebens führen könnten. Dennoch stimmen wir im Grunde mit Luc Ciompi überein, dass selbst weltpolitische Entscheidungen immer emotional begründet sind und emotionaler Interiorisation zumindest handlungsbestimmender Individuen und Gruppen bedürfen, um sozial wirksam zu werden.
[1]wir folgen in der Bezeichnung der Phasen hier und im weiteren der grundlegenden Arbeit von Lacoursiere,R.(1980)
[2]Festinger, L. (1957), 1957
[3]Berlyne, D.E. (1974); Simonov, P.(1986)
[4]Die Stufen (a) bis (g) sind ausführlicher dargestellt in: Erpenbeck, J., Weinberg, J. (1993), S. 142 ff
[5]Heyse, V., Erpenbeck, J. (2004)
[6]vgl. dazu Berlyne, D.E. (1974; Klein, M., Riviere, J. (1983); Horney, K. (1984); Peschanel, F.D.(1993); Greenberg, L.R., Rice, L.N., Elliott, R.(1993); Brenner, C. (1994);
[7]Piaget, J. (1976)
[8]Berlyne, D.E. (1974)
[9]Seiler, T. B. (1998), S. 199-225
[10]Draschoff, S. (2000)
[11]ebenda, S. 296
[12]ebenda, S. 305
[13]zusammenfassend hierzu Christianson, S.A. (1992)
[14]Holodynski, M., Friedlmeier, W. (2006)
[15]ebenda, S.45ff
[16]Damasio, A. (2002)
[17]v. Cranach, M. (1994)
[18]Weiner, B. (2000), S. 13-28
2.2.6 Wertaneignung nach der Psychotherapieforschung
Auch Psychotherapieverfahren lassen sich als Modelle individuellen Wertwandels verstehen und nutzen. Dabei geht es nicht um eine „Psychotherapeutisierung“ des Lehrens und Lernens, sondern allein um die „Mechanismen“ des emotional-motivationalen Lernens, die dort existenziell sind und sich generalisiert auf andere Wertewandelsprozesse übertragen lassen. Deshalb wollen wir uns zunächst dem Zusammenhang von Psychotherapie und individuellem Wertwandel zuwenden. Um ihn zu verstehen, muss wiederum nachgezeichnet werden, wie Werte zu handlungsleitetenden Emotionen und Motivationen des Individuums interiorisiert werden und wie die entsprechenden psychischen “Mechanismen” solcher Aneignung beschaffen sind. [1]Zahlreiche Psychotherapieverfahren, so unsere Hypothese, sind als Modelle individuellen Wertwandels, auch individueller Wertentstehung, zu verstehen und zu nutzen.
Zunächst: Die “Suche nach Sinn” spielt auch außerhalb spezieller, sinnorientierter Therapieformen, insbesondere Frankls großartiger Logotherapie [2]eine wichtige Rolle: Uns “verstört und verunsichert die Frage nach dem Lebenssinn heute mehr als jemals zuvor. Denn es ist schwieriger geworden, im Werte - Chaos der modernen Gesellschaft Orientierung und Halt zu finden.”. [3]
Drei Beispiele , die besonders deutlich den Zusammenhang von Therapie und Wertvermittlung artikulieren, seien an den Anfang gestellt:
In einem generalisierenden Aufsatz “A Buyer’s Guide to Psychotherapy” stellt der Psychotherapeut Pittmann zusammenfassend fest [4]: “Die meiste Psychotherapie handelt nicht von mentaler Krankheit sondern von Werten - von Wertkonflikten vernünftiger und normaler Leute, die versuchen, ein Leben innerhalb großer personeller, familiärer und kultureller Verwirrungen zu führen.”
In ähnlich umfassender Weise sieht der Sozialpsychologe Kenneth Gergen mit seiner Theorie des “sozial gesättigten Ich” in Therapeuten “moderne Sinnstifter”, “Agenten eines bestimmten kulturellen Umfeldes”, die “mit den Klienten zusammen ihr jeweiliges Sinn‑System finden und wie es mit den Sinn‑Systemen anderer zusammenhängt...Die Herausforderung besteht darin, nicht in uns selbst nach uns eigenen Werten zu forschen, sondern sie in produktiven und bereichernden Formen von Beziehungen zu anderen Menschen zu finden.” [5]
Während die bekannten Gesprächspsychotherapeuten Annemarie und Reinhard Tausch in ihren frühen Arbeiten den Wertaspekt ihrer Tätigkeit eher anderer Terminologie subsummierten, enthält einer der späteren Anhänge ihres Standardlehrbuchs “Gesprächspsychotherapie” [6]nun den Abschnitt “Gesprächspsychotherapie: Eine Situation der Erleichterung von Umbewertungen der Klienten”. Anknüpfend an R. Lazarus’ emotiv - kognitive Therapie [7]stellen sie fest: “Viele Klienten kommen zu uns in Psychotherapie mit dem Wunsch nach Änderung ihrer belastenden Gefühle. Wenn Kognitionen (Bewertungen, wahrgenommene Bedeutungen) Gefühle zur Folge haben, und Änderungen der Kognitionen zu geänderten Gefühlen führen: dann können wir Gesprächspsychotherapie wesentlich ansehen als die Ermöglichung - Erleichterung von Um‑ und Neubewertungen bei den Klienten. Die Haupttätigkeit des Psychotherapeuten ist: dem Klienten optimale, nicht‑dirigierende Bedingungen zu schaffen, damit er diese Umbewertungen in einer für ihn wünschenswerten Weise vornehmen kann.” Dabei ist diese Einsicht keinesfalls auf die Gesprächspsychotherapie beschränkt, vielmehr können “kognitive Um‑ und Neubewertungen und damit dauerhafte Änderungen von Gefühlen und Verhalten ... durch verschiedenartige Erfahrungen ermöglicht werden.” [8]
Читать дальше