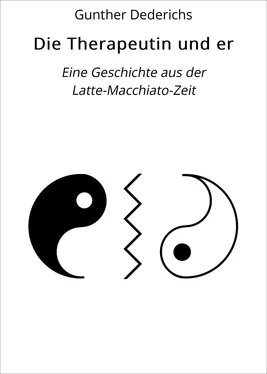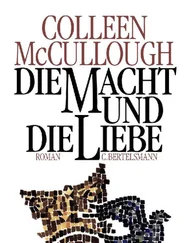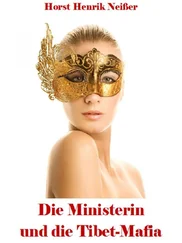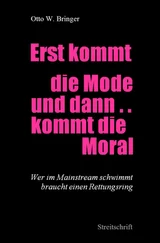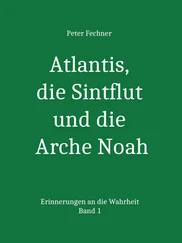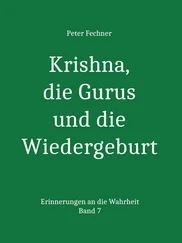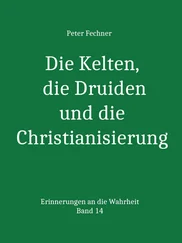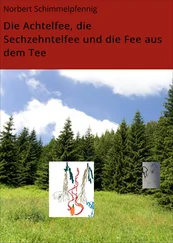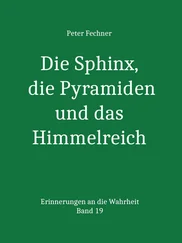Gunther Dederichs - Die Therapeutin und er
Здесь есть возможность читать онлайн «Gunther Dederichs - Die Therapeutin und er» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Therapeutin und er
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Therapeutin und er: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Therapeutin und er»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Partnerin, Therapeutin, ironiefrei, bestimmend, sensibel, impulsiv, unternehmungslustig, hedonistisch, mental und intellektuell geprägt von der Studentenrevolte und deren Nachfolgebewegungen, der Ich-Erzähler hingegen eher skeptisch gegenüber den Zeitströmungen. Dessen weitgehende Weigerung, ihren Wünschen und Forderungen nachzukommen, führt schließlich zum Ende der Beziehung.
Die Therapeutin und er — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Therapeutin und er», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Einige Motive vermittelten eine eher deprimierende, zum Teil sogar bedrohliche Stimmung, andere hingegen drückten Harmonie, Geborgenheit und Optimismus aus.
Sie erklärte ihm, es handele sich um ihr Seelenbild. Die einzelnen Motive versinnbildlichten verschiedene Abschnitte ihres Lebens. Jene mit einer eher negativen, düsteren Ausstrahlung symbolisierten vor allem ihre Vergangenheit, die helleren, freundlicheren Darstellungen ihre Zukunft.
Er hatte bisher noch nie von solchen Bildern gehört und fragte sich, ob er vielleicht die Ursache einer eventuellen positiven Wende in ihrem Leben ist. Mit ihrer Freundschaft begann für ihn neben anderem auch die hohe Zeit der Salatgerichte, für sie offenbar seit langem die abendliche Standardmahlzeit. So lernte er endlich, was es zum Beispiel mit Broccoli und Rucola auf sich hat. An diesem, wie er sich überzeugen konnte, durchaus bekömmlichen Grünzeug war er bis dahin in den Supermärkten achtlos vorübergegangen, vielleicht weil es auf den ersten – zumindest seinen ersten – Blick dem sogar ihm nicht unbekannten Kopfsalat zu ähnlich sieht um sein Interesse zu wecken – eben alles gleichmäßig grün. In Zukunft aber sollten diese neu entdeckten Gewächse eine zentrale Rolle in seiner Nahrungsaufnahme spielen, wie übrigens auch Mohrrüben und diverse Pilzarten, die man, wie sie ihm versicherte, guten Gewissens, ohne ins kulinarische Banausentum abzuirren, in den Blätterhaufen hineinschnippeln könne. Für ihn bedeutete die ungewohnte Ernährung zweifelsohne eine Bereicherung. Differenzen zwischen ihnen gab es allein über die Menge des zu ver(sch)wendenden Salzes. Ihm genügte etwa ein Drittel dessen, was sie gewöhnlich für sich benutzte. Das Problem wurde aber gelöst, indem jeder seine Portion selbst salzte beziehungsweise ver salzte. Sie schenkte ihm sogar ein paar Kochbücher – oder genauer: Koch hefte –, von denen er jedoch – sei es aus Bequemlichkeit, sei es weil er sich dafür nicht die Zeit nehmen wollte – leider nie Gebrauch machte. Zum Abendessen trank sie in der Regel ein oder zwei Gläser Rotwein, wozu er sich ebenfalls animieren ließ, allerdings ersetzte er schon bald den Wein weitgehend wieder durch Leitungswasser. Als sie am nächsten Morgen nach dem Frühstück noch eine Weile zusammen in der Küche saßen und den Kaffee zu Ende tranken, sagte sie, nachdem sie eine Zeitlang nicht gesprochen hatten, unvermittelt: Lass uns zusammen lernen, glücklich zu sein!« Statt sich einfach spontan zu freuen, was sie eigentlich auch von ihm erwarten durfte, worauf sie nach seinem Dafürhalten geradezu ein Anrecht hatte, brachte ihre Bemerkung ihn nur in Verlegenheit. Es tat ihm leid für sie. Sie hatte Besseres verdient, nämlich eine vorbehaltlos positive Reaktion, er aber war nicht in der Lage, auf ihr Angebot überhaupt einzugehen. Anstelle dessen versuchte er sich einen Zustand des Glücks auszumalen, sowohl mit ihr zusammen als auch ohne sie, was ihm jedoch beides nicht gelingen wollte. Er hatte das Gefühl, sie im Regen stehengelassen zu haben. Ihre Enttäuschung über seine Reaktion, oder richtiger, über das Ausbleiben einer adäquaten Reaktion, war ihm sehr wohl bewusst, er sah aber keine Möglichkeit, die Situation zu retten oder zumindest zu entschärfen, und hatte am Ende wohl nur resigniert mit den Schultern gezuckt. An seine Fähigkeit, vorbehaltlos glücklich zu sein, konnte er nicht glauben. Es hatte bei ihm einmal eine Zeit ziemlich großer Orientierungslosigkeit gegeben, in der er sich eine Menge Gedanken darüber machte, wie ein Leben sinnvoll zu gestalten sei, und sich auch mithilfe entsprechender Lektüre eingehend mit dem Thema beschäftigte – eine seiner zahlreichen Phasen, die er bisher durchlebt hat. Natürlich war dort auch immer wieder vom Glück die Rede. Einige diesbezügliche gut gemeinte Ratschläge sind ihm noch im Gedächtnis. Viel geholfen hat es ihm nicht. Wahrscheinlich aber ist mit einem gewissen Grad an Zufriedenheit schon viel gewonnen. Wenn sich dazu hin und wieder eine kurzzeitige euphorische Stimmung einstellt, so war es am Ende der Mühe wert. Seine Frau, eine eifernde, unbekehrbare Hobbyastrologin, hatte ihn wiederholt darauf hingewiesen, sein Aszendent sei der Saturn, und ihm detailliert erklärt, was das für die hiervon Betroffenen bedeutet. Die Frage nach dem Glück scheint ihm eingebettet in eine der was-wäre-wenn-Fragen der eher unoriginelleren Art, die Allerweltsfrage, die sich wohl so gut wie jeder irgendwann einmal stellt, nämlich was er anders machen würde, wäre er noch einmal einigermaßen jung, dabei aber beim sozusagen zweiten Versuch messbar undümmer und weniger unerfahren als seinerzeit. Was ihn betrifft, würde er die intellektuellen Irrungen seiner damaligen Unmeisterliche[n] Wanderjahre zwar weitgehend vermeiden, die nicht unwichtige Frage jedoch, was er einmal werden will, wenn er groß ist, wüsste er dann wohl noch immer nicht zu beantworten. Und wenn doch, dann bestimmt nicht ohne Vorbehalt. Nicht mit einem Punktum hinter seinem Entschluss, eher mit einem für ihn so typischen Na gut . Inzwischen kennt er sich zumindest so gut, sich keine Illusionen darüber zu machen, auch im quasi zweiten Anlauf weitgehend wieder genauso zu handeln. Der große Durchbruch würde ihm auch dann nicht gelingen. Ebenso gut oder schlecht wie dafür, wofür er sich letztlich entschieden hatte, hätte er sich auch anders entscheiden können. Oder heute, oder morgen, oder auch gar nicht? Liebeeh Frrroinnndeee, guten Abeeend! Als er ihr wenig später in all seiner Treuherzigkeit, zu der er fähig ist, dabei nicht einmal ansatzweise an etwas Böses denkend, gewissermaßen mit innerem Welpenblick schrieb, er habe sie gern , kam es zum ersten Eklat. Schließlich liebe sie ihn, schrieb sie zurück . Und er? Er hat sie nur gern? Seiner Erinnerung nach war dies das erste Mal, dass er bei ihr voll ins Fettnäpfchen trat und es war wohl ebenso ein Schuss in den Ofen wie die Bemerkung eines Mannes gegenüber einer Frau, sie habe eine interessante Nase, was er bisher nur bei schlanken Frauen beobachtet habe. Vielleicht ist es das Schlechteste nicht, insbesondere für die sich diesbezüglich häufig beklagenden Frauen, dass Männer in der Regel nicht allzu viel reden. Dass er bisher noch niemals einem Menschen gesagt hatte, er liebe ihn, mag zum einen damit zu tun haben, dass dieses Wort allzu häufig in populären Liedern vorkommt, zum anderen ist ihm die Fähigkeit, sich zu einem bestimmten Menschen in besonderem Maße hingezogen zu fühlen, permanent und intensiv an ihn zu denken, im Laufe der Zeit zum großen Teil abhandengekommen. Er wollte den Mund nicht zu voll nehmen. Mit solchen Begriffen jongliert man nicht. Er erinnerte sich, von einer Frau gelesen zu haben, die ihrem Mann freiwillig in die Verbannung gefolgt war, und dass sich Menschen aus Liebeskummer das Leben nehmen, ist auch ihm nicht unbekannt – einige wenige Beispiele nur, die ihn davon abhielten, solch ein hehres Wort zu verwenden. Liebe – eigentlich kaum auszusprechen, schon wegen des Klanges, des penetranten, dominierenden, spitzeligen, ins Schrille tendierenden I. Die Lautfolge ist nur einigermaßen erträglich, wenn das I etwas nachlässig und kurz, gleichzeitig ein wenig zurückgenommen gesprochen wird. L ’ amour dagegen klingt abgerundeter, harmonischer, fürsorglicher, auch substanzieller. Ihm als jemandem, der die Frankophilie hinter sich gelassen hat, fällt es nicht gerade leicht, das einzugestehen. Wie schnell bekommt man damit unversehens den Beifall von der falschen Seite. Aber Gerechtigkeit muss sein, auch auf die Gefahr hin, die falschen Divisionen mit Munition zu versorgen. Einer bestimmten Art frankophiler deutscher Frauen etwa, mit deutlichem Einschlag ins forciert Bourgeoise, die offenkundig alles daran setzen, französischer als Französinnen zu sein und sich – ganz im Gegensatz zu ihren durch die Gnade der Geburt in der richtigen Nation natürlich unerreichbaren Idolen – nicht selten schamlos, charmelos überschminkt der Öffentlichkeit präsentieren, mit dem Ergebnis, dass der Schuss auf peinliche Weise nach hinten losgeht und sie statt wie Französinnen wie Engländerinnen aussehen, beziehungsweise so, wie sich deutsche Bauarbeiter (er hat übrigens nichts gegen Bauarbeiter) Französinnen vorstellen – vielleicht gut genug als Dekoration für Bauwagen und Spinttüren, keinesfalls aber, um auf dem Boulevard bestehen, den Heimvorteil derer mit dem attraktiveren Stammbaum egalisieren zu können. Wer jemals offenen Auges in Frankreich herumgekommen ist, wird ohne Wenn und Aber bestätigen, dass übermäßiges Schminken dort deutlich weniger verbreitet ist als hierzulande. Das im wortwörtlichen Sinn zu dicke Auftragen ist weit mehr eine deutsche, insbesondere aber eine angelsächsische Geschmacklosigkeit. Eine anglophile Entsprechungen zu diesem Phänomen ist ihm in England in einem deutschen Anglistikstudenten begegnet, der mit teutonischer Gründlichkeit alles daran setzte, englisch zu erscheinen, sich einen englischen Habitus zuzulegen, das Englische englischer als die Engländer selbst zu sprechen. He actually tried to out-british the British. The most British German ever. Stets ist da ein falscher Zungenschlag, ein künstlicher Geschmacksverstärker, eine unechte Färbung, das Odium einer misslungenen Geschlechtsumwandlung, eines kulturellen Transvestinismus. Bei ihrem Disput über seine vermeintlich unzulänglichen Gefühle musste er an die Bemerkungen seines ehemaligen Kommilitonen Rainer denken, der in Bezug auf ihn des Öfteren von geringen Gefühlsamplituden , seiner flacher als üblichen Sinuskurve der Gefühlsschwankungen, der mangelnden Fähigkeit sowohl zum Glücklich- als auch zum Unglücklichsein sprach. Auch nehme er die Wirklichkeit nur ausschnittweise wahr, sehe die Welt quasi durch eine Milchglasscheibe. Angesichts dessen praktisch unersättlichem Verlangen nach intensiver Emotionalität hatte er solchen Argumenten nichts Überzeugendes entgegenzusetzen. In derselben Mail attestierte sie ihm, depressiv zu sein. Auf ihren Vorschlag, zu versuchen, gemeinsam glücklich zu sein, habe er nur etwas genickt und sie dabei so traurig angelächelt, als habe er sagen wollen, »wir können es ja versuchen, aber es wird sowieso nichts daraus, so wie ich mich kenne«. Aus dieser Depression, die zu Resignation und Lethargie führe, müsse er weitgehend herausfinden und sich dafür entsprechende Hilfe suchen, da das niemand allein schaffe. Sie könne das auf Dauer nicht ertragen, zumal sie tagtäglich mit Menschen zu tun habe, deren Neigung zur Resignation sie entgegenwirken müsse. Resignation sei das Schlimmste. Sie hoffe, sie habe ihn nicht zusätzlich deprimiert. Er möge es lieber so sehen, dass sie mit ihm, wenn, dann etwas Ernsthaftes im Sinn habe. Warum kommen ihr Tränen, wenn sie an ihn denke? Sie habe Sehnsucht nach ihm. Auch wenn ihre Argumente nicht ganz von der Hand zu weisen waren, so fand er ihre Analyse doch stark übertrieben, kaum weniger über sie selbst aussagend als über ihn. Er hat nun einmal Schwierigkeiten mit Menschen, die in vielem extrem und essentiell empfinden, die sich bereits bei geringfügigen Anlässen unverhältnismäßig echauffieren und keinerlei Abstand zu den Dingen haben. Sie kommen ihm vor wie gewisse Autofahrer, die, die Finger um das Lenkrad verkrampft, mit der Nase fast an der Windschutzscheibe kleben und dabei diesen geradezu überaufmerksamen Adlerblick haben. Besser und sicherer als andere fahren sie auch nicht. Und schon gar nicht entspannter oder gar mit mehr Spaß an der Sache. Zudem scheint eine Mentalität wie die ihre einherzugehen mit einer letztendlichen Humorlosigkeit. Es ist nicht so, dass solche Menschen nicht auch hin und wieder ausgelassen lachen können, im Grunde aber sehen sie doch vieles ziemlich verbissen. Sie vermitteln ihm stets das Gefühl der Unversöhnlichkeit, der Unzufriedenheit im Letzten. Natürlich können auch sie sich freuen und dankbar für etwas sein, ihre Grundstimmung aber scheint dominiert vom Hadern mit dem eigenen Schicksal, der Überzeugung, grundsätzlich etwas Besseres verdient zu haben. Sie habe Sehnsucht nach ihm – der Satz ging ihm nahe. Auch das hatte ihm noch niemand so unumwunden gesagt. Er musste sich eingestehen, dass von seiner Seite, gegenüber wem auch immer, Entsprechendes nie zu hören war. Sehnsucht bezieht sich bei ihm eher auf ein Verlangen nach dem ganz anderen, einem gänzlich anderen Lebensgefühl, frei von allen Grauschleiern und den alltäglichen Verknotungen, nach einer nicht näher spezifizierbaren großen Hoffnung, Zuversicht, Leichtigkeit, Heilsgewissheit, irgendetwas über allen Niederungen Erhabenem, nach dem letztendlichen großen, alles umschließenden und relativierenden befreienden Lachen. Sie sei gestern etwas erschrocken über seine Entferntheit gewesen und habe dadurch F. ein wenig verstehen können, denn diese Entferntheit hing ja offensichtlich mit dem Besuch bei seiner Mutter zusammen. Bewusst wünsche seine Mutter ihm sicher alles erdenklich Gute in einer Partnerschaft, aber unbewusst okkupiere sie ihn, noch ein wenig so wie in seiner Kindheit. Nur gut, dass sie sie andererseits auch verstehen kann, denn sie kenne diese liebevolle Vertrautheit zu einem Sohn, der das einzige männliche Wesen ist, dem frau wirklich vertrauen kann. So sei es lange Zeit zwischen ihr und ihrem Sohn ja auch gewesen. Insofern nehme sie ihm das nicht übel, aber es sei schon sehr auffällig gewesen, der Unterschied in seinem Kontakt zu ihr: Beim Abschied habe er sich kaum lösen können. Als er wiederkam – Stunden später als angekündigt – habe es über eine Stunde gedauert, bis er anrief und er hätte sie von sich aus gestern nicht mehr gesehen, wenn sie nicht lautstark protestiert hätte. Als sie dann da war, war er völlig abgeschottet, kaum Blickkontakt, kaum Körperkontakt. Sie sei trotzdem froh, dass sie zu ihm kam, denn es wäre ihr zu Hause allein schlecht gegangen, weil sie wieder Angst bekommen hätte, dass er sich völlig von ihr entfernt. Und es wurde ja auch wieder immer schöner und näher. Sie habe insgesamt ein sehr gutes Gefühl mit ihnen beiden, und sie hoffe, dass er sich wieder erholen wird von dem Schock ihrer »Bedenklichkeitsmail«, denn seitdem habe er sich doch emotional etwas zurückgezogen und geschützt, was sie gut verstehen könne. Er möge die Gefühle wieder ein bisschen mehr zulassen, wenn es geht. Sie freue sich auf das nächste Treffen mit ihm. Sie habe vorhin einen »Gipfel der Romantik« erklommen, sie hoffe, er falle nicht in Ohnmacht davon, aber ihr sei bei ihrem Telefonat vorhin so warm ums Herz gewesen. Er möge ihr bitte schreiben, was los sei (möglichst gleich, sie sei etwas unruhig).Warum hat er sich heute Morgen nicht von ihr verabschiedet? Worauf hat er mit seiner Sensibilität reagiert? Auf ihr Erschrecken?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Therapeutin und er»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Therapeutin und er» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Therapeutin und er» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.