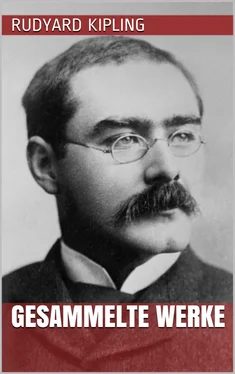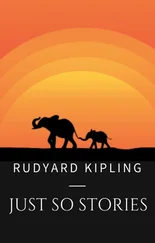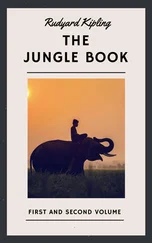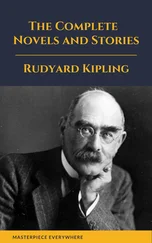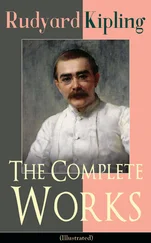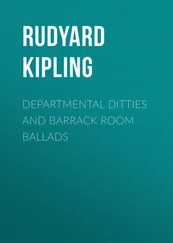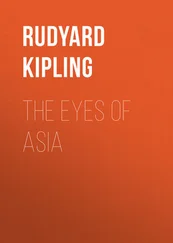Sage dem Kinde, sprach ich, daß der Sahib ihm nicht zürnt, und nimm ihn fort. Imam Din teilte meine Verzeihung dem Verbrecher mit, der inzwischen sein ganzes Hemd wie einen Strick um seinen Hals gedreht hatte, worauf das Heulen in stoßweises Seufzen überging. Sein Name, fügte Imam Din, als ob der Name ein Teil seines Vergehens wäre, ist Muhammad Din, und er ist ein Spitzbube. In dem sicheren Gefühl, der Gefahr glücklich entgangen zu sein, wandte sich Muhammad Din in den Armen seines Vaters herum und sagte mit Würde: Es ist wahr, ich heiße Muhammad Din, Tahib, aber ich bin kein Spitzbube, ich bin ein Mensch.
Seit diesem Tage war meine Bekanntschaft mit Muhammad Din gemacht. In mein Speisezimmer kam er nie wieder, aber auf dem neutralen Boden des Hofes und Gartens grüßten wir uns mit aller Feierlichkeit, obschon sich unsere Unterhaltung auf »Talaam, Tahib« von seiner und »Salaam, Sahib« von meiner Seite beschränkte. Jeden Tag, wenn ich vom Amte heimkam, sah ich das kleine weiße Hemd und den fetten kleinen Körper aus dem Schatten des lianenumschlungenen Geländers, wo sie verborgen geruht hatten, auftauchen, und regelmäßig zügelte ich hier mein Pferd, damit mein Gruß nicht übertönt oder ungebührlich geboten werde.

Gespielen hatte Muhammad Din niemals. Einsam vergnügte er sich auf meinem Grundstück innerhalb wie außerhalb der Rhabarbersträucher mit geheimnisvollen Unternehmungen. Eines Tages stieß ich zufälligerweise auf einige Erzeugnisse seiner Handfertigkeit. Er hatte den Poloball halb im Sande vergraben und sechs alte verwelkte Ringelblumen im Kreise herumgesteckt. Um diesen Kreis waren abwechselnd Stücke roter Ziegelsteine und zerbrochenen Porzellans gelegt, und das Ganze umschloß ein Sandwall. Der das Brunnenrad drehende Diener legte eine Fürbitte für den kleinen Baumeister ein, indem er sagte, es sei nur ein Kinderspiel und würde meinen Garten nicht sehr verunzieren.
Der Himmel weiß, daß es mir fern lag, damals oder später an das Spielwerk des Kindes zu rühren. Aber als ich an jenem Abende durch den Garten schlenderte, geriet ich unversehens mitten hinein und brachte durch meine Tritte, noch ehe ich es merkte, Ringelblüten, Sandmauer und Bruchstücke eines zerbrochenen Seifennäpfchens so heillos durcheinander, daß jede Hoffnung auf Wiederherstellung aussichtslos erschien. Am nächsten Morgen fand ich Muhammad Din, wie er über der von mir angerichteten Zerstörung leise vor sich hin weinte. Es hatte ihm jemand grausamerweise gesagt, der Sahib wäre sehr zornig auf ihn gewesen, weil er ihm seinen Garten ruiniert hätte, er habe das alte Zeug durcheinandergeworfen und dabei arg geschimpft. Eine Stunde lang mühte sich Muhammad Din, jede Spur von dem Sandwall und den Scherben sorgfältig zu vertilgen, und mit weinerlichem, reuevollem Gesicht sprach er diesmal, als ich vom Amte heimkam, sein Talaam, Tahib. Eine schleunige Erkundigung hatte zur Folge, daß Imam Din Muhammad Din mitteilte, er habe infolge meiner besonderen Gnade die Erlaubnis, sich in dieser Weise ganz nach Belieben zu belustigen. Da wuchs dem Kinde der Mut, und es begann, den Grundriß zu einem Gebäude zu entwerfen, das noch die Ringelblumen-Poloball-Schöpfung überstrahlen sollte.
Ein paar Monate lang konnte der dickköpfige kleine Sonderling in seiner bescheidenen Welt unter den Rhabarbersträuchern und im Sande nach Herzenslust sich ergehen im Entwerfen immer neuer Schlösser aus welken, weggeworfenen Blumen, glattgespülten Kieseln und aus Federn, die, denke ich mir, meine Hühner hatten lassen müssen – immer allein und immer vor sich hinmurmelnd.
Eines Tages fiel unweit einer der letzten feiner kleinen Bauten eine buntgesteckte Seemuschel zu Boden, und ich sah voraus, daß Muhammad Din mit Hilfe dieses Juwels etwas außergewöhnlich Glanzvolles erbauen würde. Und meine Erwartung täuschte mich nicht. Länger als eine halbe Stunde versank er in Nachsinnen, und sein Murmeln erhob sich zu lautem Jubel. Dann fing er an, im Sande Linien zu ziehen. Es wäre diesmal sicher ein Wunderschloß geworden, denn es war im Grundriß zwei Schritte lang und einen Schritt breit. Aber der Palast wurde niemals vollendet.
Am nächsten Tage war kein Muhammad Din am Reitweg, und kein Talaam, Tahib bewillkommnete mich bei meiner Heimkehr. Ich hatte mich an den Gruß so gewöhnt, daß mich sein Ausbleiben beunruhigte. Am folgenden Tage teilte mir Imam Din mit, das Kind liege im leichten Fieber und müsse Chinin haben. Er erhielt das Heilmittel und einen englischen Arzt dazu.
Es kann nichts aushalten, das einheimische Kleinzeug, sagte der Arzt, als er Imam Dins Wohnung verließ.
Eine Woche später hatte ich einen Anblick, für dessen Abwendung ich gern große Opfer gebracht hatte; ich begegnete nämlich auf dem Wege zum muhammedanischen Begräbnisplatz Imam Din, der von einem Freunde begleitet war und in seinen Armen in ein weißes Tuch gehüllt trug, was von dem kleinen Muhammad Din sterblich war.

Lispeth.
Wollt ihr auch bei Liebe Tempel schließen
Was für Götter stellet ihr mir her?
Drei in einem, einen in den drei'n?
Will mich lieber meinen Göttern weih'n! Kalt ist Christus, wirr die Dreiheitslehr'. Meine Götter lassen froh genießen.
Die Bekehrte.
Sie war die Tochter Sonus, eines Bergbewohners, und seines Weibes Jadéh. Als ihnen einmal der Mais mißriet und nachts zwei Bären in ihrem Mohnfelde hausten, das gerade über dem Sulejthal auf der Seite von Kotgarh lag, wandten sie sich dem Christentum zu und brachten ihr Kind zur Mission, um es taufen zu lassen. Der Kaplan in Kotgarh taufte es auf den Namen Elisabeth, im Pahari, der Sprache der Bergbewohner, »Lispeth« gesprochen.
Später kam die Cholera in das Thal von Kotgarh und raffte Sonu und Jadéh dahin, worauf Lispeth von der Frau des damaligen Kaplans in Kotgarh halb als Dienerin, halb als Gesellschafterin aufgenommen wurde. Es war dies nach der Herrschaft der mährischen Missionare, aber als Kotgarh immer noch von seinem Ruhme als »Herrin des nördlichen Berglandes« zehrte.
Ob das Christentum Lispeth besser machte oder ob die Götter ihres Volkes sie vielleicht ebensogut hätten gedeihen lassen, kann ich nicht sagen, doch sie wuchs in voller Lieblichkeit heran. Wenn aber eine indische Bergmaid lieblich erblüht, so lohnt sich's wohl, um ihres Anblicks willen fünfzehn Meilen weit über unwegsames Land zu wandern. Lispeth hatte ein griechisches Gesicht – eins von denen, die man so oft gemalt und so selten in Wirklichkeit zu sehen bekommt. Ihre Hautfarbe war matt, elfenbeinartig und ihre Gestalt für ihre Rasse sehr schlank. Auch besaß sie wunderbare Augen, und wäre sie nicht in den abscheulichen bedruckten Kattun, wie ihn die Missionen verwenden, gekleidet gewesen, man hätte sie bei plötzlicher Begegnung am Berghang für das Urbild der Diana halten können, wie sie dahin schreitet dem Weidwerk obzuliegen.
Lispeth gab sich der christlichen Lehre willig hin und ließ sie auch nicht, als sie Jungfrau geworden war, im Stich, wie wohl die Bergmädchen thun. Ihre Stammesgenossen haßten sie, weil sie, wie sie sagten, eine memsahib geworden wäre und sich täglich wüsche; und die Kaplansfrau wußte nicht recht, was sie mit ihr anfangen sollte. Es macht sich schlecht, eine stattliche fast sechs Fuß hohe Gottheit Teller und Schüsseln reinigen zu lassen. So spielte sie mit den Kindern des Kaplans, übernahm Klassen in der Sonntagsschule, las alle Bücher im Hause und wurde dabei immer schöner und schöner, wie eine Märchenprinzessin. Die Kaplansfrau sagte, sie sollte in Simla als Kindermädchen oder sonst etwas »Besseres« Stellung nehmen. Aber Lispeth wollte nicht in Dienst gehen, sie fühlte sich in ihrem jetzigen Zustande sehr glücklich.
Читать дальше