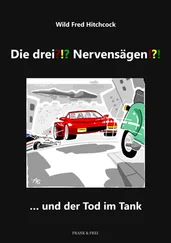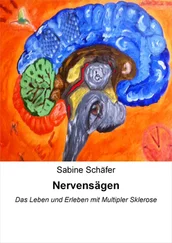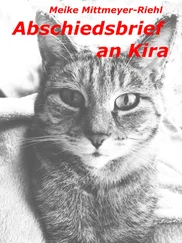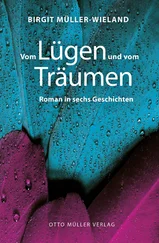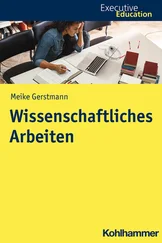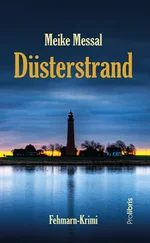Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Sie können andere Menschen nicht ändern. „Na toll“, denken Sie jetzt womöglich, „heißt das etwa, dass ich mein Leben lang die Launen, unangenehmen Angewohnheiten oder gar bewussten Bosheiten meines Gegenübers ertragen muss?“ Nein, ich kann Sie beruhigen: Sie können die Nervensäge zwar nicht umerziehen oder umkrempeln, aus einem introvertierten, muffeligen Einzelgänger werden Sie keinen offenen, unterhaltsamen Teamplayer machen. Eine erbenszählende Nörglerin werden auch Sie nicht ein eine schwärmerische „Ich-könnte-die ganze Welt-umarmen“-Anhängerin verwandeln. Aber - und das ist die gute Nachricht - Sie können ihn oder sie durch entsprechendes Verhalten Ihrerseits dazu anregen, sich für ein anderes Verhalten zu entscheiden und damit Schritt für Schritt die Zusammenarbeit für beide erträglich oder sogar gut gestalten.
Der Unterschied zur „Umerziehung“ liegt darin, dass der oder die andere selber entscheidet, ob er bzw. sie sich auch ändern möchte und vor allem wann. Wenn Sie es Ihrem Gegenüber durch Ihr Verhalten so schmackhaft wie möglich machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich auch auf der anderen Seite eine deutliche Veränderung in Gang setzt.
Wenn ich später zu Empfehlungen für ein gutes Miteinander komme, könnte bei dem einen oder der anderen der Eindruck entstehen, als müsse man gaaaaaanz viel Verständnis für den anderen zeigen und eigene Gefühle von Frust, Ärger, Wut, Traurigkeit, Empörung etc. unterdrücken. Aber genau darum geht es nicht, oder um es mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun auf eine sehr eingängige Formel zu bringen: „Gib dich nach außen hin nicht toleranter als du innerlich bist.“ 1
Die Grundsätze im Umgang miteinander zu beachten meint nicht, alles hinzunehmen, den Ärger herunterzuschlucken und womöglich das nervige Verhalten noch gutzuheißen, obwohl es einem total gegen den Strich geht. Es bedeutet vielmehr, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen und Worte zu finden, die auf Gehör stoßen. Worte, die es dem Gesprächspartner und der Gesprächspartnerin erleichtern, Sie überhaupt zu verstehen und mögliche Kritik anzunehmen – ohne Gesichtsverlust. Nur wenn das gelingt, gibt es Aussicht auf Erfolg, dass das Gegenüber bereit ist, das eigene Verhalten zu überdenken und sich künftig für ein anderes zu entscheiden. Wohlgemerkt – die Entscheidung liegt bei Ihrem Gegenüber. Nicht Sie krempeln ihn oder sie um, Sie helfen diesem Menschen im besten Falle, selbst einen neuen Weg zu wählen.
Apropos wählen: Je mehr Wahlmöglichkeiten Menschen haben, desto flexibler sind sie, desto freier auch – weil sie nicht nur reflexartig reagieren (müssen), sondern entscheiden können, welche Reaktion für welche Situation wohl am angemessensten wäre. Damit Ihre Wahlmöglichkeiten wachsen im Umgang mit schwierigen Menschen, biete ich Ihnen an, von verschiedenen Seiten die Herausforderung Nervensäge anzunehmen.
Nach ein paar grundsätzlichen Überlegungen zu der Frage, was schwierige Menschen überhaupt schwierig macht und warum Umerziehungsversuche sinnlos sind, habe ich folgendes Angebot für Sie: Richten Sie zunächst den Blick auf sich selbst. Im Kapitel „Der Blick nach innen – oder bei sich selbst beginnen“ gehe ich der Frage nach: Warum regt mich ein bestimmtes Verhalten eigentlich so auf? Ich beschreibe psychologische Phänomene wie Übertragung, Projektion und die Rolle unterdrückter Bedürfnisse. In den Ärger über andere mischt sich häufig ein Bedürfnis, das nicht erfüllt wurde: Immer dann, wenn wir uns über andere ärgern und wir das Gegenüber abstempeln als z. B. besserwisserisch, nörglerisch oder arrogant, sagen wir damit indirekt etwas über unsere Bedürfnisse aus.
Manchmal sind es auch die ein Leben lang „gepflegten“ Überzeugungen und Glaubenssätze, die den Ärger über das nervige Gegenüber anstacheln. Ich stelle Ihnen eine Methode vor, mit der Sie herausfinden können, ob der Ärger über die Nervensäge so etwas wie der Wink mit dem Zaunpfahl an Sie selbst ist, ja, eine Art Botschaft, doch mal die eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze zu überdenken und ggf. durch neue, hilfreichere zu ersetzen.
Immer wieder stelle ich Ihnen in diesem Buch Übungen vor, mit Hilfe derer Sie an eigenen Beispielen die vorgestellten Ansätze ausprobieren bzw. vertiefen können.
Ich bin mir sicher, dass Sie auf diese Weise tiefer gehende Erfahrungen machen und nachhaltig von dem Wissen profitieren können.
Im Kapitel „Sich auf die Welt anderer einlassen oder: Die Landkarte ist nicht das Gebiet“ richtet sich der Blick auf das Gegenüber. Hier geht es darum zu erkennen, was ihn oder sie treibt – man könnte auch sagen, wie er oder sie „tickt“. Was steckt hinter den Aussagen, hinter dem nervenden Verhalten? Was ist die eigentliche Absicht? Will er oder sie mir damit möglicherweise etwas ganz anderes sagen? Dreh- und Angelpunkt ist es zu erkennen und zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt.
Konflikte sind immer dann vorprogrammiert, wenn wir anfangen, unsere Sichtweise für die einzig wahre zu halten. Die Basis für den gelungenen Umgang ist also die wertschätzende Haltung und der Respekt. Den erweisen Sie, indem Sie die Individualität und damit auch die Unterschiedlichkeit Ihres Gegenübers akzeptieren und sich die Mühe machen, genau hinzuhören, was er oder sie mit der nervigen Verhaltensweise über sich aussagt. Es gilt, das so genannte Selbstoffenbarungsohr zu spitzen.
Im Kapitel „Reden und zuhören oder: Die wichtigsten Kommunikationsregeln“ dreht sich alles darum, die richtigen Worte zu finden. Welche Reaktionen sind empfehlenswert? Womit mache ich die Sache womöglich noch schlimmer, als sie vorher war? Was sind Kommunikationsförderer? Welche Macht Sprache hat, ist vielen Menschen nicht klar. Man kann mit Wörtern motivieren, Kraft spenden, Mut machen, ein Wohlgefühl erzeugen. Man kann aber auch Menschen herunterziehen, demotivieren, in einen schlechten Zustand versetzen. Mit Sprache lässt sich die Welt in der von Ihnen gewünschten Richtung in Bewegung bringen. Daher gilt es, sich wohl zu überlegen, welche Worte Sie wählen, wenn Sie mit der Nervensäge das Gespräch suchen.
Um eine Typologie der häufigsten Nervensägen geht es im darauffolgenden Kapitel. Das Einordnen von Menschen in Schubladen ist problematisch, da Etikettierungen einem Menschen in seiner Gesamtheit nicht gerecht werden. Warum trotzdem diese Darstellung? Mein Ziel liegt nicht darin, Personen zu stereotypisieren, sondern das Zuordnen zu einem bestimmten Typus soll helfen, die Neigung des Gegenübers zu der einen oder anderen Verhaltensweise besser zu verstehen und daraus Schlüsse für die eigene Reaktion zu ziehen. Neben den auffälligsten Verhaltensmerkmalen beleuchte ich mögliche Hintergründe der störenden Verhaltensweisen. Ich beschreibe übliche und empfehlenswerte Reaktionen und biete Ihnen als „Bonustrack“ die Möglichkeit, am Ende jeder Beschreibung in einer 4-Schritte-Intervention zu prüfen, welche eigenen Anteile möglicherweise eine Rolle spielen, dass gerade Sie auf einen bestimmten Nervensägentyp so „anspringen“.
Mit dem letzten Kapitel können Sie sich verwöhnen. Hier dreht sich alles um Ihr „Zustandsmanagement oder: Die Reise zur eigenen Mitte“. Je ausgeglichener man selber ist, desto weniger können einem Störungen, schwierige Situationen oder Menschen anhaben. Lesen Sie und probieren Sie aus, was Sie für sich tun können, um gelassen in Ihrer Mitte anzukommen und vor allem dort zu bleiben.
Sind Sie neugierig auf die Lektüre geworden? Ich freue mich, wenn Sie meiner Einladung folgen, und wünsche Ihnen viel Spaß und größtmöglichen Nutzen.
Meike Müller
Was schwierige Menschen schwierig macht
„Die Hölle, das sind die anderen.“
Читать дальше