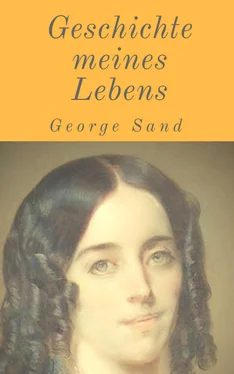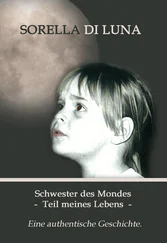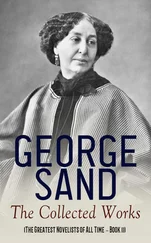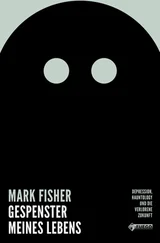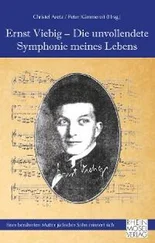Mein Vater hatte sich in Boulogne-sur-Mer aufbieten lassen und schloß die Heirath in Paris ohne Vorwissen seiner Mutter. Dies würde jetzt nicht möglich sein, aber damals war es möglich, Dank der Unordnung und Unsicherheit, welche die Revolution in alle Verhältnisse gebracht hatte. Das neue Gesetzbuch ließ noch einige Möglichkeit die Einwilligung der Eltern zu umgehen, und der Fall der „Abwesenheit“ war in Folge der Emigration leicht unterzuschieben und wurde oft gebraucht. Es war damals ein Moment des Ueberganges von der alten Gesellschaft zur neuen, und das Räderwerk der letzteren wollte noch nicht recht in den Gang kommen. — Weitere Einzelheiten will ich nicht angeben, obgleich mir die betreffenden Papiere vorliegen, um den Leser nicht mit trockenen Rechtsfragen zu langweilen. Gewiß ist, daß man einige Formalitäten, die jetzt unentbehrlich wären, die man damals aber nicht für unbedingt nöthig hielt, gar nicht oder nur ungenügend erfüllt hatte.
Meine Mutter war ein lebendiges Beispiel dieser Uebergangsperiode. Alles, was sie von dem Civil-Akte ihrer Heirath begriffen hatte, war, daß er die Legitimität meiner Geburt sicherte.
Sie war fromm und blieb es immer, ohne sich der Frömmelei zu ergeben — und was sie als Kind geglaubt hatte, glaubte sie so lange sie lebte, aber sie kümmerte sich nicht um die bürgerlichen Gesetze und dachte nicht daran, daß ein Akt des Municipal-Beamten ein Sakrament ersetzen könnte. Sie machte sich also auch keine großen Skrupel wegen der Unregelmäßigkeiten, welche die Schließung der Civil-Ehe erleichterten, aber sie trieb dieselben soweit, als es sich um die kirchliche Trauung handelte, daß meine Großmutter derselben, trotz ihrer Abneigung, beiwohnen mußte. Aber das fand später statt, wie ich erzählen werde.
Bis dahin hielt sich meine Mutter nicht für die Mitschuldige einer rebellischen Handlung gegen die Mutter ihres Mannes, und wenn man ihr sagte, Madame Dupin sei sehr aufgebracht gegen sie, so pflegte sie zu antworten:
„— Wirklich, das ist sehr ungerecht — sie kennt mich noch nicht; sagen Sie ihr doch, daß ich mich, ohne ihre Einwilligung, nicht mit ihrem Sohne in der Kirche trauen lassen werde.“
Mein Vater sah wohl, daß er dieses naive und zugleich achtungswerthe Vorurtheil niemals besiegen würde, das im Grunde auf wahrem Glauben beruhte, denn wenn man Gott nicht leugnet, muß man auch wünschen, daß der Gedanke an ihn eine heilige Handlung begleite, wie die Schließung eines Ehebundes ist. Er wünschte dringend den seinigen durch die Kirche weihen zu lassen, denn bis dahin fürchtete er noch immer, daß Sophie sich nicht durch ihr Gewissen gebunden halten und Alles wieder in Frage ziehen würde. Er zweifelte nicht an ihr — er konnte nicht an ihrer Zuneigung und Treue zweifeln, aber sie hatte Anfälle eines entsetzlichen Stolzes, wenn er sie den Widerstand seiner Mutter merken ließ. Sie sprach dann von nichts Geringerem, als fort zu gehen und mit ihren Kindern von ihrer Hände Arbeit zu leben, um zu beweisen, daß sie weder Almosen noch Verzeihung von dieser hochmüthigen „großen Dame“ verlange, von der sie sich einen sehr falschen und schrecklichen Begriff machte.
Wenn Moritz sie überreden wollte, daß ihre Ehe unauflöslich sei und daß seine Mutter früher oder später doch ihre Einwilligung geben würde, entgegnete sie: „O nein, Euere Civil-Ehe hat nichts zu bedeuten, denn sie läßt die Scheidung zu, welche die Kirche nicht erlaubt, also sind wir nicht verheirathet und Deine Mutter hat mir nichts vorzuwerfen. Es genügt mir, Das Schicksal meiner Tochter (ich war damals schon geboren) gesichert zu sehen — für mich verlange ich nichts von Dir; und habe vor Niemand zu erröthen.“
Die Gesellschaft stimmte mit diesem einfachen und kräftigen Raisonnement nicht überein, das ist wahr, und sie würde jetzt, wo sie auf ihrer neuen Basis feststeht, noch weniger damit übereinstimmen, aber zu der Zeit, in der diese Dinge vorgingen, hatte man schon so viele Erschütterungen und so viel Unglaubliches gesehen, daß man nicht gewiß wußte, auf welches Terrain man den Fuß setzte. Meine Mutter hatte die Meinung des Volkes über alles das. Sie beurtheilte weder die Ursachen noch die Folgen der neuen Grundlage der revolutionären Gesellschaft. „Alles wird sich noch ändern ,“ sagte sie. „Ich habe Zeiten erlebt, wo es keine andere als die durch die Kirche geschlossene Ehe gab — plötzlich behauptete man, diese tauge nichts und solle nicht mehr gelten, und man erfand dann eine andere, die nicht bestehen wird und auf die man nichts geben kann.“
Sie hat bestanden, aber sie ist wesentlich verändert worden. Die Ehe-Scheidung ist erlaubt gewesen, dann abgeschafft worden und jetzt spricht man davon, sie wieder einzusetzen. [Ich schreibe das am 2. Juni 1848 und weiß noch nicht, wie die Lösung des Projektes sein wird, welches der National-Versammlung durch den Minister Crémieux vorgelegt ist.] Man hätte keinen ungünstigeren Moment zur Besprechung einer so ernsten Frage wählen können, und obgleich ich über diesen Punkt zu festen Ansichten gekommen bin, würde ich doch, wenn ich bei der National-Versammlung wäre, verlangen, daß man zur Tagesordnung überginge. Man kann das Schicksal und die Religion der Familie nicht in einem Augenblicke ordnen, wo die Gesellschaft sich in einem Zustande moralischer Verwirrung, um nicht zu sagen Anarchie, befindet. Und dann, wenn man die Frage zur Verhandlung bringt, werden die kirchlichen und bürgerlichen Ideen auf's Neue in Streit gerathen, statt nach der Einheit zu streben, ohne die das Gesetz keinen Sinn hat und seinen Zweck nicht erreicht. Wird die Ehe-Scheidung verworfen, so heiligt man einen Zustand der Dinge, welcher der öffentlichen Moral widerstrebt — wird sie angenommen, so wird dies in einer Weise und unter Umständen geschehen, daß sie die Moral nicht fördert und den religiösen Bund der Familie nur noch mehr lockert. Ich werde meine Ansicht aussprechen, wenn es nöthig ist, und kehre jetzt zu meiner Geschichte zurück.
Als ich geboren wurde, zählte mein Vater sechsundzwanzig, meine Mutter dreißig Jahre. Meine Mutter hatte niemals Jean Jacques Rousseau gelesen, hatte vielleicht auch nicht viel von ihm sprechen hören, das hielt sie aber nicht ab, meine Amme zu sein, wie sie die aller ihrer andern Kinder wurde. Aber um Ordnung in die Folge meiner eignen Geschichte zu bringen, muß ich die meines Vaters verfolgen, dessen Briefe mir als Wegweiser dienen, denn man kann sich leicht denken, daß meine eignen Erinnerungen sich nicht bis zum Jahre XII zurückerstrecken.
Mein Vater brachte, wie ich schon früher mittheilte, nach seiner Verheirathung vierzehn Tage in Nohant zu, ohne daß es ihm möglich war, seiner Mutter das Geständniß zu machen. Er kehrte unter dem Vorwande, sich um das ewige Hauptmannspatent, das nicht ankommen wollte, zu bemühen, nach Paris zurück und fand alle seine Bekannten und Verwandten von der neuen Monarchie sehr wohl aufgenommen. Caulaincourt war Oberstallmeister des Kaisers; der General von Harville Oberstallmeister der Kaiserin Josephine; der gute Neffe René Kammerherr des Prinzen Louis; seine Frau Gesellschaftsdame der Prinzessin u.s.w. Die letztere überreichte Madame Murat einen Bericht über die Dienste meines Vaters, den Mad. Murat in ihr Mieder steckte. Mein Vater schrieb darüber am 12. prairial im Jahre XII: „Die Zeiten sind wiedergekommen, wo die Damen über Rang und Würden verfügen und wo das Mieder einer Prinzessin mehr verspricht, als das Schlachtfeld. Mag es sein! Ich hoffe, mich von diesem Mieder rein zu waschen, wenn es wieder Krieg giebt und meinem Vaterlande für das zu danken, was es mich auf eine unrechte Weise zu erlangen zwingt.“ Dann fährt er, auf seine persönlichen Unannehmlichkeiten kommend, fort: „Man bringt mir in diesem Augenblicke einen Brief von Dir, meine gute Mutter, durch den Du mich betrübst, indem Du Dich betrübst. Du behauptest, ich sei, als ich bei Dir war, sorgenvoll gewesen und habe mir Worte der Ungeduld entschlüpfen lassen. Aber habe ich denn je auch nur in Gedanken ein solches Wort an Dich gerichtet? Ich würde lieber sterben, als dies thun. — Du weißt wohl, daß diese Worte nur die Entgegnung auf Deschartres' verletzende und unzeitige Predigten waren. Niemals noch, wenn ich bei Dir gewesen bin, habe ich mit Ungeduld nach dem Tage verlangt, der mich von Dir entfernen sollte. Ach, wie grausam dies Alles ist — wie ich dabei leide! Ich kehre bald zu Dir zurück, um Dich nach Beweisgründen für Deinen Brief zu fragen, böse Mutter, die ich so sehr liebe!“
Читать дальше