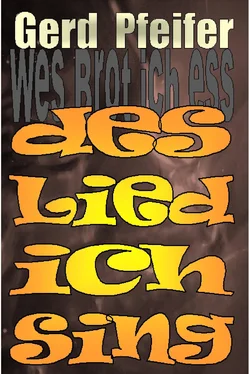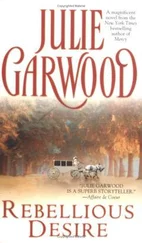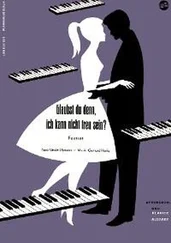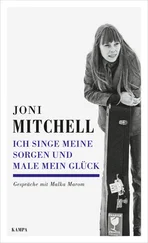Er wird einen solchen Satz niemals in der Öffentlichkeit von sich geben. Sein Inhalt entspricht nicht dem aktuellen Selbstverständnis der Dummen, die überall dominieren. Seine Meinung von den Menschen ist von Geringschätzung geprägt.
Er übernahm den ersten Pachtbetrieb seiner beruflichen Laufbahn, während die Olympischen Spiele in Berlin begannen. Adolf Hitler war Führer und Reichskanzler der Deutschen. Dass im Jahr zuvor die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bei den Reichstagswahlen nur vierundvierzig Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht hatte, war längst vergessen. Die Rückgliederung des Saarlands wurde mit einundneunzig Prozent Ja-Stimmen begrüßt. Die Nürnberger Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre schufen die Voraussetzungen für die Herrschaft der deutschen Herrenrasse, deren Repräsentanten – klein, schwarzhaarig, behindert – ihrem Idealbild eines deutschen Mannes so gar nicht ähnlich waren; und die nach dem Ersten Weltkrieg entmilitarisierte Zone des Rheinlands wurde besetzt. Deutschland geriet wieder zu einer Macht in Europa. Das war nicht nur die Aussage der politischen Propagandamaschine, sondern die feste Überzeugung der Mehrheit der Deutschen, die auch zu glauben begonnen hatten, dass sie zuvor durch den Versailler Friedensvertrag gedemütigt worden waren.
Hinzu kam der sichtbare Erfolg der deutschen Wirtschaft. Die Leute waren überzeugt, dass es ihnen besser ging als je zuvor. Ein neues Bürgertum bildete sich, das es sich leisten konnte, Ferien an der Ostsee zu machen. Und eine neue politische Kaste war entstanden, weniger elitär als bisher, aber ebenso ausgabefreudig. Dem Gastwirtssohn aus Altona, den es an die Ostsee verschlagen hatte, waren beide recht, der politische Bürger und der bürgerliche Politiker – wenn sie nur bei ihm speisten. Und es war ihm einerlei, wer die Rechnungen bezahlte. Aber mit Politik wollte er nichts zu tun haben. Er war Gastwirt und hielt sich für verpflichtet, seine Türen für alle geöffnet zu halten – wenn sie denn ihre Zeche zahlten. Und fast alle konnten es. So gut ging es den Deutschen unter den neuen Herren. Selbst die Skeptiker waren dieser Meinung.
Georgs Selbstbewusstsein erlaubte ihm nicht, sich über den Erfolg seines Astoria im Seehotel zu wundern. Sein ehrgeiziges Ziel war es, das erste Haus am Platze zu führen. Er hatte keine Angst vor großen Plänen, und es mangelte ihm nicht an Durchsetzungskraft, sie zu verwirklichen. Für ihn gab es keinen Unterschied zwischen Berufs- und Privatleben. Das Astoria war ihm beides. Es gab keine Minute seines Lebens, die – wenn es sich als nötig erwies – nicht dem Astoria vorbehalten war. Darüber hinaus war ihm seine Gastwirtsrolle auf den Leib geschneidert. Er besaß eine Art unbeholfenen Charmes und eine Beflissenheit, die seine Gäste zu Fürsten machte. Jedermann fühlte sich ihm überlegen, und er pflegte seine forcierte Bescheidenheit. Wenn er – als er sie noch nicht unterverpachtet hatte – hinter der Bar stand und die Cocktailtrinker bediente, die er nicht weniger verachtete als die Schnapssäufer vor seines Vaters Theke in Altona, spielte er immer den servilen Bartender. Manchmal sprach er sogar von einem gestrengen Chef, den es zu befriedigen gelte. Und wenn er Trinkgeld bekam, nahm er es wie selbstverständlich und betrachtete es als sein Privileg, es allein behalten zu dürfen, weil er einen Anteil am Tronc, der Gemeinschaftskasse der Angestellten für Trinkgelder, natürlich nicht besaß.
Er war ein Leiter seines Betriebs, der souverän herrschte. Streitigkeiten unter Angestellten, die den Geschäftsablauf störten, schlichtete er durch Entlassung aller Beteiligten. Er scheute nicht davor zurück, juristisch haltbare Gründe frei zu erfinden. Andererseits zahlte er – nach seiner Ansicht – faire Gehälter. Loyalität wurde belohnt.
Im Laufe der Zeit entwickelte er einen untrüglichen Blick für Blender und Schmeichler. Seine gelegentlichen Zornesausbrüche, wenn er sie denn für erforderlich hielt, waren gut gespielt. Seine engeren Mitarbeiter erkannten, dass es ihm ausschließlich darauf ankam, Geld zu verdienen. Diesem Ziel ordnete er seine gesamte Zeit, sein Privatleben, seine Gefühle, selbst seinen Ehrgeiz unter. Und es war selbstverständlich für ihn, dass alle Welt die gleichen Zielvorstellungen besaß. Andere Ziele hielt er für absurd. Von seinen Mitarbeitern erwartete er nichts anderes.
Erst in hohem Alter akzeptierte er, dass Menschen auch mit anderen Sinnfindungen leben können. Bis dahin war es für ihn nicht vorstellbar, dass ein zivilisierter Mensch der Erreichung finanzieller Unabhängigkeit nicht die oberste Priorität einräumen könnte. Andere Zielsetzungen waren die Ausreden der Erfolglosen. Der Lafontainesche Fuchs und seine Trauben waren eine Metapher, mit der er sich viele menschliche Seelenzustände, gelegentlich auch seine eigenen, erklären konnte.
Bereits nach zwei Jahren begann ihn das Astoria zu langweilen. Er hatte sich und der Brauerei bewiesen, dass er das Geschäft verstand. Sein Ehrgeiz richtete sich nun auf größere Betriebe. Er begann neue Verhandlungen mit der Brauerei:
"Sie können Ihre Pachteinnahmen für den hiesigen Laden", meinte er abfälliger als es seine Absicht war, "leicht verdoppeln, wenn Sie ihn anderweitig vergeben. Vielleicht gibt es einen Betrieb, der zu mir und meiner Mannschaft besser passt, wenn Sie ihn mir überlassen."
Die Brauereioberen verstanden ihn nicht. Zwar versuchten sie, seine Pacht zu erhöhen – was ihnen nicht gelang; sein Vertrag war unantastbar –, aber mit einer vorzeitigen Auflösung des Pachtverhältnisses waren sie auch nicht einverstanden. Wahrscheinlich fürchteten sie, dass ein Nachfolger ebenso erfolglos sein könnte wie seine Vorgänger.
Bis er sie vor vollendete Tatsachen stellte.
Er bedeutete seiner Verpächterin, dass er in absehbarer Zeit einen anderen Betrieb übernehmen werde. Sie könne ihn in Frieden ziehen lassen oder er würde das Astoria stilllegen. Für ihn sei der Vertrag eindeutig; eine Betriebspflicht gebe es nicht. Er würde die Grundpacht, einen eher lächerlichen Betrag, pflichtgemäß zahlen und im Übrigen den neuen Betrieb zum Erfolg führen. Die Brauerei möge sich ausrechnen, wer dabei verlöre.
Nach ein paar ebenso wortreichen wie unbegründeten Drohungen des Brauereijustitiars wurde – nachdem die Gegenseite begriffen hatte, dass er mindestens ebenso skrupellos war wie sie, wenn es um seinen Vorteil ging – der Pachtauflösungsvertrag sachlich vereinbart.
Die Brauerei hatte ausreichend Zeit, einen neuen Pächter zu finden, und Georg konnte über den neuen Pachtvertrag ohne Zeitdruck verhandeln, weil er die Beurkundung der Auflösung hinauszögerte, bis er den neuen Vertrag vereinbart hatte.
Das Hotel, das er zu übernehmen gedachte, lag knapp fünfzig Kilometer vom Astoria entfernt. Bevor er mit ernsthaften Verhandlungen begann, hatte er sich mehrfach an Ort und Stelle informiert. Aufschlussreicher als jede Büroauskunft galt ihm Volkes Meinung. Er gab sich als Tourist aus, den das leerstehende Haus wunderte.
"Die Käufer sind in Konkurs gegangen", wurde ihm erklärt.
"Warum?"
Schulterzucken.
Aber er ließ sich nicht beirren und fragte weiter, bis er hörte:
"Die alten Eigentümer waren Juden. Ihr Hotel ist arisiert worden. Aber die neuen Eigentümer, Hoteliers aus dem Ruhrgebiet, haben immer nur selbst gefeiert. Ständig waren Freunde und Bekannte da und haben die zahlenden Gäste verscheucht."
"Und wer ist jetzt der Eigentümer?"
"Die Brauerei."
Das Glasschild mit dem Firmenlogo prangte über dem Eingangsportal.
Das Gebäude, hatte er sich sagen lassen, war reiner Jugendstil. Er musste nachlesen, was es mit dem Art Nouveau auf sich hatte, und wunderte sich, wie viel sinnlose Sätze über ein paar verschlungene Äste, Zweige, Blätter und Pfauen geschrieben werden können. Aber er fand das Geranke und Geringel ganz interessant. Besonders diesen Engländer, Beardsley, dessen Zeichnungen in dem Prachtband über den Jugendstil abgebildet waren, mochte er. Aber ob sich sein Publikum für die wild wuchernde Ornamentik erwärmen würde? In Mode kamen doch gerade finster blickende nackte Männer mit festen Muskeln, kleinen unverhüllten Geschlechtsteilen und manchmal einem neuzeitlichen Stahlhelm auf dem Kopf. Vielleicht würde er so ein übermannsgroßes Ding kaufen und neben den geschwungenen Treppenaufgang mit dem lianenhaften Handlauf stellen müssen – wenn die Gäste das schön fänden.
Читать дальше