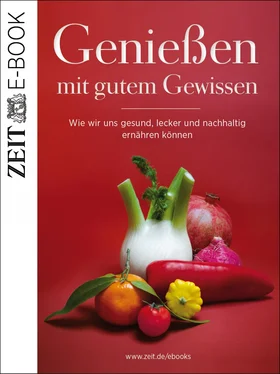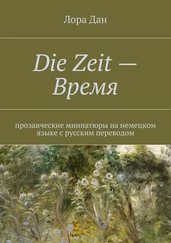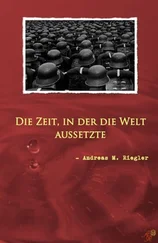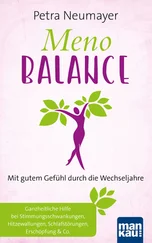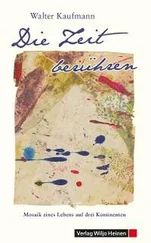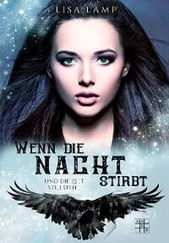Ausgiebiger Fleischgenuss signalisierte lange Zeit Wohlstand, und Wohlstand signalisierte soziale Integration. Je bedeutender der Mensch, desto größer die Fleischportion auf seinem Teller. Vegetarismus hingegen war eine Lebensweise mit dem zweifelhaften Odium einer sektiererhaften Marotte. Sie berief sich zwar gelegentlich auf eine ferne antike Überlieferung (die Orphiker und die Pythagoräer waren Vegetarier), entstand aber eigentlich erst in den Umtrieben der Lebensreformbewegungam Ende des 19. Jahrhunderts, die ihrerseits eine widerspenstige und anarchische Reaktion auf die Zwänge der beginnenden Industrialisierung war.
Der Vegetarier war ein Sonderling, ein Außenseiter der Gesellschaft. An ihm haftete der Makel, sich einem zentralen Übereinkommen des vernünftigen Zusammenlebens zu widersetzen. Wer nicht wie alle anderen Fleisch aß, war womöglich auch sonst zu nichts Ordentlichem zu gebrauchen. Zahlreich waren die Anekdoten, die das berufliche Missgeschick dieses oder jenes Großonkels auf die in meiner Familie seit Generationen verbreitete Unfähigkeit, Tiere zu essen, zurückführten.
Das alles scheint lange her zu sein und ist doch erst seit Kurzem vorbei. Heute ist der Vegetarismus in jedem Sinn in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Vegetarische Gaststätten gibt es überall in den Innenstadtvierteln, in Berlin hat erst kürzlich die erste vegetarische Mensa eröffnet. Es gibt viele Intellektuelle und Künstler, die sich für den Vegetarismus einsetzen. Und es gibt einen Vegetarismus-Chic in den besseren Kreisen. Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foerveröffentlichte im Jahr 2010 ein viel diskutiertes Buch, das uns in schönster Offenheit dazu auffordert, am besten keine und am zweitbesten weniger Tiere zu essen. Alles schön und gut. Bleibt nur noch die Frage, ob wir Tiere überhaupt töten dürfen.
Normalerweise werben die Vegetarier für ihre Lebensart, indem sie den Fleischessern die gesundheitlichen Nachteile ihrer Ernährungsweise mahnend vor Augen halten. Dazu zählen unter anderem Herz- und Krebsleiden und eine mögliche Übertragung von Keimen und Giftstoffen. Das alles ist bedenkenswert. Für die Frage nach unserem Recht, Tiere zu töten, um sie zu essen, sind diese luxuriösen Diskussionen um die möglichen Zuwachsraten unseres ohnehin bereits beträchtlichen leiblichen Wohlergehens aber unerheblich.
Das gilt auch für den noch viel gewichtigeren Trumpf in der Hand der Vegetarier: ihren Hinweis auf die ungeheuere Belastung der Erde durch die Treibhausgasemissionen, die durch die Massentierhaltung entstehen. Nach Messungen des unabhängigen Washingtoner Worldwatch Institute ist die Massentierhaltung nicht nur, wie bisher angenommen, für 18 Prozent, sondern sogar für über 50 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Fleisch essen ist schlimmer als Auto fahren. Von dem unverantwortlichen Wasserverbrauch, der unwirtschaftlichen Vernichtung von Anbaufläche, der Rodung der Wälder zur Vermehrung von Weideflächen noch gar nicht zu reden. Niemand bezweifelt diese für unsere Überlebensaussichten äußerst betrübliche Diagnose. Sie ist ein starkes Argument für eine drastische Senkung des Fleischkonsums. Doch erspart auch sie uns nicht die alles entscheidende Frage, die man auch unseren ökologisch korrekten Urahnen hätte stellen müssen: Wer darf wen töten und warum?
Die Entscheidung ist bereits gefallen. Der Mensch genießt das Recht auf leibliche Unversehrtheit. Das Recht des Tieres, das wir ihm einräumen, besteht demgegenüber darin, vor dem Zerstückelt- und Ausgenommenwerden durch einen Metallbolzen, der ihm den Schädel spaltet, betäubt oder an einem Haken kopfüber aufgehängt durch ein elektrisches Wasserbad gezogen zu werden. Das Ungleichgewicht der Rechte springt ins Auge, wird aber außer von einigen Tierethikern wie Peter Singer, Tom Regans, Helmut F. Kaplan, Ursula Wolf und den unermüdlich, teils auch radikal kämpfenden Tierrechtsorganisationen wie Petakaum infrage gestellt. Es ist die Grundlage dessen, was wir als Normalität bezeichnen. Aber was, wenn wir uns einfach geirrt haben? Ist es möglich, dass, was seit Jahrtausenden als normal gilt, dennoch ein ungeheueres Unrecht ist?
Ja, es ist möglich. Die Gründe, die wir für das eklatante Ungleichgewicht der Rechte zwischen Mensch und Tier geltend machen, sind allesamt windig. Überdies sind sie widersprüchlicher Natur. Sie stehen sich gegenseitig im Weg, weil sie sich wahlweise auf den tierischen oder auf den göttlichen Ursprung des Menschen berufen. Einerseits, heißt es, töte der Mensch Tiere, weil er – selbst ein Tier – nicht anders kann. Das ist die sogenannte Naturthese: Tiere fressen eben Tiere.
Andererseits behauptet man, gerade die evolutionäre Überlegenheit des Menschen erlaube ihm, das Tier zu töten und mit seinen Leichenteilen Handel zu treiben. Das wäre die Kulturthese: Der Mensch isst Tiere, weil er besser ist als sie. Beide Begründungen hinken und sollten uns nicht ruhig schlafen beziehungsweise essen lassen. Einzig wer meint, dass man Tiere schon allein deswegen töten darf, weil ihre sterblichen Überreste, gut gebraten und gewürzt, gut schmecken, kann sich unbesorgt zu Tisch setzen (und wird betrüblicherweise spätestens an dieser Stelle die Lektüre des Artikels abbrechen).
Welche Entschuldigung haben wir den vier Rindern, 46 Schweinen, vier Schafen, 46 Truthähnen, zwölf Gänsen, 37 Enten und 945 Hühnern, die jeder Fleischesser durchschnittlich in seinem Leben verspeist, für ihren Tod also zu bieten? Betrachten wir zunächst die Naturthese. Fleisch essen gehöre angeblich zur menschlichen Natur. Doch was ist die Natur des Menschen? Vor allem ist sie ein Wort, das, wenn es im Sinn von Ursprünglichkeit oder Gottgegebenheit verwendet wird, jede Diskussion beendet (siehe Natur der Frau, Natur der Schwarzen und so weiter).
Die akademische Debatte darüber, ob der Steinzeitmensch eher ein Pflanzen- oder ein Fleischfresser war, verliert sich schnell im Nachmessen der Darmzotten und des Zungendurchmessers. Die eine Fraktion beruft sich auf die Reißzähne und die Magensäure des Menschen, um ihn den Karnivoren zuzuschlagen. Der anderen gilt als Beweis für sein natürliches Pflanzenfressertum, dass er anders als jedes karnivore Tier Fleisch im rohen Zustand nicht herunterbekommt.
Für die Frage, ob wir dürfen, was wir tun, nämlich morden, um zu essen, spielt dieser Streit um die Ernährungsgewohnheiten des Menschen in der Frühzeit keine Rolle. Denn selbst wenn der Urmensch die Tiere den Blättern vorgezogen hat oder vorziehen musste, ist dies kein Grund, ihm nachzueifern. Seit Jahrtausenden ist der Mensch damit beschäftigt, die rohen Sitten seiner Urahnen zu zähmen und zu kultivieren. Ein Vorgang, den man Zivilisation nennt und der uns immerhin schon so weit gebracht hat, Zeitung zu lesen, zum Mond zu fliegen und von der Unsitte des angeblich besonders schmackhaften Menschenfleischverzehrs abzulassen (es gibt Berichte von bekehrten Wilden, die auf dem Totenbett in Erinnerung an die Menschenfleischgenüsse ihrer Kindheit vor Sehnsucht geweint haben sollen). Warum sollten wir ausgerechnet an der Fleischtheke in der Steinzeit stehen bleiben?
Auch die Mär, dass der Mensch von Natur so eingerichtet sei, dass er sich nur mit Fleisch gesund erhalten kann – noch vor wenigen Jahren häufig in seriösen Publikationen nachzulesen –, ist, abgesehen von kleinen Problemen bei einer dauerhaft veganen Ernährung, reiner Unsinn. Die Ernährungswissenschaft hat inzwischen nichts mehr gegen eine völlig fleischfreie Kost einzuwenden.
Womit das Naturargument an sein verdientes Ende kommt: Tiere essen ist purer Luxus. Nichts als ein paar Sekunden Gaumenkitzel, der einen blutigen Preis hat. Doch selbst die Fleischeslust kann völlig verschwinden. Wer noch nie Fleisch gegessen hat, kennt sie nicht einmal. Sie ist offensichtlich kein dunkler, unbeherrschbarer Naturtrieb, sondern nur eine Gewohnheit unter anderen Gewohnheiten. Eine, die man in der modernen Welt mühelos in wenigen Generationen verlernen könnte.
Читать дальше