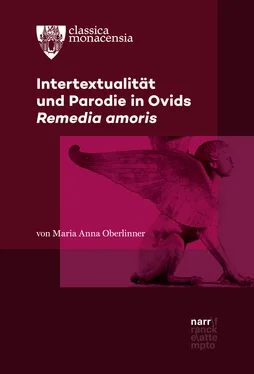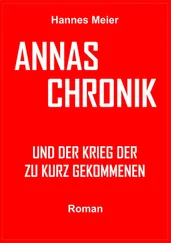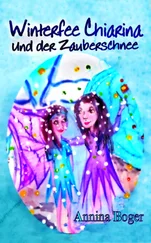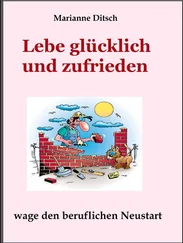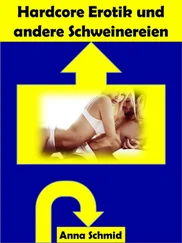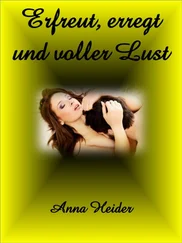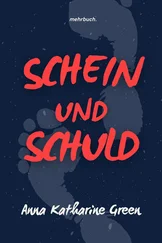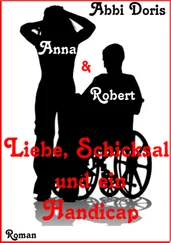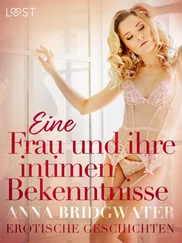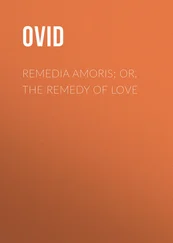Sieht man von den spärlichen theoretischen Zeugnissen ab, kann man jedoch durch konkrete Textarbeit an didaktischen Werken ‚implizite Poetiken‘ herausarbeiten.41 Denn diese weisen, wie Volk zeigt, gemeinsame, für die Gattung Lehrgedicht als konstitutiv zu betrachtende Merkmale auf – „(1) explicit didactic intent; (2) teacher-student constellation; (3) poetic self-consciousness; and (4) poetic simultaneity“.42 Dass sich das didaktische Genre sukzessive aus einem „didactic mode“ heraus entwickelt hat43 und von Hesiod und Empedokles bis hin zu Manilius ein offensichtlich immer konkreteres Gefüge aus didaktischen Bausteinen aufzuweisen beginnt, bestätigt den von Suerbaum beschriebenen Intertextualitätsprozess einer Gattungsgenese im Allgemeinen. Im weiteren Sinne intertextuelle Prozesse spielten demnach auch für das Lehrgedicht als Genre eine wichtige Rolle.
Hier soll Intertextualität aber nicht zur Erklärung der Gattungsgenese eingesetzt werden, sondern zur Untersuchung, welchen Einfluss Gattungssysteme – auch in der Konkretisierung durch bestimmte Textkorpora – und Einzeltexte auf die Remedia amoris haben. Bevor ich meinen Arbeitsbegriff von Intertextualität konturiere, ergänze ich meine Ausführungen noch um die zentralen Ergebnisse der aufschlussreichen Studien von Hinds (1998) und Edmunds (2001), da sie ihre Ausführungen mit lateinischen Textstellen illustrieren und sich kritisch-reflektiert mit intertextuellen Theorien klassischer Philologen (etwa Barchiesis, Contes, Farrells, Thomas’) auseinandersetzen.44
Bei Hinds und Edmunds bilden zwei Themenbereiche einen Schwerpunkt, die Edmunds als die zwei grundlegenden Probleme der Intertextualitätsdiskurse sieht: Diese betreffen sowohl die Frage nach der Autorintentionalität – von Hinds als „fundamentalism“45 bezeichnet – und die Frage nach dem Status des Textes an sich als auch die Rolle, welche der Leser für die Konstitution des Textes spielt.46 Hinds versucht, was ihn mit Pfister vergleichbar macht, einen Mittelweg zu finden, der zwischen dem vielen Lesern intrinsischen Verlangen danach, vom Autor bewusst gesetzte Anspielungen zu entdecken, und einem weiten Begriff der Intertextualität zu verorten ist; letzterer besteht in einer Annäherung an den Bereich der „zero-interpretability“47, der praktisch aber kaum vorhanden sei48 und das Feld für weitere Beobachtungen zu bisher vernachlässigten Anspielungen öffne.49 Aus einer Erweiterung der Bezugstexte ergibt sich aber die Problematik, die darin besteht, dass die Unterscheidung von allusion , quasi ‚Einzeltextreferenzen‘, und Topoi, die eine „intertextual tradition as a collectivity“50 hervorrufen (Hinds bezieht sich auf Contes Gegenüberstellung von modello-esemplare und modello-codice ),51 zwangsläufig verschwimmt.52 Hinds zeigt jedoch, dass ein Topos und eine Anspielung auf einen konkreten Text gleichzeitig möglich sein können53 – eine Beobachtung, die auch für Ovids intertextuelles Vorgehen zutreffend ist. So ruft Ovid bei seinen Hinweisen darauf, dass langes klagendes Sprechen über die Geliebte und mangelndes Schweigen zu vermeiden sei (siehe meine Ausführungen in Kapitel 4.3.2.4), den Topos „that an angry tongue is a proof of love“54 auf. Gleichzeitig spielt er aber in einer Allusion, einer markierten Einzeltextreferenz, auch auf Catull. 83 und 92 an, in denen die Verbindung aus dicere , tacere und mangelnder emotionaler Indifferenz paradigmatisch repräsentiert wird. Letztlich verbindet Hinds eine die Autorsubjektivität (und die Ausrichtung auf einen impliziten Leser) berücksichtigende mit der für ihn zentralen leserorientierten Perspektive, bei der durch den Akt der Rezeption erst die Bedeutung des Textes konstituiert wird.55 Für die Analyse der Remedia ist der auf den Leser ausgerichtete Ansatz beispielsweise insofern wichtig und anwendbar, als Ovid durch die intentional primär-naive Lesart der Lesbia- und Juventius-Zyklen die instabile Haltung der Catull’schen Persona sichtbar macht. In der Art, mit der diese Figur zu einem Negativbeispiel für die Schüler der Remedia wird, verleiht Ovid dem Intertext der Carmina somit neue Bedeutung.
Noch stärker auf den Leser ist Edmunds fixiert, der in ihm die Intertextualität überhaupt erst lokalisiert:56 Intertextuelle Anspielungen würden erst beim Lesen erschaffen, ohne dass sie vorher ‚a priori‘ bestünden oder eine „linguistische oder semiotische Basis“ hätten“57; es gebe also auch keine im Text zu lokalisierenden Marker.58 Auch wenn Edmunds grundsätzliche Autorintentionen, besonders in lateinischer Dichtung, nicht verneint, problematisiert er die Sicht, Anspielungen auf die Dichterfigur zurückzuführen.59 Vielmehr werde Intertextualität durch den Sprecher bzw. die Persona eines Gedichts „aktiviert“, und zwar im Leser selbst.60 Das Problem, das sein leserbasierter Ansatz mit sich bringt – so führe es zu Unsicherheit bei der Bestimmung intertextueller Bezüge –, löst Edmunds dadurch, dass er die Entscheidungshoheit über die „validity of a reading“ bei der zuständigen, kritischen „interpretive community“, bei lateinischer Dichtung den klassischen Philologen, sieht.61 Obwohl ich die Rolle des Lesers z. B. für die genannte Catullrezeption ebenfalls als wichtig erachte, erscheint mir Edmunds’ Position teils zu extrem. Denn die Referenz Ovids manifestiert sich deutlich in lexikalisch markierten Anspielungen, die zugleich einen überprüfbaren Beleg für den intertextuellen Bezug darstellen.
Edmunds’ Definition von Intertextualität besteht darin, dass sich in einem target text (T 1) quotations 62 (Q 1, mit Q 2als Quelle) von Wörtern eines source text (T 2) finden, wodurch der context des quoted text (C 2) einen neuen context (C 1) erhält.63 Es gebe drei Arten, auf die eine quotation (Q 1) den Kontext des ursprünglichen Textes (C 2) hervorrufen könne: Durch die Erweiterung des Kontextes in C 1, durch eine „continuous relation between C 1and C 2“ und durch Parodie, „in which T 1repeats or closely follows a particular T 2“.64 In dieser Hinsicht ist Edmunds für meine Untersuchung wesentlich, da Parodie als intertextuelles Phänomen für Ovids Umgang mit Lukrez, Horaz und Catull in seinen Remedia amoris zentral ist.
Die moderne Intertextualitätstheorie ist jedoch nicht der einzige literaturtheoretische Rahmen für die Textarbeit. Da für die Beschreibung der Beziehung eines Textes zu Prätexten, auch für die Bezugnahme späterer Autoren auf Werke ihrer Vorgänger (etwa in der „Sukzessionsreihe Ennius – Lukrez – Vergil – Ovid – Lukan – Statius“)65 bereits Begriffe wie Imitation, Anspielung, Adaption und aemulatio etabliert sind,66 muss nach dem spezifischen Nutzen der Intertextualitätsforschung, die grundsätzlich mit diesen traditionellen philologischen Analyseinstrumentarien vereinbar ist, gefragt werden.67 Ihr Vorteil besteht nun darin, dass bestimmte Assoziationen mit den aus der antiken Rhetorik und Poetik überlieferten und angewandten68 Termini imitatio und aemulatio keine Gültigkeit haben. Denn sie implizieren in der Rezeption durch moderne Literaturkritik oft eine als vorbildlich geltende Textvorlage und können dazu führen, dass man literarische „Nachahmer“ tendentiell zu „Epigonen“69 herabsetzt, während bei der Intertextualitätsforschung verstärkt die Selbstständigkeit der Textproduktion und ihre neue Interpretation der bestehenden literarischen Tradition akzentuiert und untersucht werden.70 Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass sich aus antiker Sicht Originalität und die formale und stoffliche Nachahmung mit folgender ‚nacheifernder Überbietung‘, die auf eine bewusst eigene Leistung verweist,71 nicht ausschließen.72 Römische Literaturproduktion fußte auch im Selbstverständnis der Zeit auf der „kreative[n] m [ imesis ] ( imitatio ) der Autoren“, bei der „schöpfendes Nacheifern […] bis zum Wettstreit gesteigert wird ( aemulatio ).“73 Die explizit in der Antike reflektierten Begriffe imitatio und aemulatio sind also insofern nicht zu übergehen, als sie fundamentale intertextuelle Phänomene beschreiben.74 Der modernere Begriff der Intertextualität denotiert dabei die Bezugnahme eines Textes auf einen anderen, oder sogar den Dialog, in den ein Text mit einem zweiten treten kann. Imitatio und aemulatio bezeichnen die konkreten Formen dieser Referenzen, etwa die (überbietende) Nachahmung einzelner Worte, Motive, Topoi, Strukturen etc.75 Die Ergänzung und Erweiterung der antiken Termini mit dem neueren literaturkritischen Begriff bringt – neben der grundsätzlichen ‚Offenheit‘ der Intertextualitätsforschung – zusätzlich den Vorteil, dass parodietheoretische Überlegungen in diese Forschungsperspektive eingegliedert werden können. Eine Arbeitsdefinition von Parodie ist meinen Ausführungen deshalb vorangestellt.
Читать дальше