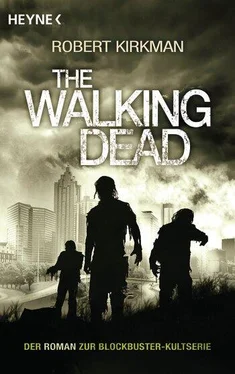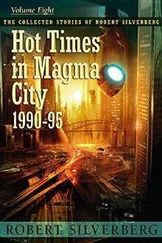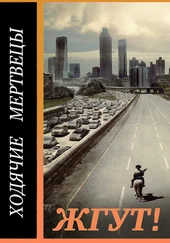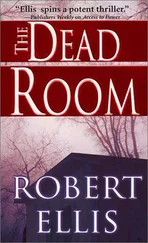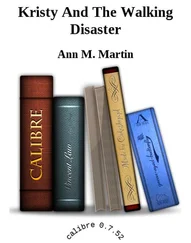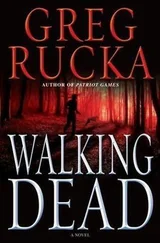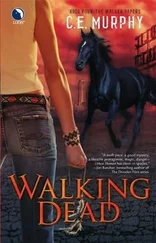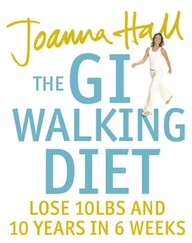Das Penny-Wesen hat das Ohr bereits verschlungen und knurrt schon wieder hungrig. Es will mehr.
Philip füttert es mit einem abgetrennten Fuß, aus dem noch Blut tropft. Ein scharfer Knochen ragt aus der Ferse wie ein schleimiger Elfenbeinzahn.
»Glaubst du, dass …« Brian sucht nach den richtigen Worten. »Glaubst du, dass das vernünftig ist?«
Philip senkt erneut den Blick. Die schmatzenden Geräusche der Zombie-Fütterung füllen die winzige Kammer. Das Mädchen beißt auf dem Knochen herum, und Philip spricht leise und voller Emotionen. »Er war sozusagen ein Organspender …«
»Philip …«
»Ich kann sie nicht loslassen, Brian … Ich schaffe das nicht … Sie ist alles, was ich habe.«
Brian holt tief Luft und kämpft gegen seine eigenen Tränen an. »Die Sache ist die … Das da hat nichts mehr mit unserer Penny zu tun.«
»Das weiß ich.«
»Warum also …«
»Ich sehe sie, und ich versuche, mich zu erinnern … Aber ich kann nicht … Ich kann mich nicht erinnern … Ich kann mich an nichts anderes erinnern als an diesen Albtraum, in dem wir leben … Und an diese Schweine, die sie erschossen haben … Und dabei ist sie doch alles, was ich habe …« Der Schmerz und die Trauer schnüren ihm die Kehle zu und verwandeln sich in etwas Finsteres. »Sie haben sie mir genommen … Das ganze Universum … Jetzt gibt es neue Regeln … Neue Regeln …«
Brian kann kaum mehr atmen. Er beobachtet das Penny-Ding, das noch immer an dem abgetrennten Fuß kaut. Schockiert wendet er sich ab. Es ist zu viel für ihn. Sein Magen schnürt sich zusammen, und er muss würgen. Er spürt, wie ihm heiß wird. Mühsam steht er auf. »Ich muss … Ich kann hier nicht bleiben, Philip … Ich muss weg.«
Brian dreht sich um, stolpert aus dem Zimmer und geht einige Schritte, ehe er auf die Knie sackt und sich übergibt.
Sein Magen ist fast leer, und so würgt er hauptsächlich Gallenflüssigkeit heraus. Sie kommt in quälenden Spasmen. Er würgt und würgt, und seine Magensäure breitet sich auf dem Boden zwischen Flur und dem Wohnzimmer aus. Er würgt, bis er nichts mehr in sich hat. Dann bricht ihm kalter Schweiß aus, ehe ihn ein Hustenanfall verkrampfen lässt. Er kniet minutenlang auf dem Boden und hustet, bis er endlich elend zusammenbricht.
Fünf Meter weiter packt Nick Parsons im Licht der batteriebetriebenen Lampe seinen Rucksack. Er stopft Klamotten, einige Dosen Bohnen in Tomatensauce, Decken, eine Taschenlampe und Wasser hinein. Schließlich sucht er auf dem überhäuften Couchtisch nach etwas Bestimmten, findet es aber nicht.
Brian setzt sich auf. Er wischt sich den Mund mit der Hand ab. »He, Junge. Du kannst jetzt nicht abhauen.«
»Und wie ich das kann«, entgegnet Nick, findet endlich seine Bibel unter einem Berg von Süßigkeiten und steckt sie ebenfalls in den Rucksack. Die gedämpften Geräusche der Zombiefütterung dringen aus der Waschküche zu ihnen und machen Nick sichtbar noch nervöser.
»Nick, ich flehe dich an.«
Nick schließt den Reißverschluss. Er würdigt Brian nicht einmal eines Blicks, als er sagt: »Du brauchst mich hier nicht.«
»Das ist nicht wahr.« Brian schluckt den bitteren Geschmack der Gallenflüssigkeit runter. »Ich brauche dich jetzt mehr denn je … Ich brauche deine Hilfe … Damit nicht alles noch weiter aus den Fugen gerät.«
»Aus den Fugen?« Nick schaut Brian in die Augen, ehe er den Rucksack auf die Schultern nimmt. Dann tritt er zu dem Blake-Bruder, der noch immer auf dem Boden sitzt. »Hier ist schon verdammt lange alles aus den Fugen geraten.«
»Nick, so warte doch …«
»Er ist zu weit gegangen, Brian.«
»Nick, hör mir zu … Ich weiß genau, was du meinst, aber gib ihm noch eine Chance. Das geht vielleicht vorüber. Vielleicht … Ich weiß auch nicht … Vielleicht ist es Trauer. Nur noch eine einzige Chance, Nick. Wir haben eine viel bessere Überlebenschance, wenn wir zusammenhalten.«
Für einen quälend langen Augenblick denkt Nick über das Gesagte nach. Dann seufzt er erschöpft und gleichzeitig verärgert auf und lässt den Rucksack mutlos wieder sinken.
Am nächsten Tag verschwindet Philip. Brian und Nick machen sich nicht einmal die Mühe, nach ihm zu suchen. Sie verbringen fast den ganzen Tag in der Wohnung, wobei sie kaum ein Wort miteinander wechseln und sich selbst beinahe wie Zombies fühlen. Leise schleichen sie durch die Zimmer – vom Badezimmer in die Küche zum Wohnzimmer, wo sie aus dem vergitterten Fenster in den stürmischen Himmel starren und versuchen, eine Antwort auf den Teufelskreis zu finden, in dem sie sich befinden und der immer teuflischer wird.
Gegen siebzehn Uhr dringt ein seltsames Summen an ihre Ohren. Es kommt von draußen – wie der Lärm einer Kettensäge oder eines großen Rasenmähers. Um Philip besorgt, geht Brian zur Hintertür, lauscht einen Moment lang und öffnet sie dann. Er tritt in den Hinterhof.
Der Lärm hat zugenommen. In der Ferne, am nördlichen Rand des Städtchens, zeigt sich sich eine Gewitterwolke am stahlgrauen Himmel. Das Heulen von Motoren wird vom Wind zu ihnen herübergetragen, und mit einiger Erleichterung stellt Brian fest, dass es sich wahrscheinlich um ein Rennen auf der stadteigenen Rennstrecke handelt. Ab und zu hört er Jubeln und Klatschen.
Plötzlich wird Brian flau im Magen. Wissen diese Idioten denn nicht, dass der Lärm jeden Beißer im Umkreis von fünfzig oder gar hundert Kilometern anlocken wird? Er lauscht dem Gesäge, das der Wind ebenfalls bis an seine Ohren trägt. Wie ein Radiosender, der einmal deutlicher, einmal weniger deutlich zu empfangen ist, dringt es in Brians Bewusstsein und berührt eine Wunde tief in seinem Inneren. Er sehnt sich nach den Zeiten vor der Plage. Schmerzvolle Erinnerungen fauler Sonntagnachmittage und durchschlafener Nächte drängen sich ihm auf – als er noch unbehelligt in einen Laden gehen konnte, um nichts weiter als harmlose Milch zu kaufen.
Brian geht wieder hinein, zieht eine Jacke an und verkündet Nick, dass er einen Spaziergang machen will.
Der Zugang zur Rennstrecke liegt an der Hauptstraße. Zwischen zwei Ziegelhaufen ist ein hoher Maschendrahtzaun gespannt. Als Brian näher kommt, sieht er Müll und alte Autoreifen um die Kasse verstreut. Der Bretterverschlag des dürftigen Gebäudes ist mit Graffiti verschmiert.
Der Lärm ist jetzt ohrenbetäubend. Das Heulen der Motoren und die jubelnde Menge von Zuschauern wird von dem beißenden Gestank von Benzin und verbranntem Gummi begleitet. Staubwolken und Rauch hängen in der Luft.
Brian findet ein Loch im Zaun und will gerade hindurchschlüpfen, als er eine Stimme hört.
»He!«
Er hält inne, dreht sich um und sieht drei Männer in heruntergekommener Militärkluft auf sich zukommen. Zwei von ihnen sind Mitte zwanzig mit fettigen langen Haaren und Sturmgewehren über den Schultern, als ob sie auf Patrouille wären. Der älteste der Bande – ein harter Hund mit Bürstenschnitt und einer olivgrünen Jacke mit einem Patronengurt über der Brust – geht voran. Er hat offensichtlich das Sagen.
»Der Eintritt kostet vierzig Dollar oder das Gleiche in Handelsware.«
»Eintritt?«, wiederholt Brian überrascht. Dann sieht er den Aufnäher auf der Brust der olivgrünen Jacke: Maj. Gavin. Bisher hat Brian die brutalen Mitglieder der Nationalgarde immer nur flüchtig aus der Ferne gesehen. Jetzt kann Brian dem Mann jedoch genau in die eisigen blauen Augen schauen. Er hat eine Alkoholfahne: Whiskey. Genauer gesagt: Jim Beam – vermutete Brian zumindest.
»Vierzig Dollar pro Erwachsener, Kleiner. Bist du schon erwachsen?« Die anderen lachen. »Kinder kommen umsonst rein. Aber du siehst mir so aus, als ob du schon über achtzehn wärst – gerade so.«
»Ihr verlangt Geld von den Leuten?« Brian versteht die Welt nicht mehr. »Jetzt? In diesen Zeiten?«
Читать дальше