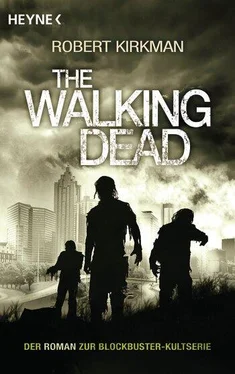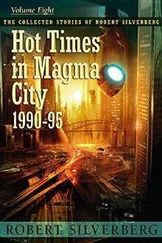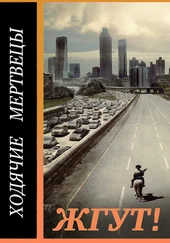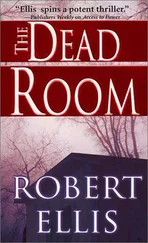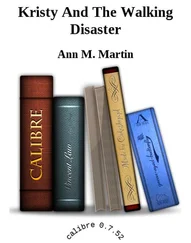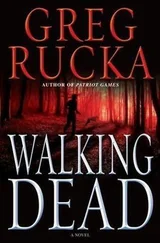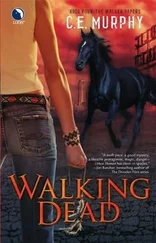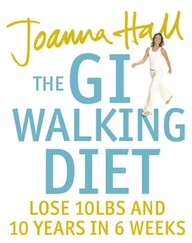Philip geht mit der ruhigen Sorgfalt eines Betreuers vor, der ein behindertes Kind in einen Rollstuhl setzt. Mit dem Stück Kupferrohr hält er das Monster weit genug von sich entfernt, um das Geschirr festmachen zu können. Die ganze Zeit über knurrt, geifert und reißt das Geschöpf, das einmal Penny war, an seinen Fesseln.
Brian starrt auf das Schauspiel, das sich vor seinen Augen abspielt. Er weiß nicht, ob er sich abwenden, zu heulen anfangen oder aufschreien soll. Für einen winzigen Augenblick scheint er in eine andere Zeit zurückversetzt zu sein. Er ist wieder achtzehn und besucht seine sterbende Großmutter ein letztes Mal im Altersheim von Waynesboro. Ein letzter Abschied. Er wird den Ausdruck auf dem Gesicht des Betreuers nie vergessen. Er musste die alte Dame beinahe stündlich saubermachen, und die Miene, die er dabei an den Tag legte, wenn er dies in Anwesenheit ihrer Verwandten tat, war erschreckend – eine Mischung aus Ekel, stoischer Professionalität, Mitleid und Verachtung.
Jetzt zeigt Philip Blake den gleichen Gesichtsausdruck, während er mehrere Riemen um den Kopf des kleinen Monsters schnallt und mit größter Vorsicht ihre zuschnappenden Beißerchen vermeidet. Er singt ihr leise etwas vor, während sie sich gegen ihre Fesseln wehrt – ein Wiegenlied, das Brian nicht kennt.
Irgendwann ist Philip offenbar zufrieden. Zärtlich streicht er dem Penny-Zombie über den Kopf, ehe er ihn auf die Stirn küsst. Das untote Mädchen schnappt nach ihm und verfehlt seine Halsschlagader nur um wenige Zentimeter.
»Ich lasse das Licht an, Schatz«, verspricht ihr Philip mit lauter Stimme, als ob er mit jemandem sprechen würde, der nur schlecht Englisch versteht. Dann dreht er sich um, verlässt die Waschküche und schließt die Tür sorgfältig hinter sich zu.
Brian steht im Flur. Ihm gefriert beinahe das Blut in den Adern. »Möchtest du reden?«
»Ach, das wird schon«, sagt Philip und vermeidet es, seinem Bruder in die Augen zu sehen. Dann geht er in sein Zimmer.
Das Schlimmste ist, dass die Waschküche direkt neben Brians Zimmer liegt. Seit jener Nacht hört er das Penny-Wesen ständig, wie es kratzt, stöhnt und an den Fesseln zerrt. Es ist eine stete Erinnerung an … Ja, woran? An Armageddon, an den Weltuntergang? An den Wahnsinn, der ausgebrochen ist? Brian findet nicht die Worte dafür, was das Geschöpf verkörpert. Der Gestank ist tausendmal schlimmer als Katzenpisse. Philip verbringt viel Zeit mit dem lebenden Leichnam in der Waschküche. Wer weiß, was er mit ihm macht. Jedenfalls führt das Ganze dazu, dass die drei Männer sich mehr und mehr entfremden. Obwohl sich Brian noch immer zwischen Trauer, Kummer und Schock hin- und hergerissen fühlt, verspürt er sowohl doch auch Mitleid und Ekel. Natürlich liebt er seinen Bruder, aber dennoch wird es allmählich unerträglich. Nick sagt nichts mehr, aber Brian weiß, dass er aufgegeben hat. Das Schweigen zwischen den Männern wird immer länger, und Brian und Nick verbringen mehr und mehr Zeit außerhalb der Wohnung, sondieren die Umgebung und lernen so die kleine Stadt und ihre Bewohner nach und nach besser kennen.
Brian hält sich zwar bedeckt, wenn er umherstreift, aber er bringt bald in Erfahrung, dass die Bewohner in zwei Schichten aufgeteilt werden können. Zur ersten – den Mächtigen – gehören diejenigen, die einen nützlichen Beruf haben: zwei Maurer, ein Maschinist, ein Arzt, der Besitzer eines Waffenladens, ein Tierarzt, ein Installateur, ein Friseur, ein Automechaniker, ein Farmer, ein Koch und ein Elektriker. Die zweite Gruppe – Brian nennt sie für sich »die Abhängigen« – umfasst die Kranken, die Jungen und die früheren Büroangestellten, unter anderem auch Leute aus dem mittleren Management und Corporate Executives, die zuvor über ein sechsstelliges Einkommen verfügten und die Abteilungen multinationaler Firmen unter sich hatten. Jetzt jedoch sind sie nutzlos geworden und so sinnlos wie alte Musikkassetten. Brian muss immer wieder an seine Soziologiekurse an der Uni denken, während er sich fragt, ob sich diese lose Gemeinschaft verzweifelter Seelen jemals zu etwas entwickeln wird, das einer funktionierenden Gesellschaft ähneln könnte.
Drei Mitglieder der Nationalgarde, die zwei Wochen zuvor zu ihnen stießen, scheinen der Sand im Getriebe zu sein, denn sie kommandieren jeden herum, der ihnen über den Weg läuft. Diese kleine Clique – Brian bezeichnet sie als Tyrannen – wird von einem ehemaligen Marinesoldaten mit Bürstenschnitt und kalten blauen Augen angeführt, der auf den Namen Gavin hört – oder Major, wie ihn seine Schergen betiteln. Es dauert keine zwei Tage, und Brian ist klar, dass er ein Psychopath ist, der nichts anderes als Macht und Beuterecht im Kopf hat. Vielleicht war es die Plage, die Gavin so weit gebracht hat, aber Brian beobachtete in seiner erster Woche in Woodbury Gavin und dessen Truppe dabei, wie sie hilflosen Familien Lebensmittel abnahmen und einige Frauen nachts in der Nähe der Rennbahn mit gezückter Pistole vergewaltigten.
Brian hält Distanz und macht sich unsichtbar. Während er jedoch im Stillen Woodburys Machtstrukturen studiert, trifft er immer wieder auf einen Namen: Stevens.
Von seinen wenigen Unterhaltungen mit den Bewohnern und dem, was er mitbekommt, schlussfolgert Brian, dass sich Stevens nach Ausbruch der Plage zu neuen, besseren Ufern aufmachte – offenbar nach einer Scheidung, wie gemunkelt wird. Er ist ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der seine eigene Praxis in Atlanta hatte. Der Mann traf relativ frühzeitig auf die zusammengewürfelte Gruppe Überlebender in Woodbury und entschied sich angesichts der vielen Kranken, Unterernährten und Verwundeten dazu, hier seine Dienste anzubieten. Im Meriwether County Medical Center, drei Häuserblocks von der Pferderennbahn entfernt, machte er eine Art Praxis auf.
Am Nachmittag des siebten Tags in Woodbury kommt es Brian bei jedem Atemzug so vor, als ob ihm ein Messer in die Brust gestochen würde. Er nimmt also seinen Mut zusammen und sucht das niedrige graue Gebäude am südlichen Ende der Sicherheitszone auf.
»Sie haben Glück«, sagt Stevens und hängt ein Röntgenbild vor die beleuchtete Plexiglasscheibe. Er zeigt auf das verschwommene Abbild von Brians Rippen. »Keine schlimmen Brüche … Lediglich drei Mikrorisse an der zweiten, vierten und fünften Rippe.«
»Glück gehabt?«, murmelt Brian, der mit freiem Oberkörper auf der gepolsterten Bank sitzt. Sie befinden sich in einem bedrückend wirkenden, gefliesten Kellerraum im Meriwether County Medical Center – das ehemalige Pathologie-Institut –, das Stevens jetzt als Behandlungszimmer dient. Es stinkt nach Desinfektionsmittel und Schimmel.
»Nicht unbedingt ein Wort, das ich in letzter Zeit oft benutzt habe, das muss ich zugeben«, meint Stevens und geht zu einem Schränkchen aus Edelstahl, das neben der Plexiglasscheibe hängt. Er ist ein groß gewachsener, adrett aussehender Mann Ende vierzig und hat eine randlose Designerbrille, die auf seiner Nasenspitze sitzt. Seinen Arztkittel trägt er über einem weißen Hemd, und seine Augen wirken erschöpft, aber intelligent.
»Und das Keuchen?«, will Brian wissen.
Der Arzt durchforstet ein Fach mit Plastikampullen. »Das Anfangsstadium einer Rippenfellentzündung, die durch die angeknacksten Rippen hervorgerufen wurde«, murmelt er und sucht nach der richtigen Arznei. »Sie müssen so viel wie möglich husten … Es wird zwar wehtun, verhindert aber, dass sich septischer Katarrh in Ihrer Lunge sammelt.«
»Und was ist mit meinem Auge?« Der stechende Schmerz in Brians linkem Auge, der von seinem geprellten Kiefer ausgeht, ist während der letzten Tage schlimmer geworden. Jedes Mal, wenn er in den Spiegel blickt, scheint das Auge noch blutunterlaufener zu sein.
»Das sieht gut aus«, erwidert Stevens und holt ein Fläschchen Pillen aus dem Schrank hervor. »Ihr Unterkiefer weist eine nicht unerhebliche Prellung auf, aber das vergeht mit der Zeit von selbst. Ich werde Ihnen etwas gegen die Schmerzen geben.«
Читать дальше