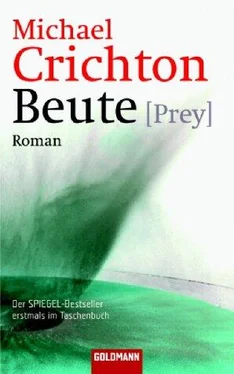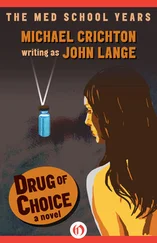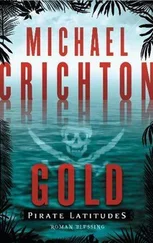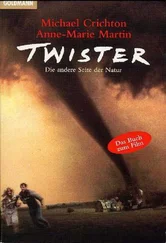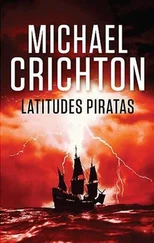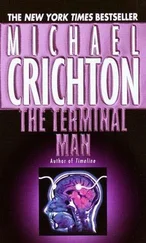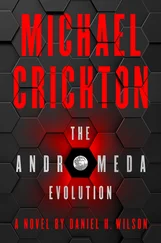Michael Crichton - Beute (Prey)
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Crichton - Beute (Prey)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Фантастика и фэнтези, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Beute (Prey)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Beute (Prey): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Beute (Prey)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Beute (Prey) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Beute (Prey)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
»Warum ist es so hell?«
»Das Glas hat eine Diamantbeschichtung«, sagte er. »Auf der molekularen Ebene ist Glas wie Schweizer Käse, voller Löcher. Und natürlich ist es flüssig, die Atome gehen einfach durch.«
»Also beschichtet ihr das Glas.«
»Genau. Geht nicht anders.«
In diesem strahlenden Wald aus Glaszweigen bewegten sich David und Rosie, machten Notizen, stellten Ventile ein, schauten auf ihre Handhelds. Ich begriff, dass ich ein höchst parallel arbeitendes Fließband vor Augen hatte. Kleine Molekülfragmente wurden in die kleinsten Rohre eingeführt und Atome hinzugefügt. Wenn das erledigt war, ging es weiter in die nächstgrößeren Rohre, wo noch mehr Atome beigegeben wurden. Auf diese Weise bewegten sich Moleküle nach und nach zum Zentrum des Gebildes, bis die Montage fertig war, und das Endprodukt wurde in das Rohr in der Mitte ausgestoßen.
»Ganz genau«, sagte Ricky. »Es funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie ein Fließband in der Automobilherstellung, nur eben in molekularer Größenordnung. Die Moleküle fangen an den Seiten an und werden mit dem Band zur Mitte befördert. Wir fügen hier eine Proteinsequenz, da eine Methylgruppe hinzu, genau wie Türen und Räder an ein Auto montiert werden. Am Ende rollt eine neue, maßgefertigte Molekülstruktur vom Band. Genau wie wir sie haben wollen.«
»Und die verschiedenen Arme?«
»Bauen verschiedene Moleküle. Deshalb sehen sie auch unterschiedlich aus.« An mehreren Stellen reichten die Krakenarme durch einen Stahltunnel, der mit dicken Bolzen verstärkt war, zur Ableitung des Unterdrucks. An anderen Stellen war ein Würfel mit mehrschichtigem Silbermaterial isoliert, und in der Nähe sah ich Tanks mit Flüssignitrogen; in dem Abschnitt wurden extrem niedrige Temperaturen erzeugt.
»Das sind unsere Kryogenikräume«, sagte Ricky. »Wir gehen nicht sehr niedrig, bis höchstens minus siebzig Grad etwa. Komm, ich zeig's dir.« Er führte mich durch den Komplex, über gläserne Laufstege, die sich zwischen diesen Ästen hindurchwanden. An manchen Stellen führten kurze Treppen über die untersten Äste.
Ricky plapperte ununterbrochen über technische Details: vakuumumhüllte Schläuche, Metallphasentrenner, KugelRückschlagventile. Als wir den isolierten Würfel erreichten, öffnete er die dicke Tür, und zum Vorschein kam ein kleiner Raum, an den ein zweiter Raum grenzte. Sie sahen aus wie zwei Kühlräume für Fleisch. Jede Tür hatte ein kleines Glasfenster. Im Augenblick herrschte Raumtemperatur. »Man kann hier gleichzeitig zwei verschiedene Temperaturen erzeugen. Einen Raum vom anderen aus steuern, wenn man will, aber normalerweise läuft alles automatisch.«
Ricky führte mich wieder nach draußen und blickte dabei auf die Uhr. Ich sagte: »Haben wir noch einen Termin?«
»Was? Nein, nein. Nichts dergleichen.« Ganz in der Nähe waren zwei Würfel, bei denen es sich eigentlich um wuchtige Metallräume handelte, in die dicke Elektrokabel liefen. Ich sagte: »Sind das eure Magneträume?«
»Richtig«, sagte Ricky. »Wir haben Pulsfeldmagnete, die im Kern sechzig Tesla erzeugen. Das ist etwa eine Million Mal so viel wie das Magnetfeld der Erde.«
Mit einem Ächzen drückte er die Stahltür des ersten Magnetraumes auf. Ich sah ein großes donutförmiges Objekt von gut einem Meter achtzig Durchmesser, mit einem zweieinhalb Zentimeter breiten Loch in der Mitte. Dieser »Donut« war völlig mit Rohrleitungen und einer Kunststoffisolierung umhüllt. Die Ummantelung war von oben bis unten mit dicken Stahlschrauben befestigt.
»Unser Schätzchen hier braucht jede Menge Kühlung, das kann ich dir sagen. Und jede Menge Strom: fünfzehn Kilovolt.
Die Ladezeit der Kondensatoren beträgt eine volle Minute. Und natürlich können wir ihn nur takten. Wenn wir ihn auf Dauer anmachen würden, würde er explodieren - von dem Feld in Stücke gerissen, das er erzeugt.« Er deutete auf den unteren Teil des Magneten, wo in Kniehöhe ein runder Druckknopf war. »Das ist die Notabschaltung«, sagte er. »Für alle Fälle. Mit dem Knie draufdrücken, wenn du die Hände voll hast.«
Ich sagte: »Ihr verwendet also hohe Magnetfelder für einen Teil eurer Fertig«
Aber Ricky hatte sich bereits abgewandt und strebte zur Tür hinaus, schaute wieder auf seine Uhr. Ich eilte hinterher.
»Ricky ...«
»Ich muss dir noch was zeigen«, sagte er. »Wir haben es gleich geschafft.«
»Ricky, das ist alles sehr eindrucksvoll«, sagte ich und deutete mit einer Handbewegung auf die leuchtenden Arme. »Aber eure Montage läuft überwiegend bei Raumtemperatur - kein Unterdruck, keine Tiefsttemperaturen, kein Magnetfeld.«
»Richtig. Keine besonderen Bedingungen.«
»Wie ist das möglich?«
Er zuckte die Achseln. »Die Assembler brauchen das nicht.«
»Die Assembler?«, fragte ich. »Willst du damit sagen, ihr habt molekulare Assembler an diesem Fließband?«
»Ja. Natürlich.«
»Assembler machen die Montage für euch?«
»Natürlich. Ich dachte, das wäre dir klar.«
»Nein, Ricky«, sagte ich, »das war mir ganz und gar nicht klar. Und ich lasse mich nicht gern anlügen.«
Er setzte eine gekränkte Miene auf. »Ich lüge nicht.«
Aber ich war mir ganz sicher, dass er log.
Als Wissenschaftler anfingen, sich mit molekularer Herstellung zu beschäftigen, erkannten sie schon zu Anfang, wie unglaub-lich schwer die Verwirklichung sein würde. Im Jahre 1990 schoben IBM-Forscher Xenonatome auf einem Nickelkristall hin und her, bis sie die Buchstaben »IBM« in Form des Firmenlogos ergaben. Das ganze Logo war ein Milliardstel von einem Millimeter lang und nur durch ein Elektronenmikroskop zu sehen. Es machte optisch einiges her und erhielt großes Medieninteresse. IBM erweckte die Vorstellung, es wäre der Beweis für eine Idee, als wäre damit die Tür zur molekularen Fertigung aufgestoßen worden. Aber es war im Grunde nicht mehr als ein hübsches Bravourstück.
Einzelne Atome in eine bestimmte Anordnung zu bringen war nämlich eine langsame, mühselige und teure Angelegenheit. Die IBM-Forscher benötigten einen ganzen Tag, um fünfunddreißig Atome zu bewegen. Kein Mensch glaubte, dass man auf diesem Wege eine völlig neue Technologie schaffen konnte. Stattdessen gingen die meisten davon aus, dass es den Nanotechnologen irgendwann gelingen würde, »Assembler« zu bauen - winzige molekulare Maschinen, die bestimmte Moleküle produzierten, so wie Kugellagermaschinen Kugellager. Die neue Technologie würde molekulare Maschinen benötigen, um molekulare Produkte herzustellen.
Es war eine ansprechende Idee, die praktischen Probleme waren jedoch entmutigend. Da Assembler um ein Vielfaches komplizierter waren als die Moleküle, die sie fertigten, gestaltete es sich von Anfang an sehr schwierig, sie zu entwickeln und zu bauen. Meines Wissens war es noch keinem Labor irgendwo auf der Welt tatsächlich gelungen. Aber jetzt erzählte Ricky mir, so ganz nebenbei, dass Xymos molekulare Assembler bauen konnte, die jetzt Moleküle für die Firma herstellten.
Und ich glaubte ihm nicht.
Ich arbeitete seit einer Ewigkeit in der Technologiebranche, und ich hatte ein Gespür dafür entwickelt, was möglich war. Einen solch gigantischen Sprung nach vorn gab es einfach nicht. Hatte es noch nie gegeben. Technologien waren eine Form von Wissen, und sie wuchsen, evolvierten, reiften heran, wie jedes Wissen. Wer das anders sah, konnte genauso gut glauben, dass die Brüder Wright in der Lage gewesen wären, eine Rakete zu bauen und zum Mond zu fliegen statt nur die hundert Meter über die Sanddünen von Kitty Hawk.
Die Nanotechnologie befand sich noch immer im Kitty-Hawk-Stadium.
»Komm schon, Ricky«, sagte ich. »Wie macht ihr das wirklich?«
»Die technischen Einzelheiten sind nicht so wichtig, Jack.«
»Was redest du für einen Stuss? Natürlich sind sie wichtig.«
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Beute (Prey)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Beute (Prey)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Beute (Prey)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.