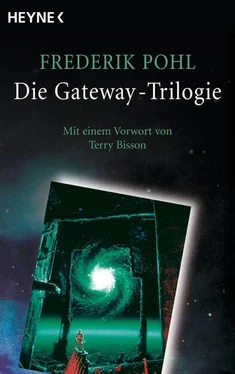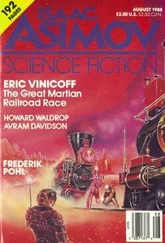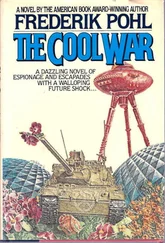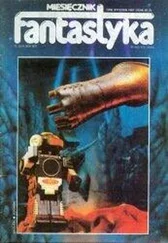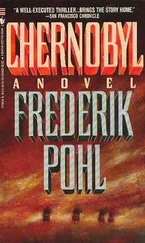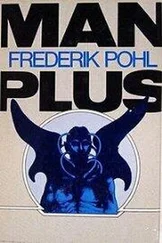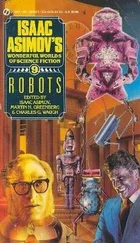Es war also ein ungefährlicher Kitzel. Oder schien einer zu sein.
Bis sie bei den Docks auf der anderen Seite in der Falle saß, während irgendetwas – Hitschi? Raummonster? Ein irrer, alter Schiffbrüchiger mit einem Messer in der Hand? – aus den verborgenen Gängen ihr entgegenkam.
Und dann war es nichts von alledem; es war Wan.
Natürlich wusste sie seinen Namen nicht. »Komm du ja nicht näher!«, wimmerte sie, während ihr das Herz bis zum Hals hinauf schlug, das Funkgerät in der Hand, die Arme vor ihren jungen Brüsten gekreuzt. Er tat es auch nicht. Er blieb stehen. Er glotzte sie mit herausquellenden Augen an, den Mund geöffnet, während ihm beinahe die Zunge heraushing. Er war hoch gewachsen und mager. Sein Gesicht lief spitz zu, die Nase war lang und hakenförmig. Er trug ein Kleidungsstück, das einem Rock ähnlich war, darüber eine Art Trainingsbluse, beides sehr schmutzig. Er roch nach Mann. Er zitterte, während er schnupperte, und er war jung . Auf keinen Fall war er viel älter als Janine selbst und damit die einzige Person, die sie seit Jahren gesehen hatte, die nicht dreimal so alt war wie sie. Und als er auf die Knie sank und zu tun begann, was Janine eine andere Person noch nie hatte tun sehen, stöhnte sie auf, während sie kicherte – Belustigung, Erleichterung, Schreck, Hysterie. Der Schreck betraf nicht das, was er tat. Der Schreck rührte daher, dass sie einem Jungen begegnet war . Im Schlaf hatte Janine wilde Dinge geträumt, aber niemals so etwas .
In den folgenden Tagen konnte Janine Wan nicht aus den Augen lassen. Sie war seine Mutter, seine Gespielin, seine Lehrerin, seine Ehefrau. »Nein, Wan! Langsam schlürfen, das ist heiß!« – »Wan, soll das heißen, dass du ganz allein gewesen bist, seit du drei warst?« – »Du hast wirklich wunderschöne Augen, Wan.« Es machte ihr nichts aus, dass er nicht erfahren genug war, um darauf zu erwidern, sie hätte ebenfalls wunderschöne Augen, weil sie klar erkannte, dass sie ihn mit allem, was an ihr war, faszinierte.
Die anderen merkten das natürlich auch. Janine ließ sich dadurch nicht beirren. Wan brachte an sinnesscharfer, strahlender, besessener Bewunderung genug auf für alle. Er schlief sogar noch weniger als sie. Am Anfang mochte sie das, weil es bedeutete, dass sie mehr von Wan hatte, aber dann konnte sie erkennen, dass er immer erschöpfter wurde. Sogar krank. Als er in dem Raum mit dem schillernden, silberblauen Kokon zu schwitzen und zu zittern begann, war sie diejenige, welche aufschrie: »Lurvy! Ich glaube, er wird krank!«
Als er zur Liege wankte, stürzte sie zu ihm, die Finger ausgestreckt, um seine trockene und glühende Stirn zu berühren. Die zuklappende Hülle des Kokons klemmte beinahe ihren Arm ein und riss eine tiefe Wunde vom Handgelenk bis zu den Fingerknöcheln. »Paul«, schrie sie, »wir müssen …«
Und dann überfiel sie alle der 130-Tage-Wahnsinn. Schlimmer als je zuvor. Anders als je zuvor. Von einem Augenblick auf den nächsten wurde Janine krank .
Janine war niemals krank gewesen. Ab und zu einen blauen Fleck, einen Krampf, ein Schnupfen. Mehr nicht. Fast ihr ganzes Leben hatte sie unter medizinischem Vollschutz gestanden, und Krankheiten hatte es einfach nicht gegeben. Sie konnte nicht begreifen, was mit ihr geschah. Ihr Körper wand sich in Fieber und Agonie. Sie halluzinierte monströse, fremdartige Gestalten, in denen sie zum Teil Zerrbilder ihrer Angehörigen erkannte; andere waren einfach Furcht erregend und fremd. Sie sah sich sogar selbst – mit riesigen Brüsten und enormen Hüften, aber sie selbst –, und in ihrem Bauch grollte ein Toben, hineinzustoßen in alle die sichtbaren und unsichtbaren Höhlungen dieses Wachtraums, hineinzustoßen in etwas, das sie selbst im Wachtraum nicht besaß. Nichts von alledem war begreiflich. Nichts war klar. Qualen und Irrsinnigkeiten kamen in Wellen. Dazwischen erhaschte sie ab und zu sekundenlang Blicke auf die Wirklichkeit. Das blaustählerne Leuchten der Wände. Lurvy, neben ihr wimmernd zusammengekrümmt. Ihr Vater, der sich im Korridor erbrach. Der Kokon in Chrom und Blau, wo unter dem Netz Wan sich krümmte und lallte. Es war weder Überlegung noch Wille, was sie trieb, an der Hülle zu zerren und sie beim hundertsten oder tausendsten Mal aufzureißen, aber es gelang ihr endlich, und sie zerrte ihn als wimmerndes und zitterndes Bündel heraus.
Die Halluzinationen hörten schlagartig auf.
Nicht ganz so rasch die Qual, die Übelkeit und das Entsetzen. Aber sie hörten auch auf. Alle schauderten und wankten noch, alle, bis auf den Jungen, der bewusstlos war und auf eine Weise atmete, die Janine entsetzte: heiser, stoßweise, keuchend.
»Hilfe, Lurvy!«, kreischte sie. »Er stirbt!«
Ihre Schwester war schon bei ihr, legte den Daumen auf den Puls des Jungen, während sie den Kopf schüttelte und mit verdrehtem Blick auf seine Augen starrte.
»Dehydriert! Fieber! Los!«, rief sie, während sie Wans Arme packte. »Hilf mir, ihn ins Schiff zurückzutragen! Er braucht eine Salzlösung, Antibiotika, Fiebermittel, vielleicht Gammaglobulin!«
Sie brauchten fast zwanzig Minuten, um Wan ins Schiff zu schleppen, und Janine fürchtete bei jedem holpernden Zeitlupenschritt, er könnte sterben. Lurvy rannte die letzten hundert Meter voraus, und bis Paul und Janine ihn durch die Luftschleuse gezogen hatten, war die Medibox schon offen, und Lurvy schrie Befehle.
»Hinlegen! Das muss er schlucken! Nehmt eine Blutprobe und untersucht sie auf Virus- und Antikörper-Titer! Schickt eine Blitzanfrage zur Erde, sagt, dass wir ärztliche Anweisungen brauchen – falls er lange genug am Leben bleibt!«
Paul half ihnen, Wan auszuziehen und in eine von Peters Decken zu wickeln. Dann schickte er die Nachricht ab. Aber er wusste – und alle wussten –, dass das Problem, ob Wan am Leben blieb oder starb, nicht von der Erde aus gelöst werden würde. Nicht bei einer Gesamtzeit von sieben Wochen bis zum Erhalt einer Antwort. Peter saß fluchend da, verfluchte das mobile Bioprüfgerät. Lurvy und Janine beschäftigten sich mit dem Jungen. Paul zwängte sich, ohne zu jemandem ein Wort zu sagen, in seinen Raumanzug und ging hinaus in den Weltraum, wo er eineinhalb anstrengende Stunden damit verbrachte, die Funkantennen zu justieren – die Hauptantenne ausgerichtet auf den hellen Doppelstern des Planeten Neptun und seines Mondes, die andere auf den Punkt im Raum, an dem sich die Garfeld-Mission befand. Dann befahl er, am Rumpf klebend, Vera über Funk, den Hilferuf mit höchster Leistungskraft über beide Antennen ein zweites Mal zu senden. Vielleicht wurde er aufgefangen, vielleicht auch nicht. Als Vera mitteilte, dass die Funksprüche abgesetzt seien, stellte er die große Schüssel wieder auf die Erde ein. Das Ganze nahm volle drei Stunden in Anspruch, und ob von den Empfängern jemand reagieren würde, war zweifelhaft. Es war ebenso unsicher, ob Hilfe angeboten werden konnte. Das Schiff der Garfelds war kleiner und weniger gut ausgerüstet als das ihre, und die Leute im Stützpunkt auf Triton hielten sich dort immer nur kurze Zeit auf. Aber wenn der Ruf aufgefangen werden sollte, durften sie damit rechnen, dass eine Antwort, die hilfreichen Rat geben konnte oder wenigstens Mitgefühl ausdrückte, viel rascher eintreffen würde als eine von der Erde.
Nach einer Stunde ging Wans Fieber zurück. Nach zwölf Stunden hörten Zuckungen und Lallen auf, und er schlief normal. Aber er war noch immer sehr krank.
Mutter und Gespielin, Lehrerin und Ehefrau wenigstens in der Phantasie, wurde Janine nun auch Wans Pflegerin. Nach der ersten Versorgung mit Medikamenten ließ sie nicht einmal mehr zu, dass Lurvy ihm die weiteren Spritzen gab. Sie verzichtete auf Schlaf, um ihm mit dem Schwamm die Stirn abzuwischen. Sie säuberte ihn gründlich, als er sich im Koma besudelte. Sie hatte für nichts anderes mehr Sinn. Die belustigten oder besorgten Blicke und Worte ihrer Familie ließen sie unberührt, bis Paul eine herablassende Bemerkung machte. Janine hörte die Eifersucht heraus und brauste auf: »Paul, du bist widerlich! Wan braucht mich und meine Pflege!«
Читать дальше