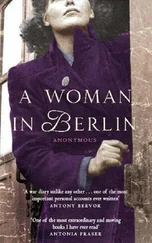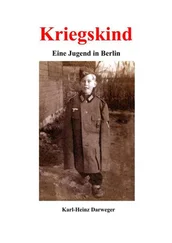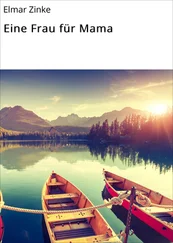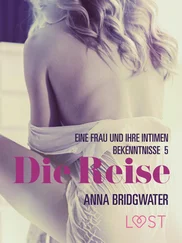Hab mit Gisela über unsere Verlagspläne gesprochen. Sobald eine von unseren Planungen Gestalt annimmt, könnte Gisela dabei mittun. Sie blickte skeptisch drein. Sie kann sich nicht vorstellen, daß wir in unserem Lande nach unserem Sinn Druckschriften gestalten dürfen. Sie meinte, nur Blätter im Moskauer Sinn würden erlaubt sein, der nicht der ihre ist. Noch hat sie zuviel Scham, um vor mir das Wort »Gott« in den Mund zu nehmen; doch alles, was sie sagte, zielte dahin. Ich bin überzeugt, daß sie betet und Kraft daraus gewinnt. Zu essen hat sie nicht mehr als ich. Ihre Augen sind tief umschattet. Aber diese Augen leuchten, während meine nur blank sind. Man kann einander jetzt nicht helfen. Doch das bloße Vorhandensein anderer Hungernder um mich herum hält mich aufrecht.
Wieder ein Tag für mich. Ich war auf der Polizei und versuchte, irgendeine amtliche Erlaubnis zur Ausbeutung des verlassenen Gartens zu erhalten, der hinter dem ausgebrannten Haus von Professor K. liegt, einem guten Bekannten aus vergangener Zeit. Ich legte einen Brief des alten Herrn vor, den dieser mir noch im März aus seinem märkischen Zufluchtsort geschickt hat und worin er mich bat, nach seinem Garten zu schauen. Man schickte mich von Pontius zu Pilatus. Niemand war zuständig. Überall Mief und kleines Gezänk in den mit Pappe verschalten dunklen Bürobuden. Nichts hat sich geändert.
Unterwegs zupfte ich mein Brennesselquantum. Ich war sehr matt, das Fett fehlt. Immer wogende Schleier vor den Augen und ein Gefühl des Schwebens und Leichterwerdens. Schon dies Aufschreiben jetzt ist eine Anstrengung, ist mir aber ein Trost in meiner Einsamkeit, eine Art Gespräch, ein Herzaus-schütten. Die Witwe hat mir von wilden Russenträumen erzählt, die sie jetzt noch träumt. Bei mir nichts dergleichen, wohl, weil ich alles aufs Papier gespien habe.
Schlimm steht es um die Kartoffeln. Man hat uns die Rationen bereits bis Ende Juli ausgehändigt, zwangsweise, wir mußten sie abholen. Warum, das riecht jeder: Die Knollen, jetzt erst aus den Mieten gebuddelt, gären und bestehen zur Hälfte aus stinkendem Matsch. Der Geruch in der Küche ist kaum auszuhalten; doch auf dem Balkon, so fürchte ich, faulen sie noch schneller. Wovon sollen wir im Juli leben? Dazu macht mir der Gasherd Kummer. Reicht der Gasdruck mal aus, so knallt es im Rohr wie von Schüssen. Und die elektrische Kochplatte, zusammengeflickt wie sie ist, will nicht mehr.
Das Brot muß ich vor mir selber bewachen. Bin schon um 100 Gramm auf die morgige Ration voraus, darf solche Vorgriffe nicht einreißen lassen.
Wieder war die Gehmaschine in Charlottenburg. Mit flotten S-Bahnfahrten ist es nichts mehr. Gleich nach den ersten Versuchen ging etwas kaputt: die Bahn streikt wieder. Wir haben fleißig geschafft. Unsere Entwürfe und Vorschläge sollen nun bei allen möglichen zuständigen Ämtern eingereicht werden.
Eine neue Erfahrung wurde mir unterwegs zuteil. Aus einem Rasenplatz wurden Leichen ausgehoben zwecks Umbettung auf einen Friedhof. Eine Leiche lag bereits auf dem Schutt. Ein lehmiges, längliches Bündel in Segeltuch. Der ausgrabende Mann, ein älterer Zivilist, wischte sich den Schweiß mit seinen Hemdärmeln und fächelte sich mit seiner Kappe Luft zu. Zum ersten Mal verspürte ich, wie Menschenaas riecht. In allen möglichen Schilderungen hab ich den Ausdruck »süßlicher Leichengeruch« gefunden. Ich finde das Beiwort »süßlich« ungenau und keineswegs ausreichend. Mir kommt dieser Dunst gar nicht wie ein Geruch vor; eher wie etwas Festes, Dickliches, wie ein Luftbrei, ein Brodem, der sich vor dem Gesicht und den Nüstern staut; der zu stockig und dicht ist, um eingeatmet zu werden. Es verschlägt einem die Luft. Es stößt einen zurück wie mit Fäusten.
Überhaupt stinkt Berlin jetzt sehr. Der Typhus geht um; die Ruhr läßt kaum jemanden aus. Herrn Pauli hat sie kräftig erwischt. Und die Grindige ist, wie ich abends hörte, abgeholt worden, sie soll in irgendeiner Typhusbaracke liegen. Überall fliegenverseuchte Müllfelder. Fliegen über Fliegen, blauschwarz und fett. Muß das ein Leben für die Biester sein! Jeder Kotkrümel ist eine summende, schwarzwimmelnde Kugel.
Eine Parole hat die Witwe gehört, sie geht derzeit in Berlin um: »Die strafen uns mit Hunger dafür, daß etliche Werwölfe in diesen Tagen auf Russen geschossen haben.« Ich glaube nicht daran. In unserer Gegend sieht man überhaupt keine Russen mehr, da wäre gar keine Beute für Werwölfe. Ich weiß nicht, wo die Iwans geblieben sind. Die Witwe behauptet, daß die eine der beiden in unserem Haus verbliebenen Jubelschwestern, Anja mit dem niedlichen Söhnchen, nach wie vor fleißig anschleppenden Russenbesuch bekomme. Wer weiß, ob das gutgeht. Ich sehe Anjas weiße Gurgel im Geiste schon aufgeschlitzt über der Sofalehne.
(Ende Juni an den Rand gekritzelt: Nicht Anja und nicht Gurgel, aber eine Inge, zwei Häuser weiter, nach einer Saufnacht mit vieren, Unbekannten, bisher nicht Entdeckten, am Morgen mit zerklopftem Schädel aufgefunden. Erschlagen mit einer - natürlich leeren - Bierflasche. Bestimmt nicht aus Bosheit oder Mordgier, sondern einfach so, vielleicht im Streit um die Reihenfolge. Oder diese Inge hat über ihre Besucher gelacht. Betrunkene Russen sind gefährlich, sie sehen rot, wüten gegen sich und gegen jeden, wenn gereizt.)
Ein Tag für mich. Ich suchte zusammen mit der Witwe Bren-nesseln und Melde. Wir streiften durch des Professors zerstörten, verwilderten Garten. Selbst wenn ich noch eine amtliche Erlaubnis zur Gartenbestellung erhielte - hier käme sie zu spät. Fremde Hände haben ganze Äste vom Kirschbaum abgeschlagen, haben die kaum erst gelben Kirschen abgepflückt. Hier wird nichts reifen, die Hungrigen ernten schon vorher.
Kälte, Sturm und Regen. Zum ersten Mal fuhr durch unsere Straße wieder die Straßenbahn. Ich fuhr gleich mit, stieg ein, bloß um zu fahren, überlegte mir aber unterwegs, daß ich gut zum Rathaus fahren und nachfragen könnte, ob wir tatsächlich für unsere Arbeit im Dienste der Russen, für die Woche auf dem Fabrikgelände, Lohn zu erwarten hätten. Wirklich fand ich meinen Namen dort in einer Liste wieder; säuberlich war jeder Arbeitstag vermerkt, für mich und für die anderen Frauen. Sogar Abzüge für die Steuern waren eingetragen. Ausgezahlt erhalte ich 56 Mark - allerdings erst, wenn wieder Geld in der Stadtkasse ist. Der Angestellte forderte mich auf, nächste Woche nochmals nachzufragen. Immerhin wird doch wieder registriert und addiert und kassiert, da werde ich schon was kriegen.
Während ich in Sturm und Regen auf die Bahn für die Rückfahrt wartete, sprach ich mit einem Flüchtlingspaar. Mann und Frau, sind seit achtzehn Tagen unterwegs. Sie kamen aus der Tschechei, berichteten Böses. »Der Tscheche nimmt den Deutschen an der Grenze das Hemd ab und schlägt sie mit der Hundepeitsche«, sagt der Mann. Und darauf die Frau, müde: »Wir dürfen nicht klagen. Wir haben's ja selbst so gewollt.« Alle Oststraßen sollen von Flüchtlingen wimmeln.
Während der Heimfahrt sah ich Menschen aus einem Kino kommen. Sofort stieg ich aus, begab mich zur nächsten Vorstellung in den ziemlich leeren Saal. Ein Russenfilm, Titel Sechs Uhr abends nach Kriegsende. Seltsames Gefühl, nach all der selbsterlebten Kolportage wieder in einem Kino zu sitzen, sich etwas vorspielen zu lassen.
Unter dem Publikum noch Soldaten neben etlichen Dutzend Deutschen, Kindern zumeist. Kaum eine Frau; noch trauen sie sich nicht ins Dunkle unter all die Uniformen. Übrigens kümmerte sich keiner der Männer um uns Zivilisten, alle schauten zur Leinwand, lachten fleißig. Ich fraß den Film. Er strotzt vor lebensstarken Typen: breiten Mädchen, gesunden Männern. Ein Tonfilm, er lief in russischer Sprache, ich verstand, da er unter einfachen Menschen spielte, ziemlich viel. Zum Schluß zeigte er als Happy End ein Siegesfeuerwerk über den Türmen von Moskau. Dabei soll er bereits 1944 gedreht worden sein. Das haben unsere Herren doch nicht riskiert, trotz aller vorweg genommenen Siegesfanfaren.
Читать дальше