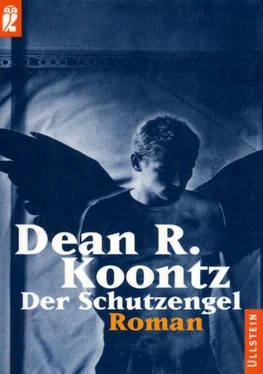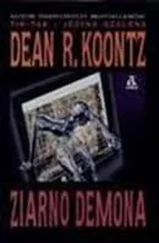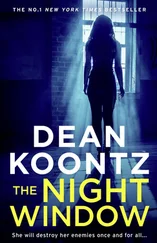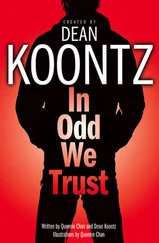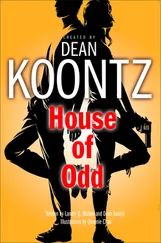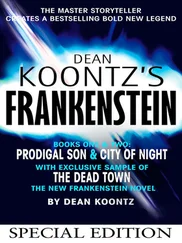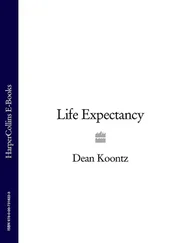»Ja. Aber auch ... Ich erinnere mich daran, wieviel Spaß wir beim Einkaufen, beim Anprobieren aller möglichen Sachen gehabt haben. Ich erinnere mich daran, wie sie gelächelt und gelacht hat.«
»Fühlst du dich schuldig? Hast du Schuldgefühle wegen Ninas Tod?«
»Nein. Nina könnte vielleicht noch leben, wenn ich nicht zu ihnen gekommen und Sheener dorthin gelockt hätte, aber ich kann mich deswegen nicht schuldig fühlen. Ich habe mich sehr bemüht, ihnen eine gute Pflegetochter zu sein, und sie sind glücklich mit mir gewesen. Aber dann hat das Leben uns eine große Sahnetorte ins Gesicht geworfen - und dafür kann ich nichts. Die Sahnetorten sieht man nie kommen; eine Komödie, in der man sie kommen sieht, taugt nichts.«
»Sahnetorte?« fragt er verwirrt. »Du siehst das Leben als Komödie?«
»Teilweise.«
»Das Leben ist also nur ein Witz?«
»Nein. Das Leben ist ernst und zugleich ein Witz.«
»Aber wie kann das sein?«
»Wenn Sie das nicht wissen«, antwortete sie, »sollte ich vielleicht hier die Fragen stellen.«
Laura füllte viele Seiten ihres Tagebuchs mit Beobachtungen über Dr. Will Boone. Über ihren unbekannten Beschützer schrieb sie jedoch nichts. Sie versuchte auch, nicht mehr an ihn zu denken. Er hatte sie im Stich gelassen. Sie hatte auf ihn vertraut; seine heroischen Bemühungen, sie zu retten, hatten sie zur Überzeugung gebracht, etwas Besonderes zu sein, und ihr über den Tod ihres Vaters hinweggeholfen. Jetzt kam sie sich töricht vor, weil sie sich überhaupt je auf ihn verlassen hatte. Seinen kurzen Brief, den sie nach der Beerdigung ihres Vaters auf ihrem Schreibtisch gefunden hatte, bewahrte sie noch auf, aber sie las ihn nicht mehr. Sein mehrmaliges Eingreifen rückte mehr und mehr in den Bereich kindischer Phantasien, aus dem sie herauswachsen mußte.
Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags kehrten sie mit den Geschenken, die sie von Wohltätigkeitsorganisationen und privaten Wohltätern bekommen hatten, in ihr Zimmer zurück. In ihrer Festtagsstimmung begannen sie Weihnachtslieder zu singen, und Laura war ebenso überrascht wie die Zwillinge, als Tammy mit einstimmte. Sie sang leise und zaghaft mit.
In den folgenden Wochen gab Tammy das Nägelkauen beinahe ganz auf. Sie war nur um weniges zugänglicher als bisher, wirkte aber ruhiger und selbstzufriedener als je zuvor.
»Vielleicht fühlt sie sich allmählich wieder sauber«, vermutete Thelma, »wenn kein Sittenstrolch mehr in der Nähe ist, der sie belästigt.«
Am Freitag, dem 12. Januar 1968, war Lauras dreizehnter Geburtstag, den sie jedoch nicht feierte. Ihr war nicht nach Feiern zumute.
Am Montag darauf mußte sie aus dem McIllroy Home in das reichlich acht Kilometer entfernte Jugendheim Caswell Hall in Anaheim übersiedeln.
Ruth und Thelma halfen ihrer Freundin, das Gepäck in die Eingangshalle hinunterzutragen. Laura hätte sich niemals vorstellen können, daß sie das McIllroy eines Tages mit solchem Bedauern verlassen würde.
»Im Mai kommen wir nach«, versicherte Thelma ihr. »Am 2. Mai werden wir dreizehn und kommen hier raus. Dann sind wir wieder zusammen.«
Als die Sozialarbeiterin aus Caswell kam, fuhr Laura nur ungern mit. Aber sie sträubte sich nicht.
Caswell Hall war eine ehemalige High School, die durch den Einbau von Schlafräumen, Spielzimmern und Personalbüros in ein Jugendheim umgewandelt worden war. Deshalb war die Heimatmosphäre dort stärker ausgeprägt als im McIllroy Home.
Caswell war auch gefährlicher als McIllroy, weil die Jugendlichen älter waren - und weil viele von ihnen bereits ein- oder mehrmals Straftaten begangen hatten. Der Handel mit Marihuana und Amphetaminen blühte, Schlägereien unter den Jungen - und sogar unter Mädchen - waren an der Tagesordnung. Wie im McIllroy bildeten sich Cliquen, aber in Caswell kamen sie nach ihrer Struktur und Funktion in gefährliche Nähe zu Straßenbanden. Diebstähle waren keine Besonderheit.
Schon nach wenigen Wochen erkannte Laura, daß es zwei Arten von Überlebenskünstlern gab: die einen, die ihre Kraft aus der Tatsache schöpften, daß sie einmal sehr geliebt worden waren; und die anderen, die nicht geliebt worden waren und statt dessen gelernt hatten, von Haß, Rachsucht und Verdächtigungen zu leben. Einerseits spöttelten diese über das Verlangen nach Zuneigung, anderseits beneideten sie jene, die der Liebe fähig waren.
Laura bewegte sich in Caswell mit äußerster Vorsicht, ohne jedoch zuzulassen, daß ihre Angst ihr Verhalten regierte. Die Schlägertypen konnten einem Angst machen, sie waren aber auch mitleiderregend und in ihrer Selbstdarstellung und mit ihren Ritualen der Gewalt sogar komisch. Laura fand keine Freundinnen wie die Ackersons, die ihren Sinn für schwarzen Humor geteilt hätten, deshalb vertraute sie das meiste nur ihrem Notizbuch an. In diesen sauber geschriebenen Monologen kehrte sie sich nach innen - und wartete darauf, daß die Ackersons dreizehn würden. Diese Zeit war für Laura eine unendlich bereichernde Periode der Selbstfindung und des wachsenden Begreifens jener tragikomischen Welt, in die sie hineingeboren worden war.
Am 30. März, einem Samstag, saß sie in Caswell lesend in ihrem Zimmer, als sie hörte, wie eine ihrer Zimmergenossinnen - ein weinerliches Mädchen namens Fran Wicken: - draußen im Flur mit einem anderen Mädchen über einen Brand sprach, bei dem Kinder umgekommen waren. Laura hörte nur mit halbem Ohr zu, bis das Wort »McIllroy« fiel.
Laura lief ein kalter Schauer über den Rücken, ihr Herzschlag jagte, und sie bekam feuchte Hände. Sie ließ das Buch fallen und stürzte auf den Flur hinaus, so daß die beiden Mädchen erschraken. »Wann? Wann hat’s gebrannt?«
»Gestern«, sagte Fran.
»Wie viele sind u-umgekommen?«
»Nicht viele, nur zwei, glaub’ ich, vielleicht auch nur eins -aber ich hab’ gehört, daß es nach verbranntem Fleisch gerochen hat. Muß doch scheußlich sein .«
Laura baute sich dicht vor Fran auf. »Wie haben sie geheißen?«
»He, laß mich doch!«
»Wie sie geheißen haben, will ich wissen!«
»Ich weiß keine Namen, Jesus, was hast du plötzlich?«
Laura wußte gar nicht, daß sie von Fran abließ und aus dem Heimgelände rannte, fand sich plötzlich mehrere Blocks weit von Caswell Hall entfernt auf der Katella Avenue wieder. Dort führte die Straße teilweise ohne Gehsteig durch ein Industrieareal, so daß Laura auf dem Bankett nach Osten weitertrabte, während der Verkehr rechts von ihr vorbeirauschte. Nach McIllroy waren es über acht Kilometer, und sie kannte die Strecke nicht, vertraute aber ihrem Instinkt, rannte solange, bis sie nicht mehr konnte, ging ein Stück und fiel dann wieder in Trab.
Vernünftigerweise hätte sie sich in Caswell an eine Heimerzieherin wenden und sie nach den Namen der bei dem Brand in McIllroy umgekommenen Kinder fragen sollen. Laura hatte jedoch die verrückte Vorstellung, das Schicksal der Ackerson-Zwillinge hinge einzig und allein von ihrer Bereitschaft ab, zu Fuß nach McIllroy zu gehen, um nach ihnen zu fragen. Wenn sie sich telefonisch nach ihnen erkundigte, würde sie erfahren, sie seien tot; nahm sie jedoch die Strapazen dieses Fußmarsches auf sich, würde sich herausstellen, daß die beiden in Sicherheit waren. Es war purer Aberglaube, aber Laura unterwarf sich ihm bedingungslos.
Die Abenddämmerung sank herab. An diesem Abend Ende März leuchtete der Himmel in einem schmutzigen Karmesin-und Purpurrot, und die Wolkenränder schienen in Flammen zu stehen, als Laura endlich das McIllroy Home vor sich hatte. Zu ihrer großen Erleichterung wies die Vorderfront des alten Herrenhauses keine Brandspuren auf.
Obwohl Laura schweißnaß war, vor Erschöpfung zitterte und bohrende Kopfschmerzen hatte, lief sie nicht langsamer, als sie das unbeschädigte Gebäude sah, sondern behielt ihr Tempo auch auf den letzten hundert Metern bei. Im Erdgeschoß be-gegneten ihr ein halbes Dutzend Heimkinder, und auf der Treppe kamen ihr drei weitere entgegen, von denen zwei sie anredeten. Aber sie blieb nicht stehen, um sie nach dem Brand zu fragen. Sie mußte sehen, was passiert war.
Читать дальше